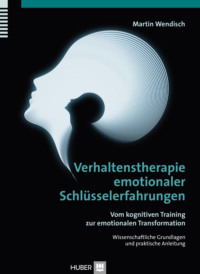Kitabı oku: «Verhaltenstherapie emotionaler Schlüsselerfahrungen», sayfa 2
Danksagung
Zunächst einmal bedanke ich mich bei meinen Supervisanden, Selbsterfahrungskandidaten, Ausbilder- und Gutachterkollegen für zahlreiche Diskussionen, Rückmeldungen und die Möglichkeit des Austauschs und der Erprobung unzähliger Einzelaspekte des hier beschriebenen Vorgehens. Ein ganz besonders großer Dank geht in allererster Linie an Frau PD Dr. Eva-Marie Kessler, die mich bei der Fertigstellung des Manuskriptes durch intensive Lektüre und Rückmeldungen beraten hat und die diese Behandlungsstrategie in Berlin auch selbst erprobt und mit mir diskutiert hat.
Darüber hinaus danke ich für die konkrete Beratung in Einzelfragen Herrn Prof. Dr. Martin Grosse Holtforth für Unterstützung beim Kapitel über Depressionsbehandlung und über Therapieziele, Herrn Prof. Dr. Wolfgang Lutz für die Beratung zur Effektstärkentabelle, Herrn Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker für die Klärung von Definitionsfragen zum Traumabegriff, Herrn Prof. Dr. Dirk Zimmer und Frau Dresenkamp für Daten zur Ausbildung und Selbsterfahrung, Herrn Dr. Zarbock für das Gegenlesen des Kapitels zu Rahmenbedingungen.
1. Psychotherapieforschung
1.1 Psychiatrie: Forschung und Versorgung
Für die Psychiatrie und die schwersten psychischen Störungen (Psychosen, schwerste Depressionen, schwere Persönlichkeitsstörungen) ist der Fortschritt für die letzten 30 Jahre (der Generation von 1982 bis heute) nach Aussage von Prof. Priebe eher «ernüchternd». Mit «Fortschritt» meint Priebe «nicht neues Wissen – wie etwa Erkenntnisse über soziale und genetische Bedingungsfaktoren, biologische Korrelate von Störungen oder Wirkmechanismen von Therapien –, sondern allein die Entwicklung von effektiven Behandlungen für die Patienten, also das, was den Patienten in der täglichen Praxis wirklich zugutekommt und ihr Leiden lindert». Priebe resümiert, dass sich zwar die Versorgung der Patienten in den letzten 30 Jahren deutlich gebessert habe («…vor allem massive Investitionen in bessere Einrichtungen und zusätzliches Personal»), sich aber hinsichtlich der Wirksamkeit von Neuroleptika keine Verbesserungen und hinsichtlich Antidepressiva nur kurzfristige Effekte –und diese auch nur bei schweren Störungen – gezeigt hätten: «Es gibt kein einziges neues Medikament, das deutlich wirksamer wäre als die früher zur Verfügung stehenden (in der Generation davor, 1952–1982). Eventuelle Vorteile in Nebenwirkungsprofilen sind sicher wichtig, erhöhen aber nicht die Wirksamkeit.» Es sei über die Zeit «immer schwieriger» geworden, eine «spezifisch behandelte Behandlungsgruppe von einer unspezifisch behandelten Kontrollgruppe zu unterscheiden». Dies habe zunächst zu einer Diskussion des Placeboeffektes geführt, der sich aber nicht habe nachweisen lassen. Fazit aus dieser Diskussion sei, dass die Wirksamkeit der Standardbehandlungen zugenommen habe! Eine wesentliche Bedeutung komme daher den sog. unspezifischen Therapieeffekten zu: «Dazu gehören die Effekte einer guten therapeutischen Beziehung, einer allgemeinen sozialen Unterstützung, unterschiedlicher psychologischer Hilfen auch außerhalb formaler Psychotherapie und eines hilfreichen therapeutischen Milieus.» Er schließt daraus: «Die gezielte Untersuchung von bisher als unspezifisch betrachteten Behandlungsfaktoren könnte dabei ein lohnendes Feld sein.»
Eine alarmierende Entwicklung wird in den Vereinigten Staaten wahrgenommen (Sonderausgabe der Clinical Psychology Review 2013). Dort dürfen Psychopharmaka genauso beworben werden wie Erfrischungsgetränke. Zusammen mit der schlechten Bezahlung für Psychotherapie führt dies dazu, dass immer mehr Psychopharmaka verschrieben werden – auch an nicht beeinträchtigte Personen – und forschungsseitig immer mehr Geld in die Erforschung «biologischer Ursachen» psychischer Erkrankungen investiert wird anstatt in Psychotherapieforschung (Deacon 2013 S. 851). Doch trotz dieser massiven Unterstützung des biomedizinischen Modells hat sich nach 30 Jahren und milliardenschweren Investitionen immer noch kein biologischer Marker mit ausreichender Sensitivität finden lassen, der für irgendeine psychische Störung relevant ist (Gaudiano & Miller 2013 S. 820). Eine Richtungsänderung der Forschung ist jedoch nach wie vor nicht erkennbar. Eine solche Entwicklung lässt sich nur noch im Rückgriff auf ökonomische Interessen verstehen, in deren Kontext der scheinbar informierte Patient nur noch als Konsument ernst genommen wird.
Fazit: Selbst in der stark von Pharmakotherapie bestimmten Psychiatrie hat sich der Placebobegriff und die einfache Übertragung des Paradigmas spezifischer kausaler Medikamentenwirkungen auf psychosoziale Interventionen aufgelöst zugunsten einer differenzierteren Betrachtung störungsunspezifischer bzw. allgemeiner Behandlungseinflüsse auf den Patienten. Die Zukunft liegt hier in der Erforschung dieser allgemeinen Behandlungseinflüsse. Und es wird deutlich, dass für den Patienten spürbare Fortschritte sich manchmal mehr in der Versorgung und in der Gesundheitspolitik abspielen als in der Wissenschaft. Für die USA kann man in der Summe wohl eher von Rückschritten sprechen.
Konsequenzen für die Praxis
Die sog. «unspezifischen Behandlungseinflüsse» sollten in der Psychotherapie mindestens so viel Beachtung finden wie die «störungsspezifischen». Der Glaube daran, dass klinische Forschung immer auf den Nutzen für den Patienten ausgerichtet ist, sollte bei aller Wertschätzung einer differenzierteren Betrachtung weichen.
1.2 Effektforschung und evidenzbasierte Psychotherapie
In der Psychotherapieforschung haben sich in den letzten 30 Jahren zwei unterschiedliche Ansätze entwickelt, die von Strauss & Wittmann (2005) als «zwei Welten» beschrieben werden: die Effektforschung und die Prozessforschung. Diese zwei Forschungsparadigmen führen zu sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf die Psychotherapie und zu unterschiedlichen Evidenzen. Paradigmenspezifisch resultieren erhebliche Unterschiede in der Einschätzung dessen, ob der Erfolg einer Psychotherapie durch (störungs-)spezifische Techniken erreicht wird oder überwiegend durch störungsunspezifische Faktoren, was manchmal analog der Pharmaforschung als «Placeboeffekt» bezeichnet wird.
Dass Psychotherapie wirkt, ist inzwischen nicht mehr umstritten. An über 80 000 Patienten konnte nachgewiesen werden, dass jede finanzielle Ausgabe für Psychotherapie hinsichtlich der Ausgaben für Medikamente, Krankenhausaufenthalte, Arztbesuche und der Folgekosten bei Arbeitsunfähigkeit zwei- bis sechsmal wieder eingespart wird (Grawe & Baltensperger 2001; Margraf 2009). Der durchschnittliche Nettonutzen liegt nach Wittmann et al. (2011) unter Verwendung konservativer Schätzverfahren bei 1 zu 2,5, also wird jeder Euro mindestens zweieinhalbmal wieder eingespart! Psychotherapie ist inzwischen ein hervorragend evaluiertes Interventionsfeld! Umstritten ist lediglich, wie sie wirkt (Wirkungsweise), als Hauptgegenstand der Prozessforschung. Nichts illustriert den Nutzen und die Aussagen der Effektforschung mehr als eine vergleichende Übersicht unterschiedlicher Behandlungsverfahren. Es dürfte das Selbstbewusstsein von Psychotherapeuten stärken, wenn sie sehen, dass Psychotherapie im Durchschnitt höhere Effektstärken erzielt als die meisten medizinischen Maßnahmen (Effektivität). Nach Cohen (1992) gilt eine Effektstärke von 0,2 als «klein», von 0,5 als «mittel» und von 0,8 als «groß». Da die Kosten von Psychotherapie vergleichsweise gering sind, liegt hier der break even (also der Grad der Effektivität, an dem Kosten und Nutzen sich neutralisieren) bei 0,1! Im Vergleich dazu zeigt sich in der folgenden Tabelle 1, dass Psychotherapie ein hochgradig wirksames Behandlungsfeld ist und die Arbeit an weiteren Verbesserungen auf einem sehr hohen Niveau stattfinden.
Schaut man sich die Werte zur Verhaltenstherapie an, dann kann man in der Tat Fortschritte erkennen von der ersten bis zur dritten Welle: Während sich die mittleren Effektstärken der kognitiven Verhaltenstherapie zur klassischen Verhaltenstherapie nur geringfügig unterscheiden, gibt es einen deutlichen Sprung von der kognitiven Verhaltenstherapie zur Schematherapie, allerdings nicht zur Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Insofern müssen die Therapien der dritten Welle differenziert betrachtet werden. Der erhebliche Wirksamkeitszuwachs der Schematherapie und ihre große positive Resonanz bei Praktikern sind einen differenzierten Blick darauf wert, was diese Art der therapeutischen Arbeit von der (inzwischen) konventionellen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Arbeit unterscheidet (Kap. 5.3 zur dritten Welle). Bemerkenswert ist im Hinblick auf die Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung, dass die kognitive Variante mit intensiver imaginativer Nachverarbeitung deutlich wirksamer ist als klassische Expositionsverfahren oder klassische kognitive Verhaltenstherapie (Ehlers 1999 S.74).
Tabelle 1: Effektstärken medizinischer und psychotherapeutischer Behandlungen

Anm.: Die Vergleichbarkeit der Zahlen ist eingeschränkt bezüglich unterschiedlicher Designs, Berechnungsarten, unterschiedlich sensitiver Messinstrumente und unterschiedlicher Interessen seitens der Forschergruppen (z. B. höhere ES bei neuen Verfahren). Cuijpers et al. 2010 konnten sowohl einen Publikationsbias belegen (d. h. gewichtet man die große Anzahl der Effektivitätsstudien der KVT in den Metaanalysen, kommt man zum Beispiel für die KVT bei Depressionen von durchschnittlich g = 0,67 auf g = 0,42). Ebenso ließen sich starke Allegiance-Effekte nachweisen (Ausmaß der Identifikation des Forschers mit dem Behandlungsansatz). Man kann sich allerdings nur schwer eine Behandlung vorstellen, in der die Therapeuten nicht mit dem Behandlungsansatz identifiziert sind.
Schaut man sich die Werte zur psychoanalytischen Therapie an, dann scheint es insbesondere von der klassischen übertragungsorientierten Therapievariante zur mentalisierungsbasierten Therapie in der Gruppe deutliche Fortschritte zu geben, was Grund genug sein kann, sich mit dem Konzept der Mentalisierung auseinanderzusetzen (Kap. 6.2). Schultz-Venrath (2013 S.41 f) weist bezüglich der psychoanalytischen Verfahren darauf hin, dass zum Ersten die therapeutische Erfahrung einen erheblichen Unterschied in der Wirkung ausmache (zum Beispiel erreichen unerfahrene Gruppentherapeuten einen Wirkungsgrad von 0,59, erfahrene hingegen einen von bis zu 3,1), und zum Zweiten gelte das Äquivalenzparadox der Gleichwirksamkeit aller Behandlungsverfahren nicht für den Unterschied zwischen Kurzzeit- und Langzeittherapie.
Dies stimmt auch mit den Ergebnissen des Konsumreports – einer groß angelegten naturalistischen Studie – von Seligman (1995) überein: Die Ergebnisse zeigten, dass Psychotherapie in der Regel sehr hilfreich war und Behandlungen, die länger als sechs Monate durchgeführt wurden, aus Sicht der Antwortenden eine größere Verbesserung zur Folge hatten. Dieser Mehrnutzen war für Therapien nach der 100. Sitzung wieder rückläufig.
Nicht alles wirkt durchschnittlich gleich gut, und so kann man sowohl auf der Ebene des Verfahrens als auch auf der Ebene einzelner Techniken durchschnittliche Wirkungen gegenüberstellen und diese auch bei verschiedenen Diagnosegruppen differenzieren. Hier sind in den letzten 30 Jahren erhebliche Fortschritte gemacht worden. Psychotherapie (insbesondere kognitive VT) konnte bei Depressionen und Angststörungen als wirksamer eingestuft werden als reine Pharmakotherapie; bei mittelschweren Störungen und Komorbidität zeigt sich zumindest eine Kombinationstherapie aus Medikamenten und Psychotherapie der reinen Pharmakotherapie überlegen.
Auch hier gibt es eine Placebodiskussion, die vor allem dazu dient, spezifisch wirksame Interventionen besser voneinander zu unterscheiden und die allgemein wirksamen Effekte herauszurechnen. Dabei lässt man dann aber vermutlich genau das unter den Tisch fallen, was rein quantitativ die größere – aber eben nicht spezifische – Wirkung ausmacht: zum Beispiel die kommunikative und soziale Kompetenz von Therapeuten, die nicht zu unterschätzende Rolle der Gesprächsführung, die Güte des Fallkonzeptes und die darauf folgende individuelle Behandlungsstrategie (im Kontrast zur «individuellen» Anwendung einer bereits vorher feststehenden Methode) und nicht zuletzt die Frage, ob langfristige emotionale Belastungen zum Gegenstand der therapeutischen Arbeit gemacht werden oder nicht.
Es werden regelmäßig in störungsspezifischen Therapien auch erhebliche störungsunspezifische Einflüsse nachgewiesen; z. B. Flückiger (2012) konnte nachweisen, dass im Therapieverlauf auch von störungsspezifischen/evidenzbasierten Therapien die Bedeutung der therapeutischen Beziehung sehr relevant ist, und zwar unabhängig davon, wie stark sich der behandelnde Therapeut an das zugrunde liegende Therapierational hält. Daraus erwächst unter anderem für Flückiger (2012) die Konsequenz, dass allgemeine Behandlungsfaktoren wesentlich stärker auch in Manualen beachtet werden sollten.
Unbestritten ist jedoch in einigen Forschungsbereichen zur Panikstörung, zu Depressionen und psychosomatischen Störungen, dass es mit dem Nachweis der Bedeutung störungsspezifischer Interpretationen von körperlichen Prozessen (psychophysiologische Wechselwirkungen) gelang, immer wieder aufkeimenden biologistischen Theorien aus der somatischen Medizin und Psychiatrie entgegenzutreten und die Notwendigkeit psychologischer Interventionen zu belegen (s. dazu auch die Diskussion zum Panikmodell von Margraf & Schneider in Kap. 5.2).
Ein weiteres Verdienst der Effektforschung ist die Entwicklung der Beschreibung standardisierter Interventionen, die zwar zunächst primär aus Forschungsinteressen erfolgte (Sicherstellung der methodentreuen Durchführung aller teilnehmenden Therapeuten), dann aber sehr interessiert in der Versorgungspraxis aufgenommen wurde. Dies löste eine ganze Welle von störungsspezifischen Manualen aus, die bis heute anhält und in dieser Überbetonung eine kontraproduktive Seite entwickelt hat, nämlich die Reduktion des Verständnisses für den Therapieprozess auf eine sequenzielle Abfolge von Behandlungsmethoden. Man kann wohl auch sagen, dass die Diskussion um die störungsspezifische Therapie deshalb besonders intensiv geführt wird, weil hier große finanzielle und politische Interessen im Spiel sind. Das Interesse der Kostenträger an einer möglichst kurzen und billigen Therapie trifft hier auf wissenschaftliche Interessen, die an kurzfristigen und symptomorientierten Kriterien therapeutische Verfahren bewerten und damit primär die Interessen der Kostenträger bedienen und nur scheinbar die Interessen von Patienten. In den Anfängen der Verhaltenstherapie als Kassenleistung wurde beispielsweise gefordert, dass keine Verhaltenstherapie einer Angststörung länger als 15 Sitzungen dauern sollte, wenn wissenschaftlich fundierte Expositionsmethoden zum Einsatz kommen. An dieser Forderung kann man die Reduktion auf die technischen Aspekte und die Bedienung der Interessen der Kostenträger deutlich erkennen. Diese Entwicklung führte zu einer Vernachlässigung der sog. unspezifischen Wirkfaktoren. Nach 30 Jahren etablierter Verhaltenstherapie hat sich in der Versorgungspraxis jedoch die ausschließlich technische Rolle des Therapeuten als Anwender wirksamer Methoden relativiert.
Lambert & Barley (2002) quantifizieren die verschiedenen Anteile am Therapieerfolg bei Effektstudien und stellen fest, dass ca. 30 % der Erfolgsvarianz auf «unspezifische» Faktoren zurückgehen, 15 % auf Erwartungseffekte seitens der Patienten, 15 % auf spezifische Methoden (s. o.) und 40 % auf außertherapeutische Veränderungen in der Lebenswelt der Patienten. Diese Quantifizierung war als nicht empirisch umstritten und wurde von Cuijpers et al. (2012) erstmals überprüft: Bezüglich Depressionsstudien kam man auf 17,1 % (spezifisch), 49,6 % (unspezifisch) und 33,3 % (außertherapeutisch). Damit wurden die Schätzungen von Lambert & Barley erstmals empirisch bestätigt. Diese Berechnungen relativieren den störungsspezifischen Beitrag zum Gelingen einer Therapie erheblich.
Grawe (1998) weist auf die erhebliche Überschätzung störungsspezifischer Techniken hin («Die störungsspezifische Psychotherapieforschung siegt sich zu Tode»). Er rechnete vor, dass von 100 Patienten mit Depressionen faktisch ca. 14 Patienten nachhaltig mit den wirksamsten Verfahren geholfen wird, wenn man die Ablehner einer solchen Behandlung, die Abbrecher, die Non-Responder und diejenigen mit Rückfällen herausrechnet (14 %).
Trotzdem kann man im Querschnitt konstatieren, dass der mit störungsspezifischen Techniken erklärbare Erfolg immer noch im Vergleich über dem Erfolg einer reinen Pharmakotherapie liegt. Die Relativierung der störungsspezifischen Effekte darf nicht dazu führen, dass die spezifischen Faktoren in einem allgemein angelegten Konzept untergehen. Trotzdem werden immer wieder neue störungsspezifische Behandlungspakete aufgelegt mit angeblich noch besserer Wirkung. Nicht auszuschließen ist daher, dass sich mit dem Erfinden immer wieder neuer Interventionspakete und den darin liegenden Effizienzversprechen schneller eine akademische Karriere machen lässt als mit der Weiterentwicklung der vorhandenen Konzepte (Priebe 2012), auch wenn sich diese Erwartungen in der Regel nicht erfüllen. Dies unterstreicht den Mainstream der Ökonomisierung auch in der Wissenschaft.
Fazit: Insgesamt sollte die Konsequenz aus diesen Befunden sein, das psychotherapeutische Behandlungsangebot deutlich zu verbreitern, um die Fehlallokation finanzieller Mittel in Bereichen mit sehr geringem Wirkungsgrad oder sogar negativer Wirkung zu verhindern.
Konsequenzen für die Praxis
Psychotherapie ist hochgradig wirksam. Etwa 17 % der Wirkung gehen auf störungsspezifische Effekte zurück, 50 % auf unspezifische Effekte und 33 % auf außertherapeutische Effekte. Dieses Verhältnis sollte sich auch in Ausbildungen und in der Therapieplanung niederschlagen und ist ein Hinweis auf die Notwendigkeit einer übergeordneten transdiagnostischen Modellbildung.
1.3 Ist die störungsspezifische Effektforschung eine Sackgasse?
Mit jedem Forschungsparadigma ist das Risiko einer Artefaktbildung verbunden: In der störungsspezifischen Forschung wird angesichts hoch ausgelesener Stichproben und ausschließlicher Fokussierung auf spezifische Behandlungsaspekte die Wirksamkeit technischer Aspekte überschätzt und die Wirksamkeit anderer störungsunspezifischer Interventionen und vor allem die Bedeutung der therapeutischen Interaktion unterschätzt. Damit wird der Illusion einer isolierten Wirksamkeit standardisierter Methoden/Techniken Vorschub geleistet. Diese Vorstellung der spezifischen Anwendung einer wirksamen Technik bedient sehr das Alltagsverständnis vieler Menschen («Reparaturmodell») und auch der Kostenträger («Schnell und wirksam = billig und gut»). Mit dieser Einengung von Psychotherapieforschung auf die vergleichende Effektforschung analog zur Pharmaforschung wiederholt sich ein zentrales Dilemma der Medizin: nämlich die Aufspaltung des Menschen in viele spezialisierte Organ- bzw. Störungsbereiche zuungunsten einer – seit Langem erfolglos geforderten – Aufwertung einer psychosomatisch orientierten Allgemeinmedizin bzw. sprechenden Medizin; eine Forderung, die zumindest bei chronischen Krankheitsverläufen essenziell ist. Analog dazu werden immer mehr Spezialsprechstunden und Spezialeinrichtungen für bestimmte psychische Krankheitsbilder eingerichtet und vorschnell der Rahmen einer Analyse der sozial-emotionalen Ätiologie, Diagnostik und Therapie verlassen zugunsten einer Spezialpsychotherapie, die nur noch im engen Bereich einer spezifischen Störung eine Expertise vorweisen kann. Bereits 1996 gab es mit dem Aufkommen der Managed-Care-Organisationen (MCO) eine kritische Debatte über den Einfluss der Effektforschung auf die Praxis: Goldfried wie auch Seligman kritisierten die Liaison zwischen MCOs und Effektforschung. Sie drückten die Sorge aus, dass methodologische und konzeptuelle Verengungen der Forschungsrealität durch die MCOs in klinische Einschränkungen für praktisch tätige Therapeuten umgesetzt werden (Goldfried & Wolfe 1996 S. 1007). Dann könnten die Grenzen eines Forschungsparadigmas die künftige Entwicklung der Psychotherapie diktieren. Patienten würden routinemäßig mangelhafte Behandlungen erfahren; Erfahrung, Geschick und Ausbildung von Psychotherapeuten würden sich als Handicap erweisen. Nicht zuletzt würden einschneidende Behandlungsleitlinien für verschiedene Störungen veröffentlicht, deren Nichtbefolgung mit dem Risiko von Kunstfehler-Prozessen bedroht sei (Seligman 1996 S. 1012). Im Rückblick haben sich alle diese Vorhersagen als zutreffend erwiesen.
Das Modell der störungsspezifischen Evidenz scheint trotz (oder gerade wegen) seines Reduktionismus sehr attraktiv auch für viele Ausbildungskandidaten zu sein. Diese Attraktivität wird durch Begriffe wie «Der Goldstandard in der Behandlung von …» oder «State of the Art»-Seminare gesteigert. Diese Konzepte versprechen eine schnelle Sicherheit in der Behandlung von Patienten, wenn man sich nur genau an die standardisierte Interventionsbeschreibung hält. In diese Haltung passt auch das Ergebnis von Schulte (2001), wonach unerfahrene Therapeuten umso wirksamer sind, je mehr sie sich an ein Manual halten. Viele Therapeuten interpretierten dieses Ergebnis so, als ob generell in der Psychotherapie die «Manualtreue» der Garant für Wirksamkeit sei. Dabei ging es lediglich um die Sicherstellung der treatment integrity; also einer exakt gleichartigen Durchführung der Behandlung durch mehrere unerfahrene Therapeuten im Rahmen differenzieller Effektstudien: Das Ergebnis war somit ein typisches Artefakt bzw. von rein methodischer Bedeutung. Dass sich im Kontext täglicher Versorgung auf diesem Wege keine Wirksamkeit oder Sicherheit erreichen lässt, bemerken Ausbildungskandidaten in der Regel schon am Anfang oder spätestens in der Mitte ihrer Behandlungstätigkeit, wenn das Anwenden einer Technik trotz intensiver Schulung beim – nicht vorselegierten monosymptomatischen – Patienten nur teilweise oder gar nicht funktioniert oder sich der Patient gar verweigert oder damit droht, die Behandlung abzubrechen.
Zudem besteht bei Vorliegen mehrerer Störungen (was die Regel ist!) das Problem, in einen technischen Eklektizismus zu geraten, weil unterschiedlichste störungsspezifische Interventionen ohne ein Rahmenkonzept sequenziell miteinander verknüpft werden (Kap. 5.4 zur «Mainstream VT»). Damit entwickelt sich die störungsspezifische Psychotherapie zunehmend in die Sackgasse von Spezialistentum (mit Zertifikat) zuungunsten einer allgemeinen psychotherapeutischen Kompetenz (mit Approbation). Goldfried (2013) lehnt daher die in Analogie zur Pharmaforschung entwickelten RCT-Designs (Randomized Controlled Trials) ab und präferiert eine breite Berücksichtigung empirischer Befunde über den störungsspezifischen Rahmen hinaus (EBP evidence based practice).
Bastine (2012) folgert aus dem Komorbiditätsproblem der störungsspezifischen Forschung, dass die Vielfalt der unspezifischen ätiologischen und pathogenetischen Einflüsse, die eben nicht zu einer spezifischen Störung führen, in die Analyse und den Behandlungsplan einbezogen werden müssen. Er regt an: 1. die Einbeziehung der außertherapeutischen Lebensrealität der Patienten, 2. die Entwicklung störungsübergreifender Handlungsstrategien, 3. die Formulierung konkreter Vorstellungen für die Gestaltung der therapeutischen Beziehung, 4. die Einbeziehung störungsunspezifischer Problemaspekte wie Selbstwert, Identität, Emotionsregulation, Ressourcen bzw. positiver Erfahrungen, Verarbeitung unverarbeiteter Lebensereignisse, übergeordneter Lebensthemen. Er führt weiter aus: Trotz der daraus resultierenden Komplexität könne ein zielorientierter Prozess aus dem Umgang mit diesen Themen resultieren, der die Berücksichtigung der therapeutischen Beziehung einschließe (S. 24). Diesen Forderungen ist der vorliegende Band verpflichtet.
Fazit: Der Vorteil der Effektforschung besteht im systematischen Nachweis der Effektivität psychologischer Interventionen bei einzelnen Störungen und in der exemplarisch präzisen Beschreibung einzelner Interventionen. Dem stehen folgende Nachteile gegenüber: Verlust einer übergeordneten Behandlungsstrategie, Eklektizismus bei Komorbidität (unsystematisches Kombinieren von Interventionen), Vernachlässigung allgemeiner Ätiologiemodelle, der Persönlichkeit des Patienten und der entsprechenden Grundlagenforschung, Vernachlässigung der Bedeutung der therapeutischen Beziehung.
Konsequenzen für die Praxis
Die Effektforschung sichert den Nachweis der Effektüberlegenheit der psychologischen Behandlung gegenüber biomedizinischen Behandlungen innerhalb eines pharmaforschungsäquivalenten Vergleichsansatzes. Er ist reduziert, von geringer externer Validität, aber in dieser Hinsicht unverzichtbar. Er ist somit eine wichtige Evidenzgrundlage im übergeordneten medizinischen und gesundheitspolitischen Kontext und kann nachgeordnet in einem transdiagnostischen Therapieverständnis Hinweise geben auf zu priorisierende Methoden bei spezifischen Störungen. Überbewertet man jedoch die Effektforschung zu einem umfassenden Psychotherapieverständnis, so muss man zu dem Schluss kommen, dass sie in dieser Hinsicht mit nur 17 % erklärter Erfolgsvarianz unbrauchbare Konzepte liefert. Eine gleichartige Betrachtung von Psychotherapie und Medikamenten ist im Hinblick auf die Komplexität der Wirkunsgsweise unangemessen.