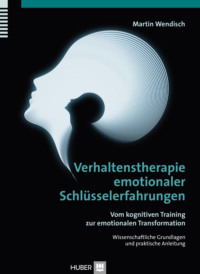Kitabı oku: «Verhaltenstherapie emotionaler Schlüsselerfahrungen», sayfa 3
1.4 Prozessforschung und Allgemeine Psychotherapie
Die Prozessforschung nimmt die allgemeinen Merkmale in den Blick und richtet sich auf die Zusammenhänge zwischen störungsunspezifischen Prozessmerkmalen und dem Erfolg einer Psychotherapie (generelle Wirkungsweise, Common-Factor-Forschung). Entscheidend am Common-Factor-Forschungsansatz ist, dass hier erstmals empirisch forschende Wissenschaftler unterschiedlichster Therapierichtungen (vor allem humanistisch, psychoanalytisch und verhaltenstherapeutisch orientiert) zu einem gemeinsamen Forschungsansatz finden. Eine groß angelegte Metastudie (eine Auswertung aller empirischen Studien über Psychotherapie zwischen 1959 und 1984) hatte bereits 1986 gezeigt, dass für die Wirkungsweise von Psychotherapie eine Vielfalt von allgemeinen Details ausschlaggebend ist (Orlinsky & Howard 1986). In der Reihenfolge ihrer Bedeutung spielt die «Offenheit» des Patienten die größte Rolle, dicht gefolgt von der «Qualität der therapeutischen Beziehung», dann die durchgeführten «Interventionen». Auf Therapeutenseite war die «soziale Kompetenz und Geschicklichkeit des Therapeuten» die wichtigste Komponente. Und aufseiten des Patienten wurde nicht etwa die Gegenwartsbezogenheit der Intervention als entscheidend herausgefunden, sondern die «emotionale Beteiligung» des Patienten und sein Eindruck, dass an für ihn relevanten Problemen gearbeitet wird. In therapeutischen Beziehungen war die emotionale «Resonanz» und die erlebte «Unterstützung» durch den Therapeuten das entscheidende Element in Verbindung mit der «Glaubwürdigkeit» und «Empathie» des Therapeuten.
Aus diesen Erkenntnissen entwickelten Orlinsky & Howard ein «Generic Model of Psychotherapy», das später auch von Grawe unter der Bezeichnung «Allgemeine Psychotherapie» weiterentwickelt wurde. Grawe (1994) analysierte alle Wirksamkeitsstudien bis ins Jahr 1991 und folgerte faktorenanalytisch vier Wirkfaktoren:
Eine wirksame Therapie
1. setzt an den Stärken des Patienten an (Ressourcenaktivierung),
2. führt zur Aktivierung belastender Probleminhalte (Problemaktualisierung),
3. ist mit einem vertieften Problem- und Selbstverständnis verbunden (Klärung)
4. und ist mit aktuellen Bewältigungserfahrungen verknüpft (Bewältigung).
Diese vier Elemente könnte man auch als sekundäre Wirkfaktoren bezeichnen, da sie alle erst in der Interaktion zwischen Therapeut und Patient zur Wirkung kommen. Entscheidend für das Wirkungsprofil einer Psychotherapie ist, dass alle vier Wirkfaktoren optimal genutzt werden. Grawe (1991) konnte in seinen Wirkprofilen zu unterschiedlichen Therapiemethoden und -verfahren nachweisen, dass in der tiefenpsychologisch fundierten und psychoanalytischen Therapie der Bewältigungsaspekt in zu geringem Ausmaße genutzt wird und in kognitiv-behavioralen Therapien der Klärungsaspekt. Ebenfalls ließ sich ableiten, dass zu starke Problemfokussierung auf Kosten der Ressourcenorientierung ebenso problematisch ist wie eine ausschließliche Ressourcenorientierung ohne Aktivierung und Behandlung der zentralen Probleme im Therapieprozess. Daraus folgend fordert Grawe eine «spezifische Beziehungsanalyse mit Berücksichtigung der Beziehungsgestaltung». Er integriert auch die störungsspezifischen Aspekte in seinen Ansatz einer «Psychologischen Therapie», indem er feststellt, dass Störungen eine «funktionale Autonomie» und «Eigendynamik» haben (als «Störungsattraktor» bezeichnet), die den Blick auf andere Bedingungen vorübergehend verstellen können und die es erfordern, dass man sich u. U. zunächst einmal mit der Störung auseinandersetzt und der Patient hier positive Veränderungen erfährt.
Fiedler (2012 S.7) resümiert den Common-Factor-Forschungsansatz und stellt die Annahme allgemeiner Wirksamkeitsfaktoren ohne spezifische Analyse infrage: Zum Beispiel könne Empathie als allgemein wirksamer Faktor auch negative Auswirkungen im Einzelfall haben (hier spielen die Patientenvariablen eine entscheidende Rolle). Außerdem sei der Umgang mit der therapeutischen Beziehung sehr unterschiedlich: In der Verhaltenstherapie würde man eine allgemein gute «Arbeitsbeziehung» anstreben, während man in der Psychoanalyse Störungen in der Beziehung als normale zu erwartende interaktionelle Phänomene anerkenne, die es aufzulösen gelte. In der Psychoanalyse würden regressive Prozesse für den Heilungsprozess eher toleriert, während in der Verhaltenstherapie möglichst schnell die aktuelle Bewältigung im Vordergrund stehe. Diese Unterschiede würden immer wieder zu einem neuen «Therapieschulengerangel» führen anstatt zu einer differenzierten Integration.
Fazit: Die wichtigste Evidenz dieser Forschungstradition ist – in scharfem Kontrast zu den Ergebnissen der Effektforschung – der Nachweis der fundamentalen Bedeutung der therapeutischen Beziehung, aber auch der Notwendigkeit, den Patienten individuell in den Mittelpunkt zu stellen und sowohl seine Erwartungen wie auch seine aktuelle Lebensrealität in die Therapie einzubeziehen. Der Ansatz der Allgemeinen Psychotherapie erweist sich als grundsätzlich geeignet, die störungsspezifischen Erkenntnisse einzubeziehen und übergeordnete Prioritäten zu setzen. Er bleibt allerdings auf einem hohen Abstraktionsniveau, um nicht zu sagen: «zu allgemein».
Konsequenzen für die Praxis
Eine gelingende Beziehung und die Fokussierung der emotional bedeutsamsten Themen des Patienten sind die wichtigsten Evidenzen der Prozessforschung. Beziehungsanalyse und Beziehungsgestaltung sollten daher immer Teil der Diagnostik und der Therapieplanung sein. Zudem sollten alle vier Wirkfaktoren in ein integriertes allgemeines Verständnis der Wirksamkeit von Psychotherapie einfließen.
1.5 Ist die Überbetonung Allgemeiner Psychotherapie eine Sackgasse?
Generell besteht in diesem Forschungsansatz das Risiko eines zu hohen Abstraktionsniveaus, solange nicht viele Einzelfälle mit einem differenzierten Fallkonzept vergleichend im Therapieverlauf betrachtet werden. Zum Zweiten besteht das damit zusammenhängende Risiko, dass allgemeine Interventionen, die sich nicht auf eine spezifische Störung beziehen (zum Beispiel allgemeine «Regeln» für eine «gute» therapeutische Beziehung), als generell wirksam überschätzt werden. Zum Beispiel kann man irrtümlicherweise annehmen, dass Unterstützung (supportive Bestätigung) immer wirkt. Was eine Person jedoch als unterstützend erlebt, kann sich erheblich unterscheiden (so kann sich z. B. ein sehr distanzierter Patient durch emotionale Zuwendung bedroht fühlen), sodass die real erlebte Unterstützung durch ein Gegenüber untrennbar mit dem stimmigen Verständnis des Patienten verbunden ist. Es gibt keine allgemein wirksame Beziehung, sondern sie sollte spezifisch gestaltet werden! In der Diskussion über die therapeutische Beziehung sollte man daher drei Abstraktionsstufen unterscheiden:
1. Ebene der Wirkfaktoren: Allgemeine Bedeutung und Bewertung der Beziehung (Ebene des Verfahrens und der therapeutischen Grundhaltung über die gesamte Therapie bzw. über viele Therapieverläufe)
2. Interaktionelle Makroebene: Differenzielle Analyse verschiedener Beziehungsmuster, in die sowohl die spezifischen Erwartungen des Patienten als auch das Verhalten des Therapeuten einfließen (Beziehungsmuster über mehrere/viele Sitzungen); auf diese Ebene beziehen sich auch die motivationale Beziehungs- und Schemaanalyse nach Grawe, die differenziellen kommunikativen Teufelskreise nach Schultz von Thun und die motivorientierte Beziehungsgestaltung nach Caspar (s. Kap. 2.3/12.2)
3. Interaktionelle Mikroebene: Analyse konkreter kurzer Interaktionssequenzen mit einer Beschreibung der Gesprächsführung (Sekunden bis Minuten) (s. Kap. 6.1/6.2.4/12.1)
In der allgemeinen Prozessforschung wird in der Regel nur die höchste Abstraktionsebene der Beziehung betrachtet, obwohl sie eigentlich erst im Zusammenhang mit der Makro- und der Mikroebene ihre Wirkung entfaltet. Sie müsste daher ergänzt werden durch eine Forschung zu differenziellen Beziehungsmustern und zu narrativen Mikroprozessen förderlicher bzw. weniger förderlicher Interventionen in der Gesprächsführung des Therapeuten.
Das Interaktionsverhalten des Therapeuten (auch diskutiert als Einfluss der Persönlichkeit des Therapeuten) hat erheblichen Einfluss auf den Therapieerfolg: So haben erfolgreiche Therapeuten einen bis zu zehnfach höheren Wirkungsgrad als nicht erfolgreiche Therapeuten (unabhängig von Ausbildung, Verfahren und Geschlecht) (Okiishi et al. 2006). Setzt man die persönlichkeitsbedingten zehnfachen Wirkungsunterschiede in Beziehung zu dem Effektstärkenunterschied verschiedener Psychotherapieverfahren oder zum Wirkungszuwachs, der von der KVT zur Schematherapie erreicht wurde, dann müsste es mit Blick auf den Patientennutzen am sinnvollsten sein, sich professionell mit der Frage von gelingender Interaktion und hilfreichen Persönlichkeitsmerkmalen von Therapeuten zu beschäftigen! Dafür gibt es gegenwärtig jedoch kaum empirische Erkenntnisse, da das technokratische Verständnis von Psychotherapie auch den Therapeuten als Persönlichkeit unsichtbar gemacht hat und ihn nur noch auf seine technische Kompetenz reduziert. Die japanische Studie mit 71 Therapeuten und über 5000 Patienten (Okiishi et al. 2006) ist noch eine große Ausnahme. Von daher erscheint es notwendig, die Frage der Wirksamkeit auch auf der Makro- und der Mikroebene zu beantworten. Ihre Wirkung erhalten allgemeine Faktoren (Beziehungsgestaltung, Problembezogenheit der Therapie, Stimmigkeit zwischen Diagnostik und Therapieplanung) erst dann, wenn sie auf den Patienten abgestimmt werden; und hier geht es nicht um Störungen, sondern um die Ziele und Bedürfnisse des Patienten.
Ein allgemeineres Verständnis von Psychotherapie erfordert auch die Einbeziehung der psychologischen Grundlagenforschung. Es kann nicht zielführend sein, dass für jede Störung ein eigenes Funktionsmodell der Störungsentstehung oder ein Psychotherapieverfahren entwickelt wird ohne Bezugnahme auf Referenzmodelle der Emotionspsychologie, Motivationspsychologie, Persönlichkeitspsychologie und vor allem auch der Entwicklungspsychologie, in denen diese Teilbereiche zusammenfließen, und ohne eine fundierte transdiagnostische Perspektive. Letzteres scheint ein Anliegen der sogenannten dritten Welle in der Verhaltenstherapie zu sein.
Strauss und Wittmann (2011) fordern daher in einer Linie mit Grawe (2005), Caspar et al. (2008) und Fiedler (2012), die Dichotomie aus störungsspezifischen und allgemeinen Faktoren zu überwinden und möglichst noch durch andere Forschungsstrategien zu bereichern (zum Beispiel Einzelfallforschung und Interviewmethoden). Herpertz, Caspar & Mundt (2008) stellen fest, dass das «Pendel in den letzten Jahren von einer zu allgemeinen Orientierung in Richtung auf eine zu störungsspezifische Ausrichtung ausgeschlagen» hat. Insofern muss man den Begriff «Fehlentwicklung» auch relativieren: Diese Entwicklungen haben alle im Ansatz ihre Berechtigung, werden dann nur leider in der Folgezeit verabsolutiert und übertrieben, sodass dies weitere Korrekturen herausfordert (Diskussion zur dritten Welle der VT: Kap. 5.3). Wampold (2011) fordert sogar die effektspezifische Forschungsstrategie ganz aufzugeben und sich stattdessen wieder vermehrt der Erforschung therapeutischer Prozesse und der Optimierung komplexer Behandlungsprozesse zu widmen!
1.6 Konsequenz: die Relation von Beziehung und Behandlungstechnik
In der Abwägung beider Forschungsrichtungen (Effekt- und Prozessforschung) sollte man anerkennen, dass sich in Metaanalysen der Prozessforschung grundsätzlich die therapeutische Beziehung als ausschlaggebender für den Erfolg erweist als eine einzelne Behandlungstechnik. Daher hat in der praktischen Konsequenz die Reflexion und Gestaltung der Beziehung (zunächst auf der Makroebene) immer Vorrang vor der Auseinandersetzung mit einer weiterführenden Interventionstechnik. Sowohl die Beziehung als auch die Technik haben sowohl störungsspezifische wie störungsunspezifische Seiten. Die Erkenntnisse der Prozessforschung werden aber bis heute nicht angemessen umgesetzt in transdiagnostische Konzepte.
Auf der Ebene der Gesprächsführung (Mikroebene) verschmelzen Aspekte der Beziehung und der Interventionstechnik in der Frage «Worauf richte bzw. lenke ich als Therapeut primär die Aufmerksamkeit im Gespräch, um in eine für den Patienten hilfreiche therapeutische Beziehung zu kommen, ihm einen für ihn stimmigen Blick auf sich, seine Beziehungen und seine Symptomatik zu ermöglichen und beides sekundär durch gezielte Anwendung von Methoden zu unterstützen?». Anders formuliert: Die Gesprächsführung ist die Basis, auf der es zu einer konstruktiv erlebten Beziehung und zur Anwendung von Interventionstechniken kommen kann.
Durch erhebliche Wirkungsunterschiede in Abhängigkeit von der Persönlichkeit des Therapeuten und seiner Gesprächsführung wird auch der Wert der reinen Methodenevidenz relativiert, aber selbstverständlich nicht überflüssig. Dies führt zu einer Definition von Psychotherapie als professioneller Kommunikation mit darauf aufbauenden (!) Behandlungsmethoden im Rahmen eines (hinsichtlich Zeit, Raum und Rahmen sehr unterschiedlichen) Behandlungsprozesses, der unterschiedlich komplexe Ziele verfolgen kann (in Anlehnung an die Psychotherapiedefinition von Hans Strotzka). Damit wäre sowohl eine technische Reduktion verhindert als auch eine Reduktion auf das Gespräch oder «bloßes Reden».
Hinsichtlich des Patienten und seiner persönlichen und symptomatischen Beeinträchtigungen wäre es sinnvoll, störungsspezifische Erkenntnisse mit Erkenntnissen über allgemeine psychische Funktionen (Selbstkonzept, Persönlichkeit, Selbstwert, Konflikte, Emotionsregulation, Bindungsentwicklung mit den einschlägigen Schutz- und Risikofaktoren, Beziehungsmuster) zu verknüpfen. Diesen Weg gehen Herpertz, Caspar & Mundt (2008) mit dem Konzept der «störungsorientierten Psychotherapie». Hier werden z. T. vergleichbar zum «integrativen Lehrbuch» (Praxis der Psychotherapie, Senf & Broda 2012) synoptisch viele Erkenntnisse aus allen Teilbereichen (allgemeine Aspekte, psychische Grundfunktionen, Störungen, Settingaspekte und Rahmenbedingungen) zusammengestellt. Dies geschieht jedoch noch ohne eine echte theoretische Verdichtung und Integration.
Fazit: Auch allgemeine psychotherapeutische Bedingungen müssen spezifisch mit dem Patienten im Hinblick auf seine Persönlichkeit und Symptomatik realisiert werden. Dies geht nicht ohne ein umfassendes ätiologisches Verständnis mit einer Fundierung in der Grundlagenpsychologie. Und in der Anwendung erfordert dies ein individuelles Fallkonzept mit einer schlüssigen Gesamtbehandlungsstrategie, die sich durch ein durchgängiges Verständnis von Beziehungsgestaltung und Gesprächsführung als permanent wirksamer Intervention auszeichnet und dies mit transdiagnostischen (emotionalen) und störungsspezifischen Interventionen verknüpft.
Konsequenzen für die Praxis
Die Prioritäten in der Erforschung und Gestaltung wirksamer Therapie sollten sich an dem Grad des Nutzens für den Patienten orientieren. Die Beziehung sollte sowohl auf der Makroebene (Beziehungsmuster) als auch auf der Mikroebene (Gesprächsführung) gestaltet und verstanden werden. Hier liegt der Haupteinfluss auf das Gelingen einer Therapie, dem gegenüber der Einfluss des therap. Verfahrens (VT, GT, PA, TP) an zweiter Stelle nachgeordnet ist. In der Bedeutung folgt zum Dritten das Verständnis der Funktionalität der Störung im Kontext transdiagnostischer Bedingungen (Selbstkonzept, Persönlichkeit, Selbstwert, Konflikte, Emotionsregulation, Bindungsentwicklung, Risikofaktoren, Beziehungsmuster). Und darauf folgt an vierter Stelle das Verständnis der Eigendynamik störungsspezifischer Bedingungen, die heute jedoch zu Unrecht in Wissenschaft, Ausbildung und Praxis sehr viel Raum einnehmen.
1.7 Das gegenwärtige Wissenschaftsverständnis: Eine kritische Analyse
Vorbemerkung: Wir haben es neben den bereits erwähnten Verdiensten mit drei Fehlentwicklungen zu tun:
1. Die komplexe Verarbeitung emotionaler Belastungen in Verbindung mit körperlichen, emotionalen, kognitiven, interpersonellen und sozioökonomischen Aspekten wird auf Kognitionen reduziert (Kognitivismus).
2. Der langfristige und entwicklungspsychologische Hintergrund von Störungen wird auf seine «symptomatische Endstrecke» – also die aktuellen Symptome – reduziert (Symptomfixierung).
3. Die komplexe Wirkung von Psychotherapie auf der Mikro- und der Makroebene hinsichtlich parallel wirksamer Wirkfaktoren und hinsichtlich der großen emotionalen Herausforderungen an die Gesprächsführung und Beziehungsgestaltung der Therapeuten wird auf die Anwendung von Methoden reduziert (Technikfixierung).
Durch diese Fehlentwicklungen droht die Verhaltenstherapie zum Teil eines übergeordneten Problems zu werden: eines sich durch alle Lebensbereiche ziehenden industriellen Optimierungszwangs. Die Grundregel dieser Optimierung: Man versucht aus allem das jeweils Wichtigste oder Wirksamste zu isolieren, um möglichst schnell und günstig ans Ziel zu kommen, und unterschätzt dabei den vermeintlich unspezifischen Nährboden, der wichtiger ist als die technischen Details. Insofern droht der Verhaltenstherapie das, was Karl Kraus einmal vor 100 Jahren über die Psychoanalyse gesagt hat: Sie ist möglicherweise Teil der Krankheit, die zu behandeln sie vorgibt. Diese zugegebenermaßen überspitzte Formulierung kann wachrütteln von einem Zeitgeist des Optimierungszwangs und der Effizienz, den man meist nur schwer überwinden kann und der immer auch seine berechtigten Ursprünge hatte.
Der gegenwärtige wissenschaftliche Mainstream scheint diese Fehlentwicklungen weder zu bemerken noch beseitigen zu wollen, sondern erhebt diese sogar zum Goldstandard. Das Gemeinsame dieser Fehlentwicklungen sind die Reduktionismen sowie die verdeckte und manchmal auch offene Ökonomisierung, die entgegen anderen Evidenzen aus den Grundlagenwissenschaften und aus der Therapieprozessforschung offensiv verteidigt werden gegen jede Art der Kritik (Kap. 5.2). In der sogenannten zweiten Welle der Verhaltenstherapie kann man einen Bruch mit den Grundlagenwissenschaften ausmachen (zur Reflexion der Entwicklung der Verhaltenstherapie und ihrer Auswirkung s. Kap. 5), in dessen Folge die Bewährung einzelner Methoden wichtiger wurde als ihre Begründung.
Das Selbstverständnis dieser Entwicklung kann gut durch den Satz eines kognitiven Therapieforschers wiedergegeben werden, wonach der Patient «ein Recht darauf hat, dass die für seine Störung wirksamsten Methoden zum Einsatz kommen». Der Patient hat also ein Recht darauf, auf Kognitionen und Symptome reduziert zu werden – und auf die Anwendung von Technik? Der biomedizinische Reduktionismus wird so durch psychologische Reduktionismen konterkariert; ein Teilerfolg aus psychologischer Sicht, der durchaus die Etablierung der Psychotherapie im Gesundheitswesen befördert hat. Es bedarf jedoch gegenüber dem Patienten einer deutlichen Korrektur.1 Durch die Linse der Effektforschung betrachtet, könnte man auch sagen, dass der Mainstream zu 17 % brauchbare Konzepte liefert. Anders formuliert: Die Konzepte sind in der Praxis überwiegend unbrauchbar und eben nicht auf den Patienten ausgerichtet. Was sind die Gründe für eine solche Entwicklung?
Versuch einer Beschreibung: Viele Wissenschaftler erliegen – auch bedingt durch eigene Interessen an einer akademischen Karriere und der Wertschätzung der Community – der Versuchung, Psychologie ausschließlich als Generierung von empirischen Einzelbefunden zu betreiben und die gängigen Reduktionismen sowohl der Begriffe als auch der Forschungsstrategien kritiklos zu übernehmen (Daten werden wichtiger als Konzepte). Die Verknüpfung vieler Einzelbefunde und Detailtheorien zu übergeordneten Theorien und Modellen – wie sie Grawe zuletzt in einer «radikalen Abwendung vom Denken in Therapiemethoden» gefordert hat (2005) – wird aufgrund ihres heuristischen Charakters auf der Modellebene zu Unrecht als spekulativ angesehen und nicht als notwendige terminologische Begründungsarbeit systematisch betrieben. Dagegen wird jede kontrollierte randomisierte Doppelblindstudie (RCT/EST) als hohe Schule der Wissenschaft angesehen bei gleichzeitiger Verarmung der Forschungsmethoden (z. B. Vernachlässigung von Interviewtechniken, systematischer Beobachtung, Einzelfallanalysen etc.). Die Kritik an dieser methodologischen Einengung des «Empirismus» wurde z. B. von Habermas als «positivistisch halbierter Rationalismus» in das wissenschaftstheoretische Denken eingebracht. Vor 30 Jahren hätte man noch von einem Primat der Geisteswissenschaft gesprochen, denn Daten müssen immer interpretiert werden. Dies ist aber heute nicht mehr angemessen, da sich empirisch begründete Modellbildung nicht mit hermeneutischer Interpretation gleichsetzen lässt; genauso wenig wie die Formulierung heuristischer Modelle in der Physik etwas mit Hermeneutik zu tun hat. Es geht stattdessen um eine konsistente konstruktivistische Theorienentwicklung von der einzelnen Theorie bis in die Ebene methodologischer Modelle. Dazu Habermas (2004): «Der methodologische Dualismus zwischen Teilnehmern und Beobachtern darf nicht zu einem Dualismus von Geist und Natur ontologisiert werden» (S. 878): Wenn der Mensch also Geist und Natur ist, dann sollte er auch sowohl aus der Subjekt- wie aus der Objektperspektive verstanden und erforscht werden. Dies widerspricht einer Trennung von psychoanalytischer und verhaltenstherapeutischer Empirie in der Psychotherapie ebenso wie einer Trennung zwischen Leib und Seele in der Medizin.
Grawe (1992) hat die «gegenstandskonstituierende Funktion» der Wissenschaften (Theorien entwickeln und prüfen, Begriffe präzisieren und übergeordnete Modelle entwickeln) von der «Evaluationsfunktion» (Bewährung verschiedener Konzepte in der Anwendung prüfen) unterschieden. Ebenso unterschied er – im Nachgang zu A. E. Meyer (1990) – eine Phase der Psychotherapieforschung, die durch eine präzise Beschreibung von Interventionen an Einzelfällen durch einflussreiche Kliniker und Forscher gekennzeichnet ist (‹Eminenzbasierung›), von einer Phase, die durch Wirksamkeitsbelege auch unabhängig von Schulengründern oder Methodenentwicklern gekennzeichnet ist («Evidenzbasierung»). Die heutige Psychotherapieforschung definiert sich überwiegend aus der Wirkung einzelner Methoden und zieht sich auf Evidenzbasierung einzelner Methoden und auf die Evaluationsfunktion zurück. Dabei setzt man sich sogar über die eigene Grundlagenforschung hinweg und klammert u. a. die entwicklungspsychologische Dimension von Störungen konsequent aus.
Der wissenschaftliche Mainstream meidet eine Arbeit an übergeordneten transdiagnostischen Modellen, weil sich die erforderliche Komplexität individuell passender Behandlungsstrategien mit dem auf die Effektforschung reduzierten Evidenzbegriff nicht abbilden lässt, und widmet sich lieber Metaanalysen in Verbindung mit einer Konzentration auf vermeintliche «empirische Evidenz». Hier hat es rein rechnerisch hervorragende Entwicklungen gegeben: z. B. die Entwicklung der metaanalytischen Berechnung von Effekten (z. B. Smith & Glass 1977) und die Vernetzung zahlreicher Befunde als Vorlage für evidenzbasierte Entscheidungen (Cochrane Collaboration). Eine theoretische Verdichtung, Begründung und Weiterentwicklung kann jedoch durch diese Entwicklungen nicht ersetzt werden und ebenso wenig eine notwendige Reflexion auf den Anwendungskontext («die Praxis»).
Zur Reduktion des gegenwärtigen wissenschaftlichen Spielraums gehört auch die Ausblendung des breiten Spektrums sozialwissenschaftlicher Methoden – wie sie zum Beispiel von Roth & Holling (1993) dargestellt werden2 – und die Ausblendung der Gesellschaftswissenschaften einschließlich der Erforschung krank machender kollektiver Lebensbedingungen (als nicht kognitive Realität faktischer Lebensbedingungen), die ebenfalls ursprünglich in den Kanon psychologischer Forschung einbezogen wurde und heute dem Kognitivismus geopfert wird (Dogma: «Es gibt keine kollektive Bedeutung oder Belastungsfaktoren, es ist alles eine Frage individueller kognitiver Verarbeitung»). Eine Psychotherapieforschung, die gesellschaftliche und ökonomische Zusammenhänge nicht mehr reflektiert, sondern alles auf Kognition, Symptome und Methoden reduziert, wird selbst zum Teil einer zahlenfixierten und kurzfristig denkenden Ökonomisierung und einer scheintransparenten Sozialtechnologie und verliert die selbstreflexive Distanz. An der Überschätzung von Erfolgsraten, der Dominanz der RCT-Forschung und den daraus resultierenden Zwängen für Kliniken und Therapeuten kann man dies gut ablesen. Dazu Greenberg (2011): «Therapieschulen basieren mehr auf Politik, Wirtschaft und Macht als auf Wissen».
Liegen Eminenzbasierung und Evidenzbasierung vielleicht doch nicht so weit auseinander? Diesen Eindruck kann man auch angesichts der Tatsache gewinnen, dass die Forschung zur kognitiven Therapie auf der Basis der beckschen Kognitionstheorie nachweislich mit einer Rezeptionsverweigerung früherer und aktueller Evidenzen verbunden ist, unzureichend in der Grundlagenforschung fundiert ist und nicht wirklich weiterentwickelt wird mit Hinweis auf die hervorragende Evidenz der Wirkung der Kognitiven Therapie (s. Kap. 5.2). Die Flut der Evidenzen macht anscheinend die Begründung überflüssig3. Auf diese Weise ist Beck selber zu einer Eminenz geworden, in dessen Folge nur noch die zum kognitiven Ansatz passenden Evidenzen zur Kenntnis genommen und geschaffen werden. Das zeigt ein weiteres Problem in der Wissenschaft: nämlich die Bildung sog. scientific communities, die sich selbst zur Referenz ihrer Urteilsbildung machen. Was nicht im eigenen «Club» stattfindet, wird entweder ignoriert oder in verkürzender Weise rezipiert. Zum Teil gibt es sogar in einzelnen Spezialgebieten mehrere communities, die sich wechselseitig nicht zur Kenntnis nehmen (s. z. B. Kessler 2014). Es geht nicht mehr um die Bildung von Wissen, sondern um die Bündelung von Interessensgruppen.
Dadurch wird die zentrale Aufgabe nicht erfüllt, die Grawe (1992) für die Psychotherapieforschung formuliert hat und die von Caspar4 (2010) als «Leitbild» umrissen und präzisiert wird: sich aller wissenschaftlichen Quellen unabhängig von der Ausrichtung zu bedienen (Prozessforschungsphase) und dazu auch in Zitaten zu stehen, anstatt das Rad immer wieder neu zu erfinden, und sich an der Erarbeitung übergeordneter Modelle der Ätiologie und Intervention zu beteiligen zum Nutzen der Patienten. Dabei sollte man auch die empirisch forschende Psychoanalyse oder die Gesprächstherapie einbeziehen, die sich teilweise genau mit den Fragen beschäftigen, die von Verhaltenstherapeuten ignoriert oder zumindest vernachlässigt werden: Dies sind vor allem die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und -pathologie, aber auch der Neurobiologie und Emotionspsychologie bis hin zur Erforschung narrativer Mikroprozesse. Die psychoanalytische Therapieforschung hatte lange Zeit den umgekehrten Fehler gemacht und sich überwiegend mit theoretischer Modellbildung beschäftigt, die lediglich hermeneutisch plausibel waren und primär aus der Behandlungswirklichkeit von Einzelfällen abgeleitet wurden. Die empirische Überprüfung an größeren Patientengruppen oder die Validierung an der nicht klinischen Grundlagenforschung wurde vernachlässigt. Dabei kam man zu Erkenntnissen, die heute noch unterschrieben werden können, und vielen anderen Konzepten, die aufgegeben werden mussten (Kap.6.2).
Fiedler (2012) hat sich (wie viele andere Hochschullehrer) in seiner Vision von einer «Psychotherapie der Zukunft» von übergeordneter Modellentwicklung abgewandt (»Der große Trugschluss bisherigen Therapieschuldenkens lag in der Illusion, den psychisch gestörten Menschen in seiner Ganzheitlichkeit erfassen zu wollen», S. 160) hin zu einem Erhalt der Vielfalt verschiedener Therapiestrategien und einer Ausweitung der Forschungsstrategien (zum Beispiel Einbeziehung der Einzelfallforschung). So notwendig es auch ist, das enge Empirieverständnis des aktuellen verhaltenstherapeutischen Mainstreams auszuweiten, so fragwürdig wäre ein Verzicht auf die Entwicklung übergeordneter Modelle der menschlichen Entwicklung und der Ätiologie von Störungen und ein Verzicht darauf, den Patienten zumindest in der Gesamtheit der für die Behandlung relevanten Aspekte als Ganzes wahrzunehmen, wie es im gleichen Band zu Recht von Bastine (2012) eingefordert wird.
Die Verknüpfung primär-langfristig wirksamer Belastungsfaktoren, sekundärer Persönlichkeitsmuster und symptomatischer Störungsmuster und eine differenziertere Betrachtung der Interventionen gelingt möglicherweise besser im Rahmen der von Fiedler (2012) oder auch von Fonagy & Target (2003) vorgeschlagenen «komparativen Kasuistik». Fiedler (2012) schlägt auch eine Ergänzung der aktuellen Symptomorientierung durch eine «Phänomenorientierung» vor. Zu Recht fordert Fiedler (2012) ein Ende eines «omnipotenten Schulendenkens». Zunehmender Dogmatismus und auch die Neigung, sich kognitivistisch von der Lebensrealität von Patienten zu entfernen und primäre Belastungen auf die Frage des «richtigen» Denkens zu reduzieren, scheint auch ein Risiko fortgeschrittener Professionalisierung zu sein, das auch die Psychoanalyse mit der kognitiven Verkürzung auf das Primat des Denkens durch die Deutung kennt (s. Kap. 3.2 zur Traumaforschung und 6.2 zur Strukturtheorie). Die Zukunft der Psychotherapie liegt nicht nur in einer Verbesserung der Methoden und einer Ausweitung der Forschungsstrategien, sondern auch in einer Revision reduktionistischer Begrifflichkeiten. Dies kann aber nur gelingen, wenn das Interesse an übergeordneter Modellentwicklung als essenziell notwendig erkannt wird. Erst wenn die therapeutische Arbeit angemessen in einer nicht technischen Weise begriffen und dargestellt werden kann, eröffnet sich ein valider Blick für die realen Herausforderungen psychotherapeutischer Arbeit und die Möglichkeiten einer sprechenden Medizin.
Hier würde man sich als Praktiker manchmal in der Binnenkommunikation mit Wissenschaftlern weniger ein überzogen selbstbewusstes als vielmehr selbstkritisches Auftreten mit Reflexion auf die Grenzen des eigenen Zugangs wünschen. Eine vorgetäuschte Bescheidenheit («Eigentlich wissen wir immer noch nichts Genaues, und deshalb brauchen wir dringend weitere Forschungsgelder») ist da genauso wenig konstruktiv wie ein «empirischer Imperialismus» (Lampropoulos et al. 2002), der sich der Weiterentwicklung grundlegender Konzepte widersetzt (s. hierzu auch Roediger & Brehm 2013) und damit der Abspaltung neuer Konzepte und Verfahren (z. B. der Schematherapie) und der Schulenbildung Vorschub leistet. Etablierte Verfahrensvertreter neigen dazu, sich gegen Weiterentwicklungen zu sträuben und hochmütig gegenüber «der» Praxis und anderen Verfahren zu werden (z. B. Lilienfeld et al 2013). Aber wie wir alle wissen oder zumindest ahnen: Hochmut kommt vor dem Fall. Auch dies können wir von der Psychoanalyse lernen5. Manchmal dauert es allerdings sehr lange, wie man an der mit Milliarden Dollar gesponserten biomedizinischen Renaissance in den USA erkennen kann (Kap.1.1).