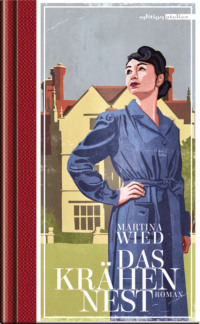Kitabı oku: «Das Krähennest», sayfa 4
5
Es gibt in der Télème-Abtei eine Bibliothek, die kennenswerte Bücher enthält, und ein Lesezimmer mit mehreren Tageszeitungen und Zeitschriften, auch französischen. »Hier ist«, erläutert Florizel, der Madeleine zu seinem Schützling erkoren hat und dafür sorgen möchte, daß sie sich im »Krähennest« auskennen lernt, »›der neuneue Staatsmann‹, hier ›Zeizeizeit uund Gegezeizeiten‹, dort haben Sie den ›Zuzuschauer‹, hier den ›Ausblick‹, und dadada haben wiwir ja auch ›Lala France lilibre‹ und ›Fontaine‹; dadas wiwird Sie dodoch besonsonders ininteressissieren, Madame! Dada wiwill ich ninicht längerger stöören.«
Madeleine ist dem liebenswürdigen Stotterer dankbar dafür, daß er sie nun allein läßt. Sie hat nämlich, flüchtig das Titelblatt des »Ausblicks« streifend, dort einen Aufsatz angekündigt gefunden, dessen Überschrift peinliche Erwartungen in ihr erregt. »Die Lust am Verrat.« Auf wen geht das nun? Oh, gewiß dürfte man damit auf viele hinzielen, zumal, wenn es sich, das kann man vermuten, auf Frankreich bezieht. Ist denn in Madeleines Vaterland jetzt nicht Verrat von Staats wegen entschuldigt, ermutigt, gefördert, gebilligt? Ein schmerzhaftes Zusammenziehen des Herzmuskels aber hat ihr schon vorausgesagt, wer es wohl ist, der hier angegriffen wird. Der einzige nicht nur, mit dessen Gefolgschaft die Eroberer sich prahlerisch brüsten – der einzige auch, dessen Verlust ihre wertvollsten, ihre edelsten Widersacher schmerzt. Freilich, Madeleine ist von ihrem Vorgefühl nicht getäuscht worden, hier steht’s: Ernest Mathieu Le Sieutre.
Das ist freilich einer, der, wie so viele seiner Berufsgenossen, gleich nach dem Durchbruch bei Sedan in die Schweiz, nach England, nach Amerika hätte entweichen können, der heute in Algier an der Seite des Generals willkommen wäre. Er aber hat es vorgezogen, in Frankreich zu bleiben und den Feinden zu dienen. Nun ist er in aller Munde, sein Name ist in allen öffentlichen Reden, auf und zwischen den Zeilen aller Blätter, in hundert Anspielungen zu finden: eine Eroberung, ein Popanz, ein Beispiel – nachahmenswert oder abschreckend, je nachdem. Er ist, auf welcher Seite man auch stehen, wohin man sich kehren und wenden mag, ein Wahrzeichen, ein Wegweiser, ein Warnungssignal.
»Daß wir diesen bedeutenden Mann«, stand in einem Aufsatz der »Deutsch-Französischen Rundschau« – die auf ganz geheimnisvolle Art Madeleine in die Hände gespielt worden war –, »in unserer Mitte haben, gilt uns mehr als ein Dutzend erstürmter Festungen. Es ist ein moralischer Gewinn von kaum abzuschätzendem Wert. Wenn ein hoher Mensch, wie Le Sieutre, unsere neue Ordnung als gerecht und erstrebenswürdig anerkennt, wenn er sich willig – ja hingerissen bereit zeigt, uns sein Frankreich, worin er tiefer wurzelt als irgendeiner seiner ›confrères‹, nach Landschaft, Volkstum, Überlieferung und lebendig fortwirkenden Kräften, nach seiner staatlichen und persönlichen Eigenart genauer kennenzulehren, mehr, wenn er uns die geistigen – und die ungeistigen Voraussetzungen enthüllt, welche die politische Haltung seiner Volksgenossen hintergründen: jener Widerspenstigen sowohl, die jetzt im Busch und im Dschungel der Großstädte heimtückisch gegen uns wühlen, wie solcher, die sich stillschweigend von uns und ihren besonneneren Mitbürgern abgekehrt haben, weil ihre überlebte Denkungsart mit unserer frohen Botschaft nichts anzufangen weiß, der schwankenden auch, welchen Le Sieutres Beispiel zur Entscheidung verhelfen mag, und jener Willkommenen endlich, die weitblickend und großherzig, sich ihm und uns angeschlossen haben – ist das ein Erfolg, der kaum genug gewürdigt werden kann. Was der vielbewunderte Knut Hamsun, Freund und Weggenosse des edlen, schmählich verleumdeten Präsidenten Quisling, in Norwegen für uns geleistet hat, wird Le Sieutre für uns in Frankreich ausrichten und, seiner viel jüngeren Kraft und der größeren Bedeutung seines Landes und Volkes entsprechend, noch weit mehr. Wollte der Feindbund doch auch seinen Namen als Schimpf gebrauchen, damit wir ihn zum weithin hallenden Ehrennamen wandelten, als den des ersten, hervorragendsten und wertvollsten Vorkämpfers für die deutsch-französische Verständigung.«
Folgen Zitate aus Le Sieutres Schriften und seine ausführliche literarische Würdigung durch einen berühmten deutschen Romanisten, der auf einem wissenschaftlichen Kongreß in Rom Madeleines Tischnachbar war, und den sie jetzt weit eher in Buenos Aires, Rio de Janeiro oder Lissabon vermutet hätte als in Paris.
Wie seltsam ist es, einen, den man so tief – so innerlich kennt, nun äußerlich und oberflächlich von Fremden betrachtet zu finden! Jemanden, der von seinen Jünglingsjahren an in der Öffentlichkeit gestanden ist, bewundert, bemäkelt, angegriffen oder verteidigt, seit langem aber, ob freundlich, ob feindselig, stets aus ehrfürchtigem Abstand beurteilt, entweder aus innerer Verwandtschaft heraus, mit verständnisvollem Eingehen auf seine Eigenart, oder aus bloßem technischen Berufsgeschick – immer aber aus dem Wunsch, sich seines Wesens zu tieferer Erkenntnis zu bemächtigen. Einen solchen nun als Schmuckgegenstand und erwünschtes Beutestück dargestellt zu sehen –, welche Erschütterung! Wie erträgt er’s nur? Durchschaut er denn nicht, daß alle Bewunderung, alles Entgegenkommen, das ihm dargebracht wird, nicht seinem Wert, sondern seinem politischen Nutzwert gilt?
Wer kennt besser als Madeleine alle klugen und unklugen, alle würdigen und unwürdigen Beweggründe, die den Freund zur Abkehr von allem, was so lang ihrer beider ererbtes und aus eigenem anerkanntes Gebot war, antrieben?
»Nicht einer von jenen, die heute als Patrioten und Märtyrer gepriesen werden – nicht einer von ihnen«, hatte Ernest mit einer Miene, worin Entschuldigung, Herausforderung und knabenhafter Trotz zugleich lagen, gesagt, »hat für Frankreich geleistet, was ich werde leisten können. Es ist freilich leichter, sich in die Brust zu werfen: ›Ich will mich nicht beugen, will kein Jota von meiner persönlichen Unabhängigkeit preisgeben!‹, als offenen Auges den Verlust solcher Unabhängigkeit und überdies Verleumdung, Besudelung, üble Nachrede der abgefallenen alten und die mißtrauisch überwachende Oberhoheit der neuen Kameraden auf sich zu nehmen: um welches Zieles willen aber? Dünkt es dich so wenig, Unzählige vor dem Konzentrationslager, vor Gefängnis, wirtschaftlichem Zusammenbruch, ja vor Hinrichtung zu bewahren, und ist nicht nützlicher, wer zu solchem Zweck Macht zu gewinnen trachtet, als solche, die selbstsüchtig bloß die eigene Haut retten wollen? Ich mache mich auf die schmählichsten Angriffe gefaßt, geistige und tätliche, auf metaphorische Steine und höchst wirkliche Kotballen; ich weiß, man wird weder hier noch dort glimpflich mit mir verfahren, denn was die Deutschen angeht, die heute wahrlich mehr gewitzt als treuherzig sind, bedarf’s wohl größerer Schlauheit, bedarf’s einer ausgebildeteren Verstellungskunst, als der kümmerlichen, die mir zu Gebot steht, um nicht da und dort bei ihnen anzustoßen! Es sollte mich nicht wundern, wenn ich sogar, eine Bewährungsfrist lang, unter Aufsicht der Geheimen Staatspolizei gestellt würde, aber selbst das – das alles ist besser, als ein heimatloser Flüchtling zu sein und das entsittlichende Leben des Exils zu führen. Entwurzelt, ich, der doch nur wie eine unserer normannischen Eichen aus diesem Boden seine Kraft saugt! Losgelöst würde ich schnell eingehen, verdorren, nutzlos vergreisen.«
»Man kann auch«, hatte Madeleine widersprochen, »sein Vaterland verlieren, wenn man darin bleibt, und man kann es mit sich nehmen, überallhin.«
– Was – hatte Madeleine sich nach diesem Gespräch gefragt – steckt, außer dem Einbekannten, noch hinter seinem Entschluß? Stets hat er mir nur seine beleuchtete Hemisphäre zugekehrt, die auch anderen sichtbare, was aber geht auf der für alle dunklen vor sich? Etwas vollzieht sich dort, was er sogar vor mir, vor sich selbst vielleicht, verheimlicht, nie werde ich erfahren, was es ist, denn ich hüte mich, nachzuforschen: aus Achtung vor ihm, aus Angst für mich selbst. Wie, wenn es nicht bloß eine erhabene, überpersönliche Aufgabe wäre, nicht bloß Heimatliebe, was ihn zurückhält? Dunkle Gewalten sind da am Werk, anderes noch gibt’s für ihn. Ehrgeiz? Sicherlich, aber nicht von der gemeinen Art. Niemals hat er ihm die Bahn freigegeben, immer hat er ihn durch andere Kräfte gebändigt und gebunden: da war die Überlieferung seines Hauses, seine religiöse Überzeugung, sein Wille zur Demut (wenn auch nicht Demut selbst), seine philosophische Weltanschauung, sein Abscheu vor der Berührung mit rohem Wettstreit, und – die stärkste unter allen seinen Bindungen: Ich. Hat er mich nicht sein Gewissen genannt? Jetzt aber? Wie – wenn alle diese Hemmungen nun wegfielen? Wenn er, während des allgemeinen Aufruhrs, zeitweilig im Unsichtigen verschwinden dürfte? Wenn er nicht länger zu jeder Stunde, immer im Rampenlicht, eine ideale Stellung, und eine sehr wirkliche zugleich, seinen geistigen Rang, seine nationale Bedeutung und alles, wofür er sonst steht, verteidigen müßte? Da er nun nicht mehr unter dem wachsamen Blick der Freunde – und der-Feinde –, der ihm sich seine Blöße zu geben, nicht erlaubte – nicht mehr in der Nähe solcher lebt, die jede Linie in seinem Gesicht, jede seiner Gebärden, jeden Tonfall seine Stimme nur allzu genau kannten, vor denen sogar er – dessen Weg immer Umweg und Geheimnis ist – sich nicht völlig verbergen konnte? Den Fremden hingegen mag er sich darstellen als eine von ihm selbst erdichtete Gestalt, die auch unter ihrer Bewachung sich in Rauch auflösen – im Namenlosen sich verflüchtigen könnte.
Ah – wie einsam muß er sich jetzt, trotz allem, fühlen! Das »entsittlichende Leben des Exils« – ja, bist du denn nicht im Exil, wo der Fremde gebietet? Wenn er in deiner Stadt, deiner Straße, deinem Haus, deiner Stube allgegenwärtig ist, wenn er ungebeten, unangesagt zu jeder Tages- und Nachtstunde bei dir eintreten darf? »Die meisten Fehlgriffe und die meisten Verbrechen«, hast du gesagt, Ernest, »werden aus Mangel an Vorstellungskraft begangen.« Wie steht es nun um die deine? –
»Die Lust am Verrat …« Ach, Ernest, da fällt mir ein anderes deiner Worte ein: »Niemand«, hast du einmal hingeworfen, »vermag tiefer in uns einzudringen als unser Feind, seherisch vermag er die verstecktesten unserer Schwächen, die behütetsten unserer Geheimnisse, die gehegtesten unserer Leidenschaften, die verhülltesten unserer Laster aufzuspüren, durch ihn erst lernen wir in unsere Abgründe schauen.«
– Horch also jetzt auf die Stimme des Feindes: »Ah, welche Verfeinerung aller Gaben, aller Einfälle, aller Laster! Welche Vorurteilslosigkeit, die gestattet, alle Ideen gleichzeitig in sich aufzunehmen und gegeneinander abzuwägen, welche Intelligenz, die mit Glaubenssätzen jongliert, wie ein Zauberkünstler mit farbigen Kugeln! Und das alles – Ideen, Kunstformen, Religion, Vaterland –, das alles umarmt er, um der tieferen Wollust willen, es fragwürdig zu machen, es zu verraten. Das liegt ihm im Blut: Seine adeligen Vorfahren in der Provence waren ein Geschlecht von Verrätern, bei ihnen blieb’s im kleinen Maßstab, ein Mitkämpfer wurde hinterrücks erstochen, ein Mitbewerber in einen Hinterhalt gelockt und abgetan, eine Geliebte schmählich preisgegeben; aus dem Dienst eines Fürsten gingen sie warnungslos in den eines anderen über, sie verrieten ihre Herren, ihre Freunde, ihre Gegner, ihre Frauen: Dem späten Enkel blieb es vorbehalten, ein ganzes Land zu verraten.« Wo nun steckt hier die tiefere, die seherische Erkenntnis des Feindes? Erschuf er nicht hier eine Gestalt, die in allem und jedem der Gegensatz des echten Ernest Mathieu wäre? Macht dieser Feind nicht den Abgründigen oberflächlich, verwandelt er nicht einen, der wie kein anderer an absolute Werte glaubt, in einen haltlosen Relativisten, einen Eklektiker – stellt er nicht ihn, der keine Halbzeile geschrieben hat, worin nicht seine Überzeugung, seine geistige Entwicklung, seine Blutsverbundenheit mit seinem Volk, seiner Erde, seiner Überlieferung ganz enthalten ist, als seichten Alleskönner hin, dessen Geschicklichkeit über seinen Mangel an Charakter und Persönlichkeit hinwegtäuscht?
Trotzdem – und Ernest wäre wohl der erste, es zu erkennen, wenn auch nicht, es zuzugeben –, trotzdem steckt noch in dieser Verleumdung ein Körnchen Wahrheit. Es ist hier von Ernests »adeligen Vorfahren in der Provence« die Rede, obwohl dieser Feind wissen sollte, daß die Le Sieutres Normannen sind, und es ist doch wiederum richtig, daß Ernests Mutter aus Cahors stammte, von einem Geschlecht, das dort seit Jahrhunderten ansässig war. Genau so ist auch ein Fünkchen richtiger Erkenntnis in dem Satz enthalten: »Um der tieferen Wollust willen, es fragwürdig zu machen.« O ja, immer wieder kommt es bei Ernest zu einer Krisis, worin er unaufhaltsam angetrieben wird, alles, was ihm bislang gültig, ehrwürdig, unverletzlich war, in Zweifel zu ziehen, auf die Probe zu stellen. Nicht zufällig hat er das Griselda-Motiv umgedichtet: Hat er denn nicht auch mich geprüft, ob ich alles, was er von mir verlangte, erfüllen – alles, was er mir auflüde, tragen würde? Hab’ ich nicht oft genug im Gleichnis für ihn die Stiegen gewaschen, wenn eine andere mit ihm geschmückt bei Tische saß? Dieser Unglaube im Glauben, dieser Zweifel noch im Vertrauen, dieser unstillbare Hang, zu wissen, was dem Verstand doch niemals deutlich wird, diese übersinnliche Frag-Würdigkeit ist recht eigentlich die Keimzelle von Ernests Künstlerschaft. Das ist es, was ihn mit deutscher Dichtung und Musik verknüpft: es ist ein faustisches Element, etwas von Beethovens Himmelsaufruhr, eine Dürersche Melancholia, eine Ritter-Tod-und-Teufelschaft, ein Schubertsches Zwiegespräch des Lebens mit dem Tode in Ernests erhabensten Versen enthalten. Was aber geht das denn den Mann im »Ausblick« an, dessen politisches Geschäft von ihm verlangt, Ernest unehrlich zu machen?
Er selbst aber, Ernest, wie faßt er selber das auf?
»Was wir jetzt herzklopfend, erschüttert, in atemloser Spannung miterleben, ist ja nicht länger ein Kampf um Gebietszuwachs, um Reichtümer, um Rohstoffe, es ist ein Kampf um Ideen, ein Kampf zur Durchsetzung einer heroischen Lebenshaltung. Es ist, tiefer gesehen, nur eine Phase der großen Umwälzung – der gewaltigsten seit der Völkerwanderungsepoche –, worin wir jetzt mitten innen stehen. Beginge nun einer, der, seit er zu sich selbst gekommen ist, seinem Volk den Spiegel vorgehalten hat, der ihm seine Gier nach Besitz, seinen Geiz, seine tierische Entseelung der Liebe, seine Herzenshärte, seine Oberflächlichkeit vor Augen gebracht – der ihm immer wieder den Weg zu einer Erneuerung, einer Läuterung, einer Veredelung, einer Umkehr gewiesen hat, Verrat – wenn er die wesentlichsten seiner Forderungen bei einem Nachbarn auf dem Weg zur Erfüllung sieht und sich diesem nun als Reisekamerad anschließen möchte? War es mir etwa verboten, Beethoven, Goethe, Nietzsche zu lieben, weil sie Deutsche sind? Wir – meinesgleichen – sind zu jeder Epoche und in jeder Nation eine kleine Minderheit, und unsere wenigen Brüder leben über die ganze Erde verstreut. Wie Pascal mit Kierkegaard enger verwandt ist als mit irgendeinem seiner Volks- und Zeitgenossen – die in der Mehrzahl ja seine gehässigen Angreifer waren –, finde ich heute solche, die mir zur Gesellschaft taugen, jenseits des Rheins. War Hölderlin vielleicht ein Verräter, als er, am Vorabend von Lunéville, Napoleon anrief, mit dem demütigen Bekenntnis: ›An solchem Stoff wird zum Knaben der Meister‹? Der Genius ist überzeitlich, übernational, überirdisch, allumfassend, und im Flackerlicht des Aufruhrs erkennen die helldunklen Geister einander.«
Die Anspielung auf Hölderlin wurde wortwörtlich genommen, um Ernest seine »ärgerliche Anbetung des Führers« vorzuhalten. Anbetung ist wohl kaum das zu Ernest passende Wort, bewundernde Zustimmung ziemte hier eher. Er ist für Ernest, was Napoleon für Hölderlin war: eine mythische Gestalt, Symbol des dämonisch getriebenen, aus Eingebungen, Erleuchtungen, Überwältigungen heraus Handelnden. Solche aber, bei denen alles Berechnung ist – wie könnten sie verstehen, daß hinter Ernests Haltung anderes als Berechnung steckte?
– Da verteidige ich ihn – und weiß doch gar nicht, wie weit er heute bereits von jenem Ernest, den ich kenne, abgerückt ist, und was sich, seit ich fort bin, auf der verdunkelten Halbkugel seines Wesens vollzogen hat?
Die Feinde indessen haben vor seinem Eigenleben gar keine Ehrfurcht, stöbern frech und rücksichtslos darin: Ab, hier steht’s ja, darauf hab’ ich schon gewartet! Auf die Enthüllung nämlich, daß Ernest »in der Verbindung mit der Tochter eines mediatisierten Fürstenhauses, die für ihn zugleich das Bindeglied zum Führer ist, die Erfüllung seiner kühnsten, seiner ehrgeizigsten Hoffnungen voraussieht«. Warum so zurückhaltend gerade in diesem Punkt, warum nennen sie den Namen nicht, da er ihnen doch auf der Zunge liegt? Freilich wär’ das eine Eroberung, mit der er sich sehen lassen dürfte, eine schöne Person, und jung – und Ernest …
In diesem Augenblick hat Madeleine ihn vor sich: Daheim in ihrem Wohnzimmer in der Rue de Fleurus, am Kamin sitzend, den Kopf in die rechte Hand gestützt. Zuerst gewahrt sie sein in der Mitte gescheiteltes Haar, worin das glänzende Lackschwarz nun bereits von vielen weißen Fäden durchzogen ist, dann seine früh gebleichten Schläfen; nun steht er auf, viel größer als der Sitzende es hätte erwarten lassen, er blickt auf Madeleine mit jenem Lächeln herab, das er ihr so oft zugewendet hat, wie auf ein begabtes, kluges, aber in weltlichen Dingen völlig unerfahrenes Kind. Seine Stirn ist nun ein bißchen stärker gefurcht, nach einem Zug aus der Zigarette stößt er zweifarbigen Rauch – blaßblau und grau – durch seine leicht gebogene Nase, von deren schmalen Flügeln sich geschwungene Kerben zu den Mundwinkeln abwärts ziehen; Kerben, die von Ironie, Hochmut, Mißtrauen und Wollust eingegraben sind; das weiche Kinn ist von einem Grübchen geteilt, die hellen blaugrünen Augen in dem dunklen Gesicht – Normannenerbe in einem Antlitz, das von einer südländischen Mutter übernommen ist – blicken forschend, unbeteiligt, kühl, überlegend und überlegen in irgendeine, anderen verschlossene Ferne.
Niemals wird Madeleine ganz wissen, was hinter diesen Stirnbuckeln vor sich geht, niemals wird sie diesen Proteus völlig kennen, niemals erraten, welcher seiner Widersprüche jetzt den anderen überwunden hat; niemals – wohin einer dieser Widersprüche ihn abseits locken, wie weit er ihn führen könnte, und wie weit er gehen wird, sobald er nun seinen Weg frei sieht, die Hemmung, die Warnerin, das Gewissen fort – und die Verführung gegenwärtig.
Da man ihn im Feindeslager nach seiner Bedeutung zu schätzen weiß – und besser als unter seinen eifersüchtigen »confrères« – wird man, ihn zu halten, die äußersten Mittel anwenden, wird versuchen, einen, der mit seinem Verstand, seiner Weltanschauung, seinen geistigen Neigungen auf der einen – mit seinem Instinkt, seinem Unbewußten, seiner Religiosität, seiner Kultur, seinem Geschmack auf der anderen Seite steht, bei seinem Irrationalen zu packen, um ihn dergestalt völlig ins andere Lager zu ziehen. Ist dieses Irrationale nun in der Fürstin Mechthild Liewen verkörpert? –
In dem kahlen Zimmer mit den roten Fliesen, den weißgestrichenen Holzwänden, die jetzt, als einzigen Schmuck, einen Kupferstich des Jacques Bellange tragen – ein Noli me tangere –, der für Madeleine besondere Bedeutung besitzt und den sie überallhin mit sich führt –, unter dem gebräunten Gebälk, sitzt Madeleine an dem niederen Tischchen über einem Brief, der, fürchtet sie, ins Leere gesprochen ist:
»Mein Ernest, wie weiß ich denn, ob meine Stimme Dich erreichen wird, so wie, durch einen providentiellen Zufall, die Deine mich kürzlich erreicht hat? Ich war über Weihnachten bei Freunden – was man hier so Freunde nennt: der wirkliche Freund, mein früherer Beichtvater, ist jetzt Kriegsgefangener im Fernen Osten, und seine Familie hatte mich liebenswürdig für die Feiertage eingeladen –, ich war also in einem recht kleinbürgerlichen Haushalt, in einem Provinzstädtchen, das Du wohl kaum dem Namen nach kennst, zu Gast; am Stephanstag, allein geblieben, dreh’ ich, ganz aufs Geratewohl die Nadel des Empfangsapparats, und – meine Hand stockt, meine Hand erstarrt, ich habe gar keine Hand mehr, keinen Mund, kein Auge, keinen Körper, bin nur Ohr – denn ich höre Dich …, Deine Stimme, über einen Abgrund von Zeit und Leid, über ungeheuren Raum, über Trennung, Mißverständnis, Herzweh hinweg, kommt zu mir, und ich – mich auflehnend gegen jedes Wort, gegen den Sinn jedes Wortes, trinke doch das Wort in mich ein, jedes in dem vollkommensten Klang unserer Muttersprache – jedes mit einer Überzeugung gesagt, welche die meine verwundet, jedes zum Preis und Vorteil jener, vor denen ich geflohen bin, und gegen die ich – nicht nur aus trägem Beharren im Gewohnten, aus Anhänglichkeit an eine Standarte, einen Wahlspruch, eine Überlieferung –, nein, aus seherischem Wissen um das Vergebliche, das Frevlerische Deiner Bemühungen, mich zur Wehr setze! Weil ich aus jenseitiger Schau die Kluft, die unüberbrückbare Verschiedenheit zwischen jenen und uns erkannt habe.
Vielleicht wirfst Du mir nun vor, ich sei’s, die sich gegen eins ihrer Heimatländer, das Land ihrer Mutter, auflehnt: Ach nein – es ist ja nicht mehr meiner Mutter Land, Ernest, wovon ich mich abwende –, unfreiwillig, überrumpelt, durch Erpressung, Verrat, feige Preisgabe, wie nur unser gemeinsames Vaterland, ist es rücksichtslosen Siegern ohne Schuß, ohne Waffengebrauch, zugefallen und wird nun von ihnen gewürgt, gepeinigt, geplündert, ausgesaugt. Das, wogegen ich mich kehre, ist ja nicht Deutschland selbst, es ist ja nur ein Wirbel in dem breiten Strom, nur ein Strähn im Geflecht des deutschen Geistes, nur eine Erscheinungsform seiner Vielgestalt, die darin augenblicklich zur Vorherrschaft gelangt ist – und sie mißbraucht. Ich verkenne gewiß nicht, daß sehr edle und sehr bedeutende Menschen jenseits des Rheins mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Vermögen in diesem Lager sind: Sind sie es aber auch mit ihrer ganzen Urteilskraft? Machen sie sich nicht willentlich unfühlsam gegen die Leiden der Andersdenkenden und Überwundenen, nicht taub gegen das geknebelte Stöhnen, das aus den Gefängnissen, den Konzentrations- und Zwangsarbeitslagern dringt, nicht blind vor den brennenden und blutigen Malen der Folter, den roten Striemen, blauen Wunden, schwarzen Frostbeulen? Sind sie denn nicht gehorsam verstummt – da sie doch schreien, brüllen, anklagen müßten?
O ja, ich weiß schon: Was jetzt – sagen sie, sagst Du – an notwendigen und vielleicht auch unnötigen Grausamkeiten verübt wird, gehört zu den Kinderkrankheiten der großen Erneuerung, seien wir nicht allzu wehleidig, bald genug werden sie überwunden sein!
Sie gehören dazu, vielleicht. Aber auch eine politische, eine religiöse Bewegung, ja, eine Nation, kann an ihren Masern, ihrem Scharlach, ihrer Diphtherie sterben, oder einen dauernden inneren Schaden davontragen. Sag nicht, das sei Empfindelei, gehöre zu dem, was wir beide die ›falschen Gefühle‹ zu nennen pflegen.
Worauf es einzig ankommt, ist, sagst Du wohl, Rang und Wert im Geistigen, im Seelischen und in den Handlungen der Menschen richtig zu unterscheiden, immer zu wissen, was das Wichtigere, wer der Wichtigere ist. Jede neue Idee, jeder neue Glaube ist unter blutigen Wehen zur Welt gekommen. Hat nicht ein Marot, ein Ronsard, ein d’Aubigné den Schmerz um die Unterdrückten, die Verfolgten, die Vernichteten so brennend verspürt, wie nur Du und ich ihn jetzt spüren? Und hat nicht jeder von ihnen auf der einen oder anderen Seite dennoch auf seinem Kampf beharrt? –
Das haben sie. Aber es war ein anderer Kampf mit anderen Mitteln, und er wurde auf beiden Seiten mit Berechtigung, mit Überzeugung, mit Gewissen und – trotz allem – mit Liebe geführt, es war Ehre, auf der einen Seite zu stehen wie auf der anderen, vorausgesetzt, man stand aus reinen Beweggründen dort. Aber meinst Du vielleicht, Agrippa d’Aubigné, ein Sterbender fast, nahm’s als Ehre auf, daß sein Sohn die Pläne von La Rochelle dem Kardinal ausgeliefert hat? Sicherlich hatte auch d’Aubigné der Jüngere gute Gründe – nicht nur böse Gründe – für diese Handlung: Vielleicht sah er in dem mutmaßlich Überlegenen, dem er zum Sieg verhalf, die verläßlichere Bürgschaft für das Gedeihen unseres Landes – vielleicht regte sich in ihm das Blutserbe seiner katholischen Vorfahren; an seinen bisherigen Waffengefährten aber sah er jetzt plötzlich die enge Stirn, die verkniffenen Lippen, den starren Eigensinn und die knöcherne Unduldsamkeit; bei seinen früheren Gegnern aber fand er den weiteren Horizont, ein ihm gemäßeres Lebensgefühl, die beweglichere Geistigkeit, ein schöpferisches Element – es war ein tragischer Zwiespalt, und wie immer er sich entschied, war es tragische Entscheidung. Das ist es nun – und darin geb ich Dir recht, Ernest –, wir müssen, ehe wir uns anmaßen, über einen Charakter zu urteilen, zuerst sein spezifisches Gewicht kennen – das ist es nun, was von fast allen, die über unsere Vordergrundsfiguren sprechen, verabsäumt wird. Immer kommt es ihnen nur auf das ›Was‹ einer Handlung an, nie darauf ›wer‹ es ist, der sie begeht. Niedrige Motive, gemeiner Ehrgeiz, zynische Leichtfertigkeit – sind das denn Begriffe, die überhaupt mit Dir in Verbindung gebracht werden dürfen? Nur wer Dich gar nicht kennt, vermag Dir so etwas vorzuhalten, und ich, die Dich besser kennt als irgendein Lebender, besser vielleicht – wenn auch nicht so ganz vielseitig –, als Du Dich selbst kennst, ich sollte da nicht widersprechen?
Da ich doch ahne, da ich doch weiß, was Dich ergriffen hat: daß Du müde warst unserer Oberfläche, müde unserer geschlossenen starren Form, müde unserer seichten Lebensauffassung, unserer spielerischen Kunst, unserer törichten Übereinkunft, die einen Verstoß gegen Ehre und Ethos läßlich – und einen Verstoß gegen gesellschaftliche Formeln unverzeihlich fand; daß Du überdrüssig warst unserer verniedlichten, eleganten Gefühle, unserer beschnittenen Gärten, unserer Hahnreikomödien, unserer importierten Jazzkapellen und eingeführten Niggersteptänze, unserer entseelten, verdorbenen, verwesenden Zivilisation. Mit der Inbrunst eines Mystikers, der weiß: ›Uns rettet nur Gott‹, hast Du gesagt: ›Uns rettet nur der Krieg‹ …, stumm fortsetzend: ›Nur der verlorene Krieg‹, denn unser Volk hat sich noch jedesmal in der Niederlage groß bewährt. Ich kann auch verstehen, was Du am deutschen Wesen aufsuchst und liebst: den dunklen Urwald des Herzens, den Urgrund alles Menschlichen, den herben Klang einer Ursprache, die über alle fremden Einströmungen hinweg sie selbst geblieben ist, das Wort ›Ur‹ an sich, das in keiner anderen lebenden Sprache ein Äquivalent hat, und das die deutsche adelt. Noch das an ihnen, was man bei uns als Mängel ansieht, steht Dir hoch: das Fehlen aller gesellschaftlichen Überlieferung und damit alles gesellschaftlichen Zwanges, die freiwillige Armut – sind nicht alle großen deutschen Ideen aus unvorstellbar dürftigen Pfarren und Kleinbürgerwohnungen hervorgegangen? –, die seelische Freiheit noch unter Zwang und Bedrückung, die Selbstzucht, womit das Leiden hingenommen wird als eine Vorstufe zur Vollkommenheit.
Diese gerechte Bewunderung aber macht Dich oft ungerecht gegen Dein eigenes Volk: Du siehst nicht, wie anmutig sich seine leichte Art von der deutschen Schwerfälligkeit abhebt, wie vorteilhaft seine Genügsamkeit in Trank und Speise von der deutschen Gier, wie klar sein folgerichtiges Denken von der deutschen Verworrenheit, die oft Tiefe nur vortäuscht. Du anerkennst nicht die eingeborene Fähigkeit des Franzosen zur Form, da dem Deutschen alles unter den Händen ins Ungeheure anwächst – oder zerbricht.
Das alles verstehst Du nicht genug zu schätzen, weil es Dir selbst mehr als irgendeinem Deiner lebenden Landsleute eignet, es ist Dir selbstverständlich, es west in Deiner Dichtung und Deinem Alltag, in Deiner Kunstform und Deiner Lebensform. Du aber reichst über diese Begrenzungen weit hinaus, es ist das Ahnen um Abgründe, was Dich groß macht, kein anderer hebt wie Du, was aus Urtiefen stammt, als Gebild zur Oberfläche. Das ist es, was sie drüben an Dir wert halten, Du hast, was gestaltlos, unfaßbar, flutend in ihrem Unbewußten lebt, ihnen sichtbar gemacht.
Wenn irgendeiner, hast Du das Recht, als Ausnahme zu gelten und Ausnahmsgesetze für Dich zu beanspruchen. Nur vergiß nicht, wie viele Augen an Dir hängen, wie viele Lippen Dir nachbeten, wie viele sich nach Deinem Beispiel entscheiden: ›Was Le Sieutre tut, muß das Rechte sein, ich will ihm nachfolgen.‹
Das ergibt aber zugleich eine furchtbare Verantwortlichkeit, die mich erzittern macht. Wie – wenn er einmal, im guten Glauben, gewiß, mit unwiderleglichen irdischen Gründen dafür, aber dennoch – dennoch einmal das täte, was vor dem forum dei Unrecht ist?
Du weißt, Ernest, ich war immer bereit, mit einer unverwüstlichen Neigung bereit, Dir recht zu geben gegen mich. Immer war mir’s Bedürfnis, Deine Überlegenheit, Deinen schärferen Blick, Dein tieferes Verständnis für alle Lebensdinge anzuerkennen. Ich wußte, Du: überragtest mich so weit, daß Du notwendig über mich hinausblicken mußtest. Doch gerade, weil Du so hoch stehst, mag Deiner edlen metaphysischen Weitsichtigkeit manches Nahe, Kleine, Unscheinbare, Demütige entgangen sein, Du magst übersehen, welche Schönheit im geduldigen Ausharren, welche Kraft in der eigensinnigen Ablehnung alles Fremden, welcher heldische Wille in der stummen Unnachgiebigkeit, dem einsilbigen Widerstand gegen die Bedrücker, lebt.
Gewiß, Du hast mir versprochen, solche zu schonen, ja, ihren Schutz zu übernehmen, war einer der ersten und vornehmsten Gründe, die Dich zum Bleiben bewogen haben. Wie aber weiß ich, ob Du es jetzt nicht schon notwendig findest, sie vor sich selbst zu schützen, in einer Haft, welche die neuen Herren sehr doppelsinnig ›Schutzhaft‹ nennen? Ach, Ernest, wie erträgst Du denn diesen Zwiespalt, dieses Zwischen-den-Lagern-Stehen? Das unaufhörliche Hin-und-zurück-gerissen-Werden, das beständige Sowohl-als-Auch, Du, bei dem es doch immer Entweder-Oder geheißen hat?