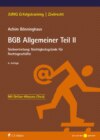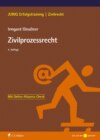Kitabı oku: «Sachenrecht III», sayfa 3
b) Die nicht akzessorischen Personalsicherheiten
14
Beim (gesetzlich nicht geregelten) Schuldbeitritt – auch „kumulative Schuldübernahme“ genannt – will der Beitretende sich bildlich gesprochen neben den Schuldner als weiteren Schuldner stellen. Nach einem Schuldbeitritt ist der Sicherungsgeber somit Gesamtschuldner neben dem ursprünglich allein haftenden Schuldner.
Der Schuldbeitritt ist noch gefährlicher als die Bürgschaft – insbesondere die in § 766 angeordnete Schriftform gilt nicht – und wird deshalb nur unter sehr engen Voraussetzungen angenommen (siehe Rn. 123).
15
Schließlich kann ein Sicherungsgeber mit dem Gläubiger auch einen Garantievertrag schließen. Dieser begründet dann eine selbstständige Schuld des Sicherungsgebers und nicht nur eine akzessorische Haftung des Sicherungsgebers für eine fremde Schuld. Ein Garantievertrag wird wegen seiner weitreichenden Haftung (siehe Rn. 125) aber – ähnlich wie der Schuldbeitritt – nur unter sehr engen Voraussetzungen anerkannt.
3. Mobiliarsicherheiten
16
Wie bereits erwähnt, unterscheiden wir bei den Realsicherheiten solche, die Mobilien und solche, die Immobilien zum Gegenstand haben. Gemeinsam haben beide Formen der Kreditsicherung, dass der Gläubiger nicht auf die Zahlungsfähigkeit des Sicherungsgebers vertraut (so wie bei den Personalsicherheiten), sondern auf den Wert des Sicherungsgegenstandes.
Beispiel
Wenn der künftige Pilot aus dem Beispiel in Rn. 2 keine Bürgschaft seines Vaters beibringt, sondern seine Großmutter überzeugen kann, zugunsten der Bank auf ihrem Grundstück eine Hypothek zu bewilligen, so wird die Bank nicht prüfen, ob die Großmutter aus eigenen Einkünften die Schuld des Flugschülers begleichen könnte, sondern vielmehr, ob der Wert des Grundstückes (nebst Gebäude sowie mithaftendes Zubehör) im Falle der Zwangsversteigerung das Darlehen wird ausgleichen können.
17
Die gesetzliche Grundform aller Mobiliarsicherheiten ist das Pfandrecht. Ein Pfandrecht kann an einer beweglichen Sache (§§ 1204 ff.) sowie an Rechten (§§ 1273 ff.) bestellt werden. Beide Pfandrechte gehören zu den akzessorischen Sicherheiten. Beiden ist zudem gemeinsam, dass sie vom Gesetzgeber als Instrumente der Kreditsicherung geschaffen wurden und beide haben schließlich die Gemeinsamkeit, dass ihre praktische Bedeutung gering ist.
Exkurs: Gelegentlich finden Sie in der Literatur die Unterscheidung zwischen gesetzlichen und kautelarischen Sicherungsmitteln[6].Gemeint ist damit Folgendes. Das BGB bot ursprünglich nur akzessorische Sicherungsmittel an. Bewegliche Sachen sollten zum Beispiel rechtsgeschäftlich nur dann verpfändet werden dürfen, wenn der Eigentümer für die Zeit des Pfandrechts den unmittelbaren Besitz auf den Pfandgläubiger überträgt. Dieses sogenannte Faustpfandrecht entsprach aber nicht den Bedürfnissen der Praxis. Es musste ein Sicherungsmittel gefunden werden, mit dem einerseits der Gläubiger gesichert ist, andererseits die Sache weiter genutzt werden kann. Die Kautelarpraxis entwickelte daher das Institut der Sicherungsübereignung.
18
Das vertragliche Pfandrecht an beweglichen Sachen entsteht durch ein Verfügungsgeschäft.
Hinweis
Sie erinnern sich: Eine Verfügung ist ein Rechtsgeschäft, das unmittelbar auf die Aufhebung, Übertragung, Belastung oder inhaltliche Veränderung eines bestehenden Rechtes gerichtet ist.[7]
Lesen Sie hierzu §§ 1205, 1206 im Gesetz mit.
Gemäß § 1205 muss der Eigentümer (Sicherungsgeber) mit dem Gläubiger darüber einig sein, dass ein Pfandrecht an der Sache entstehen soll, und muss ihm die Sache übergeben. Von der Struktur her ähnelt also § 1205 für die Bestellung des vertraglichen Pfandrechts dem § 929 bei der Eigentumsübertragung beweglicher Sachen.
19
Das Problem beim vertraglichen Pfandrecht liegt aber im Übergabeerfordernis. Da das vertragliche Pfandrecht die Übergabesurrogate der §§ 930 ff. nicht kennt,[8] verliert der verpfändende Eigentümer den Besitz und kann die verpfändete Sache bis zum Erlöschen des Pfandrechts nicht mehr nutzen.

[Bild vergrößern]
Beispiel
Zwar könnte man bei einem mithilfe eines Darlehens finanzierten Kauf eines Kraftfahrzeuges das Fahrzeug der Bank als Sicherheit verpfänden. Dazu muss aber die Bank alleinige Besitzerin werden – bildlich gesprochen muss das Auto also in der Tiefgarage der Bank stehen. Das ist aber mit dem wirtschaftlichen Sinn des finanzierten Abzahlungskaufs nicht zu vereinbaren.
Deshalb ist die Bedeutung des vertraglichen Pfandrechts gering. In der Praxis kommt es bei den Pfandleihhäusern vor sowie beim sog. Lombardgeschäft der Banken.[9] Das vertragliche Pfandrecht ist fast vollständig durch die Sicherungsübereignung (siehe Rn. 175 ff.) verdrängt worden.
20
Größere Bedeutung hat hingegen das gesetzliche Pfandrecht, das Sie vor allem aus dem Mietrecht (§ 562 ff.) und Werkvertragsrecht (§ 647) kennen.[10] Weil gemäß § 1257 die Regeln des vertraglichen Pfandrechts auch beim gesetzlichen Pfandrecht anwendbar sind, müssen wir zunächst das vertragliche Pfandrecht bearbeiten, bevor wir das gesetzliche Pfandrecht verstehen können.
21
Das gleiche Schicksal wie das vertragliche Pfandrecht an beweglichen Sachen hat das vertragliche Pfandrecht an Rechten ereilt. Ursprünglich vom (historischen) Gesetzgeber als Kreditsicherungsmittel gedacht, ist es für den praktisch wichtigsten Fall durch die Sicherungszession ersetzt. Die Ursache liegt in § 1280. Ist das zu verpfändende Recht nämlich eine Forderung, muss neben der Einigung zwischen Sicherungsgeber und Gläubiger auch noch eine Anzeige an den Drittschuldner erfolgen. Eine „stille Verpfändung“ (ohne dass der Drittschuldner davon etwas mitbekommt) ist daher nach den §§ 1273 ff. nicht möglich.
22
Die größte praktische Bedeutung haben im Bereich der Mobiliarsicherheiten daher die Sicherungsübereignung, die Sicherungszession sowie der Eigentumsvorbehalt. Alle drei sind nicht akzessorische Sicherungsrechte. Und alle drei sind sogenannte fiduziarische Sicherungsrechte.[11] Dies bedeutet, dass der Gläubiger vom Sicherungsgeber mehr an Rechtsmacht erhält, als er im Innenverhältnis soll ausnutzen dürfen:
23
Bei der Sicherungsübereignung überträgt der Sicherungsgeber dem Gläubiger das volle Eigentum an der Sache nach den §§ 929 ff. Der große Vorteil hierbei: Im Gegensatz zum Pfandrecht kann ein Besitzmittlungsverhältnis vereinbart werden, sodass z.B. der Eigentümer eines Autos dieses zu Sicherheit übereignen kann und trotzdem weiter Besitzer bleiben darf. Die Probleme entstehen aber dadurch, dass der Gläubiger mehr erhält (volles Eigentum), als er wirtschaftlich erhalten soll (nur Absicherung seiner Forderung gegen den Schuldner).
24
Ganz ähnlich verhält es sich mit der Sicherungszession. Hier tritt der Sicherungsgeber eine (oder in der Praxis gleich mehrere) Forderungen gegen Drittschuldner an den Gläubiger ab. Wirtschaftlich soll aber nur die Verbindlichkeit des Schuldners abgesichert werden. Regelmäßig wird die Abtretung aber den Drittschuldnern nicht offenbart (angezeigt). Das ist bei der Zession auch nicht notwendig, wohl aber bei der Verpfändung (§ 1280, s.o. Rn. 21).
Daraus resultieren die Schwierigkeiten dieses Sicherungsinstrumentes: Die Drittschuldner können befreiend an den Sicherungsgeber zahlen (obwohl dieser gar nicht mehr Inhaber der Forderung ist). Das ergibt sich aus § 407.
25
Beim Eigentumsvorbehalt schließlich geht es um die Sicherung von Lieferantenkrediten. In der wirtschaftlichen Praxis liefern fast alle Unternehmen „auf Ziel“. Das heißt im Ergebnis, dass sie ihre Ware liefern, bevor sie vom Käufer das Geld dafür erhalten.[12] In dieser Zeit ist der Verkäufer ungeschützt. Deshalb vereinbaren fast alle Lieferanten mit ihren Kunden einen sogenannten Eigentumsvorbehalt, der gesetzlich in § 449 anerkannt ist.
26
Wenn wir also die nicht akzessorischen Mobiliarsicherheiten erörtern, werden wir einen besonderen Schwerpunkt auf die aus dem Charakter der Sicherungsübereignung, des Eigentumsvorbehaltes sowie der Sicherungszession als fiduziarische Sicherungsrechte resultierenden Schwierigkeiten einzugehen haben.
4. Immobiliarsicherheiten
27
Die Tatsache, dass es nur zwei Arten der Realsicherheiten bei Immobilien gibt, mag zunächst zur Annahme verleiten, dass hier kein Schwerpunkt im Recht der Kreditsicherheiten liegt. Das Gegenteil ist, wie Sie bemerken werden, der Fall.
Außerdem kann man die Grundschuld (und die mit ihr verbundenen Probleme im Rahmen der Kreditsicherung) nur begreifen, wenn man zuvor die Hypothek verstanden hat. Dies wiederum setzt voraus, dass Ihnen der Begriff der Akzessorietät geläufig ist.[13] Im Überblick:
28
Sehen Sie sich hierzu die §§ 401, 1113, 1153, 1163 an.
Eine Hypothek ist eine akzessorische Realsicherheit. Das klingt kompliziert, ist aber durch den Vergleich mit der Bürgschaft leicht zu verstehen: Auch der Bürge haftet nur soweit, wie die Forderung besteht. Geht sie unter oder ist sie erst gar nicht entstanden, gibt es auch keine Rechte aus der Bürgschaft. Ähnliches gilt für die Hypothek: Sie steht dem Gläubiger nicht zu, wenn die gesicherte Forderung nicht entsteht bzw. wieder erloschen ist, § 1163.
Auch bei der Übertragung der Forderung wandert die Hypothek genauso mit wie die Bürgschaft. Eine isolierte Übertragung der Forderung ist also konstruktiv ausgeschlossen, § 1153. Oder, um es exakt zu formulieren: Eine Hypothek kann gar nicht abgetreten werden. Abgetreten wird immer nur die Forderung, an der die Hypothek „klebt“.
29
Im Unterschied zur Bürgschaft kann man den Sicherungsgeber einer Hypothek (= Eigentümer des belasteten Grundstücks) aber nicht auf Zahlung verklagen, sondern „nur“ auf Duldung der Zwangsvollstreckung, § 1147. Natürlich kann der Eigentümer zahlen, um das zu vermeiden (§ 1142). Dadurch erwirbt er die Forderung, wie sich aus § 1143 ergibt. Der Sicherungsgeber (= Eigentümer des Grundstücks) bezahlt also nicht etwa die Verbindlichkeit des Schuldners. Diese bleibt vielmehr bestehen und steht dem Eigentümer als Möglichkeit des Regresses zu (siehe gleich Rn. 32 f.).
Sie sehen also, dass die Hypothek nur ein „Anhängsel“ der gesicherten Forderung ist. Sie ist eben akzessorisch.
30
Obwohl die in den §§ 1191 ff. geregelte Grundschuld ganz ähnlichen Zwecken dienen kann, wie die eben skizzierte Hypothek, ist sie doch völlig anders konstruiert. Im Unterschied zur Hypothek ist die Grundschuld nicht mit der gesicherten Forderung „verkoppelt“. Sie ist eben nicht akzessorisch. Das sagt § 1192 ausdrücklich. Die Grundschuld ist mit der besicherten Forderung nur schuldrechtlich, sozusagen „locker“ mit der besicherten Forderung durch den sogenannten Sicherungsvertrag verbunden. Sollte im Sicherungsvertrag als Zweck der Grundschuld die Absicherung einer Forderung vereinbart worden sein, spricht man von einer Sicherungsgrundschuld (siehe auch Wortlaut des § 1192 Abs. 1a)
31
Das hat weitreichende Konsequenzen. Kurz gesagt werden wir uns mit folgenden Problemen zu beschäftigen haben: Wie erhält der Sicherungsgeber „seine“ Grundschuld zurück, wenn der besicherte Kredit (ob durch ihn oder den Schuldner) bezahlt wurde? Wie kann der Sicherungsgeber geschützt werden, wenn der Gläubiger (vertragswidrig) Forderung und Grundschuld trennt?
Anmerkungen
[1]
Bülow Kreditsicherheit Rn. 1.
[2]
In diesem Skript werden die sehr speziellen Fragen der Schiffs- und Luftfahrzeugregister nicht erörtert.
[3]
Palandt-Sprau vor § 765 Rn. 2.
[4]
Siehe hierzu detailliert unter Rn. 150.
[5]
Zur Abgrenzung zur weichen Patronatserklärung siehe unten Rn. 121.
[6]
So für alle: Bülow Kreditsicherung ab Rn. 1543.
[7]
Palandt-Ellenberger vor § 104 Rn. 16.
[8]
Vgl. §§ 1205, 1206.
[9]
Palandt-Bassenge vor § 1204 Rn. 1; auf das Lombardgeschäft werden wir nicht weiter eingehen.
[10]
Weitere Beispiele für das gesetzliche Pfandrecht siehe: Palandt-Bassenge § 1257 Rn. 1 sowie umfassend: Schwerdtner JURA 1988, S. 251 ff.
[11]
Zu diesem Begriff siehe Medicus/Petersen Bürgerliches Recht Rn. 126 sowie Rn. 488 ff.
[12]
Das durchschnittliche Zahlungsziel in Deutschland beträgt derzeit rund 30 Tage!
[13]
So auch eindringlich Westermann Sachenrecht Rn. 544.
1. Teil Überblick › B. Der Regress
B. Der Regress
1. Teil Überblick › B. Der Regress › I. Die konstruktiven Möglichkeiten des Regresses
I. Die konstruktiven Möglichkeiten des Regresses
32
Der Regress, auch Rückgriff genannt, ist ein Spezialfall des Aufwendungsersatzes. Beim Aufwendungsersatz gibt es aber nur zwei Personen: Denjenigen, der Aufwendungen gemacht hat, und den, der daraus einen Vorteil zieht und deshalb die Aufwendungen zu erstatten hat.[1] Beim Spezialfall des Regresses sind aber zwingend drei Personen beteiligt.[2]
33
Sie erinnern sich: Alle Kreditsicherungen haben die gleiche Struktur (s. Rn. 2 ff.). In jedem Sachverhalt aus dem Bereich des Kreditsicherungsrechts gibt es (gedanklich) drei beteiligte Personen:
| 1. | Der Gläubiger, also derjenige, der den Kredit zur Verfügung stellt. |
| 2. | Der Schuldner, also derjenige, der den Kredit erhält und |
| 3. | der Sicherungsgeber, also der, der mit einem Instrument des Kreditsicherungsrechts die Forderung absichert. |
Dass in vielen Fällen Schuldner und Sicherungsgeber identisch sind, ändert nichts daran, dass ihre Rolle (und damit die Anspruchsgrundlagen) andere sind, je nachdem, ob der Gläubiger aus der Forderung oder aus der Sicherheit vorgeht.
34
Regressfragen stellen sich also nur dann, wenn Schuldner und Sicherungsgeber verschiedene Personen sind.
Beispiel
Wenn der Studienrat O aus unserem Beispiel Rn. 3 die Raten für den Kredit für sein Grundstück nicht mehr bezahlt, kann die Bank entweder ihn auf Zahlung aus dem Kreditvertrag verklagen oder (was sie meistens tut) aus der dinglichen Sicherheit vorgehen. Wie das genau geht, erarbeiten wir weiter unten ab Rn. 371.
Es macht in diesem Beispiel keinen Sinn über einen Regress nachzudenken. Denn wenn O sein Grundstück im Wege der Zwangsversteigerung verliert, dann doch deswegen, weil er die Raten nicht mehr bezahlt hat. Auf wen sollte er also im Sinne der folgenden Definition das Opfer, das er erbracht hat, abwälzen?
35
Nach allem können wir den Begriff Regress wie folgt definieren:

Der Regress ist ein Aufwendungsersatzanspruch gegen eine Person, die durch die Leistung des Anspruchstellers an einen Dritten begünstigt ist, damit das in der Leistung liegende Opfer von dem Leistenden auf den Begünstigten abgewälzt werden kann.[3]
36
Grundsätzlich gibt es drei Wege, wie der Sicherungsgeber sich beim Schuldner schadlos halten kann:
37
Als erste (und leicht übersehene) Anspruchsgrundlage kommt natürlich eine Vereinbarung zwischen Schuldner und Sicherungsgeber in Betracht. Niemand kommt schließlich „einfach so“ auf den Gedanken, sich für die Schuld eines anderen z.B. zu verbürgen.
In aller Regel dürfte ein Auftrag oder auftragsähnliches Vertragsverhältnis vorliegen. Die entsprechende Anspruchsgrundlage für den Aufwendungsersatz ist dann § 670.
38
Bei allen akzessorischen Sicherungsmitteln gewährt der Gesetzgeber dem leistenden Sicherungsgeber einen besonderen Anspruch. Da der Sicherungsgeber nicht eine fremde Schuld tilgen wollte, sondern vielmehr aufgrund seiner Haftung zahlt, geht die Forderung im Verhältnis zum Schuldner nicht unter. Der leistende Sicherungsgeber erwirbt diese kraft gesetzlicher Abtretung (cessio legis).[4] Der Sicherungsgeber erhält also die Forderung des Gläubigers und kann aus dieser gegen den Schuldner vorgehen.
Nun fragen Sie sich vielleicht zu Recht, warum der Gesetzgeber diesen speziellen Regress gewährt, wenn doch ein Rückgriff – jedenfalls in aller Regel – durch den Vertrag zwischen Schuldner und Sicherungsgeber gewährleistet ist.
Lesen Sie hierzu bitte unbedingt die §§ 401, 412!
Die Antwort liegt in der Rechtsnatur der Abtretung: Da der Sicherungsgeber die Forderung erhält, gehen mit der Forderung auch alle noch bestehenden weiteren akzessorischen Sicherheiten auf den Sicherungsgeber über (vgl. §§ 401, 412).
39
Schließlich kommen, wenn sozusagen alles nichts hilft, besondere Rückgriffsansprüche in Betracht. Wichtig sind in diesem Zusammenhang die Regelungen in § 426 (Regress bei Gesamtschuld). Dann gibt es noch weitere Regressansprüche, die zwar juristisch hochinteressant sind, aber im Bereich des hier behandelten Kreditsicherungsrechts keine Rolle spielen.[5]
Hinweis
In der Rechtswirklichkeit sind Auseinandersetzungen wegen Regressansprüchen eher selten. Dies hat keine juristischen, sondern hauptsächlich wirtschaftliche Gründe. Wird nämlich ein Kredit notleidend und der Gläubiger nimmt dies zum Anlass, den Sicherungsgeber in Anspruch zu nehmen, so hat das in aller Regel seinen Grund darin, dass der Schuldner nicht mehr zahlungsfähig ist. Dann macht es aber für den Sicherungsgeber wenig Sinn, diesen ohnehin nicht mehr leistungsfähigen Schuldner zu verklagen, auch wenn er noch so „schöne“ Ansprüche hat. Sinn macht das Vorgehen also nur, wenn der Gläubiger den Sicherungsgeber deswegen in Anspruch nimmt, weil dieser liquider als der Schuldner ist. Das ist dann z.B. der Fall, wenn der Schuldner zwar über Vermögen (Grundstücke, Beteiligungen etc.) verfügt, aber zum Fälligkeitszeitpunkt der Verbindlichkeit nicht genügend Barmittel hat.
1. Teil Überblick › B. Der Regress › II. Überblick über die Regressansprüche
II. Überblick über die Regressansprüche
1. Der Aufwendungsersatzanspruch
40
Wie gerade erwähnt, sollten Sie niemals vergessen, den Anspruch aus § 670 zu prüfen, wenn es in Ihrem Fall darum geht, dass der Sicherungsgeber in Anspruch genommen wurde und er nun den Schuldner in Regress nimmt. Dieser Anspruch gilt sowohl für die akzessorischen Sicherheiten als auch für die nichtakzessorischen Instrumente der Kreditsicherung.
2. Übergeleitete Ansprüche bei akzessorischen Sicherungen
41
Der (vor allem) für die Klausur wichtigste Regressanspruch des Sicherungsgebers ergibt sich bei akzessorischen Kreditsicherungen aus der kraft cessio legis übergangenen Forderung gegen den Schuldner. Der Forderungsübergang ist für die hier behandelten Instrumente für die folgenden drei Fälle gesetzlich angeordnet:
| 1. | der zahlende Bürge: § 774 Abs. 1; |
| 2. | der zahlende Eigentümer im Falle der Hypothek, § 1143 Abs. 1; |
| 3. | der zahlende Verpfänder beim Pfandrecht, § 1225. |