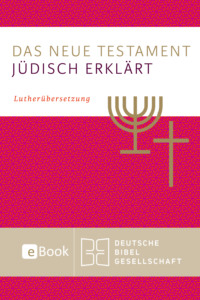Kitabı oku: «Das Neue Testament - jüdisch erklärt», sayfa 6
Die Gattung
Die neutestamentliche Wissenschaft diskutiert, inwieweit die kanonischen Evangelien als Biographien anzusehen sind. Sie sind sicher keine Biographien im modernen Sinn des Wortes: sie bieten keine komplette Lebensgeschichte, da sie z.B. Jesu Kindheit ebenso ignorieren wie das weitere Schicksal von Marias Ehemann Josef, die Fragen, ob Jesus verheiratet war oder nicht, oder welche formelle Erziehung er genoss. Sie erwähnen auch keine Fragen nach der Motivation oder geben in irgendeiner Weise vor, objektiv zu sein. Vielmehr sind sie zu einem bestimmten Zweck verfasst; Johannes (20,31) nennt ihn ausdrücklich: „damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes“.
Die Evangelien ähneln indes in ihrer literarischen Form antiken Biographien (gr. bioi, lat. vitae, Erzählungen des „Lebens“). Zu diesen narrativen Berichten, die gewöhnlich eine einzelne Schriftrolle von 10–12 m bzw. 10.000–20.000 Worte umfassten, gehören auch Plutarchs „Das Leben Alexanders (d.Gr.)“ aus dem 1. Jahrhundert, Suetons „Caesarenleben/Kaiserbiographien“ aus dem frühen 2. Jahrhundert und das vom griechischen Philosophen Philostratos (170– ca. 247 u.Z.) verfasste „Leben des Apollonius von Tyana“, eines Lehrers und Wundertäters aus dem 1. Jahrhundert. Diese Biographien bieten zumeist Informationen zur Familie des Protagonisten und den Umständen seiner Geburt, seiner öffentlichen Wirksamkeit und seinem (üblicherweise heldenhaften) Tod. Die Texte sollten die Leserinnen und Leser zur Nachahmung der Tugenden der Helden anregen.
Die Evangelien weichen in mehrerlei wichtigen Hinsichten von diesen antiken Biographien ab. Der Hauptunterschied ist die Anspielung der Evangelien auf die Schriften Israels (gewöhnlich in ihrer griechischen Übersetzung, der Septuaginta). Diese Bezugnahmen – z.B. die Genealogie am Anfang des Matthäusevangeliums, die Jesus mit Abraham, David und Mose verknüpft, die Verbindung Johannes des Täufers mit der Prophetie Jesajas am Anfang des Markusevangeliums, die Darstellung der Eltern des Täufers bei Lukas im Lichte anderer biblischer Paare, die mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen hatten, oder der Prolog des Johannesevangeliums mit seiner großartigen Wiederaufnahme von Gen 1,1–2 – machen deutlich, dass die Evangelien als Teil einer größeren Geschichte und als Erfüllung dieser Geschichte geschrieben worden sind. Quellen aus der Zeit des Zweiten Tempels enthalten andere Beispiele von (antiken) Biographien, wie die autobiographische „Vita“ des Josephus oder Philos„Leben Moses“, aber diese Gattung gibt es nicht unter den rabbinischen Quellen. Es gibt keine rabbinischen Bücher über das Leben Abrahams, Moses oder Davids, Hillels, Rabbi Aqivas oder Rabbi Jehuda ha-Nasis. Dies ist eine von mehreren bedeutsamen Unterschieden zwischen den Evangelien und späteren jüdischen Schriften. Außerdem bezogen sich jüdische Texte im Vergleich mit denen, die die Anhänger Jesu Christi verfassten, stärker auf die Gemeinde/Gemeinschaft. So diskutieren in rabbinischen Kommentaren mehrere Gelehrte miteinander, während christliche Literatur tendenziell eher aus einer Hand stammt (wie z.B. von Paulus, Ignatius von Antiochia, Justin dem Märtyrer, Augustinus). Die rabbinische Auslegung als Traditionsliteratur erzählt die Geschichte des Volkes Israel, während die christlichen Texte als Autorenliteratur überwiegend die Geschichte nicht der Kirche, sondern einzelner Gestalten darstellen (z.B. das Martyrium des Polykarp, das Leben des hl. Antonius). Keine einzelne Figur, nicht einmal Mose, wird in der jüdischen Literatur so herausgestellt wie Jesus in den neutestamentlichen Evangelien und der späteren christlichen Literatur.
Das Ausmaß, in dem die Evangelien tatsächlich berichten, „was wirklich geschah“, kann nicht aufgeklärt werden. Obwohl die Texte auf den Erinnerungen der Anhängerinnen und Anhänger Jesu basieren, passten Lehrer und Erzähler sie stets den Bedürfnissen ihres jeweiligen Publikums und ihrem eigenen Verständnis davon an, wer Jesus war und was er zu vollbringen suchte. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass Jesus auf Aramäisch gelehrt hat und dies ins Griechische übertragen wurde. Orte, an denen die Handlungen Jesu entweder explizit oder implizit auf die Heiligen Schriften Israels anspielen, sind besonders problematisch für Historikerinnen und Historiker, die das Leben Jesu rekonstruieren wollen. Folgte Jesus selbst – oder Ereignisse in seinem Leben – den Modellen dieser Texte, oder modellierten spätere Verfasser seine Lebensgeschichte nach diesen Mustern? Die synoptischen Berichte über Jesu Tod spielen intensiv auf Ps 22 an und zitieren ihn sogar. Manche Fachleute fragen (sich) nun, ob die Evangelisten die Passionsgeschichte im Lichte dieses Psalms komponierten oder ob die Ereignisse am Kreuz selbst die Verse des Psalms abbildeten.
Die Evangelien spiegeln auch die Erinnerung der Gemeinde(n), die von den Schriften Israels beeinflusst ist, die mündliche Ausschmückung der Geschichten über Jesus im Laufe der ersten Jahrzehnte nach seinem Tod und die Bedürfnisse der Evangelisten sowie ihrer Leserinnen und Leser wider. Allein die Tatsache, dass verschiedene Quellen innerhalb des Neuen Testaments über so grundlegende Fragen wie die, was Jesus während des Letzten Mahles sagte (die Einsetzungsworte), unterschiedliche Angaben machen, zeigt, dass die Christusgläubigen sich mehr um die grundlegende Substanz oder Bedeutung seiner Lehren sorgten als um die wörtliche Wiedergabe seiner Worte (s. Mt 26,26–29; Mk 14,22–25; Lk 22,19–20; 1Kor 11,23–26 und ähnliche Aussagen außerhalb des Kontexts des Letzten Abendmahls, Joh 6,48–60). Nicht nur die Worte Jesu, sondern auch seine Taten werden unterschiedlich dargestellt, und auch hier wiederum ist die Frage nach der Historizität der Überlieferung komplex und umstritten. Gab es z.B. zwei von Dämonen besessene Männer in einem Ort namens Gadara, wo das Ertränken einer Herde Schweine einem Exorzismus durch Jesus zugeschrieben wird (Mt 8,28–34), oder ist Gerasa der Ort des Geschehens, wo ein einzelner Besessener geheilt wird (Mk 5,1–20)? Und um die Angelegenheit weiter zu verkomplizieren: Wurde die zuletzt genannte Geschichte angesichts der Tatsache, dass gerasch im Hebräischen „vertreiben, austreiben“ heißt, die Dämonen in einer Anspielung auf das Römische Reich „Legion“ genannt werden und eines der Symbole für die römischen Truppen (Legio X Fretensis), die Jerusalem im Ersten Jüdischen Krieg eroberten, ein Eber war, als Allegorie ausgestaltet? In ähnlicher Weise fragen sich Gelehrte, die das wirkliche Leben Jesu rekonstruieren wollen: Unterbrach Jesus den Tempeldienst bereits zu einem frühen Zeitpunkt seines Lebens (Joh 2,15–16) oder erst zu Beginn seiner letzten Woche in Jerusalem (so die Synoptiker – s. Mt 2,12–13 // Mk 11,15–17 // Lk 19,45–46), oder tat er dies zweimal, wobei er jedes Mal etwas anderes sagte?
Ob man die Evangelien als „Geschichtsbücher“ versteht, hängt oft auch an der religiösen Einstellung des Auslegers oder der Auslegerin. Einige Leserinnen und Leser sind der Auffassung, dass die Wunder, die Jesus und seinen Nachfolgern zugeschrieben werden, genau so passierten wie von den Evangelien und der Apostelgeschichte beschrieben, während andere diese Berichte eher als moralische oder zeitgebundene theologische Erzählungen denn als historische Berichte ansehen. Die gleichen historischen Fragen kann man auch auf verschiedene jüdische Quellen anwenden: Soll man den Schöpfungsbericht am Anfang der Genesis einschließlich des Sechstagewerks wörtlich verstehen? Arbeitete Abraham als Kind in der Werkstatt seines Vaters, in der Götterbilder hergestellt wurden (BerR 38), oder wurde dieser Midrasch verfasst, um die Weisheit bereits des jungen Patriarchen zu verdeutlichen?
Wie man ein Evangelium lesen sollte
Jedes Evangelium erzählt seine eigene Geschichte und sollte daher auch individuell gelesen werden; erst im nächsten Schritt sollten die verschiedenen Berichte miteinander verglichen werden (die Kommentare geben häufig die Parallelstellen an). Solche Vergleiche arbeiten die verschiedenen Ansätze der einzelnen Evangelisten heraus und zeigen zugleich auf, wie dieselbe Geschichte verschiedene Botschaften transportieren kann, wenn sie auf unterschiedliche Weise erzählt wird. Einige werden bei ihrer Lektüre jeden einzelnen Abschnitt des jeweiligen Evangeliums auskosten wollen, Erzähleinheit um Erzähleinheit (der griechische Ausdruck für solche Einheiten ist perikopē, „um etwas herum schneiden“, „ausschneiden“); andere werden den ganzen Text in einem Durchgang lesen wollen. Manche werden erst den Text lesen und dann auf die Kommentare und die Essays, auf die querverwiesen wird, zurückkommen wollen; andere werden eine intensive und umfassende Lektüre bevorzugen, bei der sie jede Anmerkung und Erläuterung genau prüfen.
Einige Leserinnen und Leser sind möglicherweise mehr an Charakteren und Themen als an den Texten der Evangelien in ihrer rekonstruierten Abfolge interessiert. Sie könnten sich etwa auf die Beschreibungen der Apostel (auch als „die Zwölf“ bekannt), Marias, der Mutter Jesu, der zahlreichen Nebenfiguren (z.B. Nikodemus in Joh 3, die Samaritanerin in Joh 4, Maria und Martha in Lk 10 und Joh 11–12, Josef von Arimathäa) und der politischen Akteure (Herodes d.Gr., Herodes Antipas, Pontius Pilatus, Kaiphas und Annas) konzentrieren.
Angesichts der Konzentration dieses Bandes auf die jüdischen Kontexte und Inhalte des Neuen Testaments möchten andere Leserinnen und Leser sich vielleicht auch erst den Beschreibungen der jüdischen Feste (Sabbat, Pesach, Schawuot, Chanukka), Lebensregeln (z.B. Speisegebote, Synagogenbesuch und Toralesung, Reinheitsgebote, Pilgerfeste) und Gruppen (Pharisäer, Sadduzäer, Anhänger des Täufers Johannes) zuwenden.
Alle Leserinnen und Leser tun gut daran, sich bei ihrer Lektüre zu vergegenwärtigen, wie der erzählerische Kontext der Evangelien ihr eigenes Verständnis Jesu von Nazareth beeinflusst. Jesus polemisierte vermutlich gegen andere Juden: Dies taten im Laufe der Jahrhunderte aber auch Mose und Elia, Jesaja und Jeremia, Hillel und Schammai usw. In dem Augenblick jedoch, in dem die Worte Jesu Teil der Evangelien wurden und diese wiederum die Heilige Schrift einer bald mehrheitlich nichtjüdischen Kirche, wurden und werden ursprünglich innerjüdische Diskussionen allzu häufig aus ihrem historischen Kontext herausgelöst und als externe Verurteilungen des zeitgenössischen bzw. des ganzen Judentums gelesen. Ob bereits die Evangelien an und für sich anti-jüdisch waren, bleibt Gegenstand lebendiger Diskussionen; was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass sie von Christen bald anti-jüdisch interpretiert wurden. Wir verbinden mit diesem Buch die Hoffnung, dass es zu einer größeren Sensibilität aller Leserinnen und Leser beitragen möge, wie diese Texte im Laufe der Geschichte gewirkt haben, im positiven wie negativen Sinn. Ebenso hoffen wir, dass alle Leserinnen und Leser ungeachtet ihres religiösen Hintergrundes bei der Lektüre der Evangelien auch die jüdische Geschichte entdecken, die in ihnen enthalten ist, und die jüdischen Wurzeln der Bewegung erkennen, die später zur christlichen Kirche wurde.
Die Apostelgeschichte
Die Apostelgeschichte ist sozusagen die Fortsetzung des dritten Evangeliums, wie der Autor beider, der Evangelist Lukas, im Prolog seiner Schriften klarstellt. Die Apostelgeschichte folgt in mehrfacher Hinsicht auch dem Modell der Evangelien: Wie die Anmerkungen im Kommentarteil zeigen, führen Petrus und Paulus das Wirken Jesu weiter und dienen wie er als Rollenmuster für die Christusgläubigen. Dennoch ist die Apostelgeschichte kein Evangelium, sondern bildet eine eigene Gattung mit eigenen Quellen, die sie beeinflusst haben, und mit Verbindungen zu anderer Literatur der Antike.
Die Apostelgeschichte kann als eine Gestalt der antiken Geschichtsschreibung klassifiziert werden, in der man Lukas als Berichterstatter des Geschehens erkennen kann; dadurch kann sie mit anderen historiographischen Werken wie den Schriften Herodots und Thukydides‘ verglichen werden. Diese Sichtweise wird auch durch den Prolog des Evangeliums gestützt, in dem Lukas davon spricht, Quellen benutzt zu haben, um einen Bericht „in guter Ordnung“ zusammenzustellen (Lk 1,3). Einige Elemente in der Apostelgeschichte passen inhaltlich zu Materialien der Paulusbriefe (z.B. die Treffen zwischen Paulus und den Kirchenleitern der Gemeinde in Jerusalem [Gal 2 // Apg 15]), was manche Gelehrte zu der Annahme bringt, dass beide Quellen einander bestätigen und sie so gemeinsam eine zutreffende Geschichtsdarstellung bieten. Diese Position ist allerdings problematisch, da diese Ähnlichkeiten auch auf literarischer Abhängigkeit beruhen könnten und nicht auf einer voneinander unabhängigen Bezeugung von Fakten. Die Analogie zu Herodot und Thukydides ist auch kein Beweis für eine objektive Darstellung der Vergangenheit, da die Wissenschaft der klassischen Antike heutzutage mehrheitlich anerkennt, dass auch die antiken Historiker ihre Geschichten so präsentierten, wie sie sie ihren Leserinnen und Lesern vermitteln wollten. Das Gleiche gilt für die hellenistisch-jüdischen Zeitgenossen des Lukas wie z.B. den Geschichtsschreiber Josephus.
Anders als die klassischen griechischen Geschichtsschreiber schreibt Lukas in durchgängigem formellen wie inhaltlichen Bezug auf die Septuaginta. Er betrachtet die Ereignisse, die er im Evangelium und der Apostelgeschichte beschreibt, auf diese Weise als Teil einer „Heilsgeschichte“, eines Berichtes darüber, wie Gott die Bundesgemeinschaft rettet: Deshalb hat die Apostelgeschichte auch unauflösliche Bezüge zu den Geschichtsbüchern aus den Schriften Israels, wie den Samuel-, Könige- und Chronikbüchern sowie Esra und Nehemia. Die Bibelwissenschaft ist sich einig, dass auch diese Bücher keine reine Geschichtsdarstellung bieten. Mehr noch: Obwohl die Apostelgeschichte in den sogenannten „Wir-Berichten“, in denen der Autor Paulus auf seinen Reisen zu begleiten scheint (s. Apg 16,10–17; 20,5–21,18; 21,19–26,32; 27,1–28,16), den Eindruck eines Augenzeugenberichts erweckt, ist es unsicher, ob Lukas überhaupt persönliche Erfahrungen wiedergibt oder Zugriff auf einen Reisebericht hatte oder auch die erste Person Plural nur deshalb gebraucht, um dem Bericht Plausibilität zu verleihen.
Es existieren keine externen Quellen, die Lukas‘ Beschreibung der enthusiastischen frühen Jahre der christlichen Gemeinde in Jerusalem stützen könnten. Lukas schreibt wohl in Kenntnis der Paulusbriefe, auch wenn die Apostelgeschichte die Briefe nicht erwähnt und die Fachleute darüber streiten, ob er zu ihnen Zugang hatte. Wie das Lukasevangelium eine bestimmte Christologie vertritt, die von der bei Matthäus, Markus und Johannes verschieden ist, so vertritt auch die Apostelgeschichte eine bestimmte Sicht auf Paulus. Diese Charakterisierung des Paulus weicht von seiner Selbstdarstellung in seinen Briefen ab. Angesichts der Tatsache, dass Paulus sich einen Ruf als Redner gegen die Tora erworben hatte (s. „Paulus im jüdischen Denken“), „rehabilitiert“ die Apostelgeschichte Paulus, indem sie ihn wieder als loyalen Juden darstellt, der die Beschneidung praktiziert und an den Ritualen im Jerusalemer Tempel teilnimmt (z.B. Apg 16,1–3; 21,26).
Eine neuere, kontrovers diskutierte These zur Gattung der Apostelgeschichte ist, dass sie teilweise von antiken hellenistischen Liebesnovellen wie Charitons Chaereas und Kallirhoe und Xenophon von Ephesos‘ Ephesiaka inspiriert sei und sie somit nicht Geschichte (d.h. was wirklich passiert ist) wiedergebe, sondern vor allem unterhaltende Erzählliteratur mit einem lehrhaften Einschlag biete. Diese Klassifikation ihres Genres passt gut zu den apokryphen Apostelakten, die, wie die oben genannten apokryphen Evangelien, mehr unterhaltende und erbauliche Details über die handelnden Charaktere und Ereignisse in den kanonischen Schriften bieten. So erzählen die Akten des Paulus und der Thekla, ein Text aus dem frühen 2. Jahrhundert, die Abenteuer der Thekla nach, einer hübschen nichtjüdischen Frau, die ihrer Ehe entsagt, um Paulus zu folgen. In ähnlicher Weise in eine Botschaft der Enthaltsamkeit gekleidet, beschreiben die Thomasakten die christliche Mission Indiens durch den Apostel Thomas.
Ebenso wie diese späteren Texte, die schon durch ihren Titel („Akten/Apostelakten des/der …“) eine Beziehung zur kanonischen Apostelgeschichte herstellen, hat auch diese viele unterhaltende Facetten. Apg 14,8–18 z.B. erzählt die Missionsreise des Paulus und Barnabas nach Lystra, wo sie irrtümlich für Zeus und Hermes gehalten werden. Das Publikum des Lukas dürfte hier die Anspielung auf Ovids Legende von Philemon und Baucis (aus den Metamorphosen) wiedererkannt haben, die ebenfalls in Phrygien spielt. Apg 20,7–12 beschreibt einen jungen Mann namens Eutychus (gr. „der mit einem guten Schicksal“, „der Glückliche“), der während einer Predigt des Paulus einschläft, aus einem Fenster im Obergeschoss fällt und stirbt, nur um von Paulus wiederbelebt zu werden, welcher danach mit seinen Lektionen bis zum Morgen fortfährt (Apg 20,7–12). Diese Ähnlichkeiten sollen jedoch nicht heißen, dass alle Erzählungen in der Apostelgeschichte Fiktion sind.
Die Frage nach der Historizität der Apostelgeschichte stellt sich in ähnlicher Weise wie bei den Evangelien. Der Leser und die Leserin, die an Wunder glauben, werden die Wundergeschichten in der Apostelgeschichte vermutlich als Historie verstehen – von der Himmelfahrt Jesu (Apg 1,9) über zahlreiche Heilungswunder (z.B. Apg 3,1–8; 5,15–16; 8,6–7; 9,17–18.32–43; 10,38; 14,7–10; 16,16–18; 19,11–12; 20,9–12; 28,3–19) bis hin zu den Befreiungen aus dem Gefängnis durch Engel (Apg 5,22–23; 12,6–11; 16,26–27). Andere werden die Geschichten als literarische Mittel zum Zweck wahrnehmen, theologische Botschaften wie „Christus befreit aus allen Fesseln“ oder „Christus heilt“ zu verkündigen. Wieder andere werden diese Passagen als zeitgebundene Legenden verstehen, die in der frühen Gemeinde der Christusgläubigen aufkamen und die wenig oder gar nichts mit gegenwärtigen Ereignissen zu tun haben.
Auch hier erweist sich ein Vergleich mit Josephus als hilfreich, der ebenfalls behauptet, Geschichte zu schreiben. In seinen Jüdischen Altertümern (zu denen, wie manche behaupten, auch Lukas Zugang hatte,) verleiht Josephus seiner Absicht Ausdruck, die Geschichte des jüdischen Volkes nachzuerzählen. Wenn man jedoch Josephus mit seinen Quellen vergleicht, dann sieht man, dass er durchweg Details abändert, Material hinzufügt und das überlieferte Material kürzt oder anderweitig abändert, damit es seinen eigenen apologetischen Zwecken dient. Lukas tut wahrscheinlich das Gleiche: Sowohl die Evangelien als auch die Apostelgeschichte beruhen zwar auf historischen Zeugnissen, aber der Autor erzählt die Geschichte – wie jeder andere gute Autor in der Antike auch – auf die Art und Weise, dass er damit seine Zwecke am besten verfolgen kann. Gerade die Reden der Apostelgeschichte, wie die Reden in vielen anderen antiken „Geschichten“ – sind Kompositionen des Lukas, ebenso wie die berühmte aufrüttelnde Rede des Elasar ben Jair auf Masada vor dem Angriff der Römer (Bell. 7,339–388) von Josephus verfasst wurde. Bereits Thukydides selbst erkannte die Notwendigkeit an, solche Reden selbst auszugestalten, insofern sie dem angemessen waren, was hätte gesagt werden müssen (hist. 1,22,1).
In welchem Umfang die Evangelien und die Apostelgeschichte wiedergeben, „was wirklich geschah“, wird auch weiterhin umstritten bleiben – genauso, wie die Traditionen, die in den Schriften Israels aufgezeichnet worden sind, wie z.B. die Schöpfungsgeschichte und die Geschichte vom Garten Eden (Gen 1–3), der Exodus oder die Wunder, die Daniel und seinen jüdischen Freunden in Babylon widerfuhren, zumindest diskussionswürdig sind. Aber alle diese Materialien – gleich, ob sie im Tanach oder im Neuen Testament zu finden sind – sind eben mehr als einfache Annalen oder Ansammlungen von Details. Sie sind dazu gedacht, die Leserinnen und Leser zu inspirieren und in ihrem Glauben zu festigen; sie bieten programmatische Beispiele dafür, wie man handeln sollte; sie unterhalten und informieren zugleich.