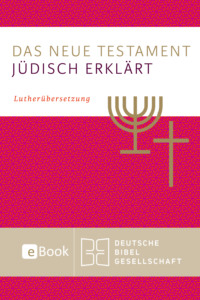Kitabı oku: «Das Neue Testament - jüdisch erklärt», sayfa 8
Matthäus 3
1 Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa 2 und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! 3 Denn dieser ist‘s, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat (Jesaja 40,3): »Es ist eine Stimme eines Predigers[*] in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige!«
4 Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden; seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. 5 Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan 6 und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden.
7 Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? 8 Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße! 9 Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. 10 Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum: Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
11 Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. 12 Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln; aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.
Mt 3,1–12 Johannes der Täufer (Mk 1,2–8; Lk 3,1–20; Joh 1,19–28) 3,1 Johannes der Täufer, eine bekannte Persönlichkeit, die in Teilen des Judentums bewundert wurde (Jos.Ant. 18,116–19). Täufer, aus dem Griechischen, bedeutet „eintauchen“ oder „untertauchen“ (vgl. „Taufe und Eucharistie“). Wüste von Judäa, westlich des Toten Meeres. 3,2 Tut Buße, ein prophetischer Ruf (z.B. Ez 18,30). Himmelreich, anders als im Markus- und Lukasevangelium, wo stattdessen „Reich Gottes“ verwendet wird; es handelt sich dabei entweder um eine Umschreibung, um die Heiligkeit des Namens Gottes zu wahren, oder um ein Indiz dafür, dass Matthäus das Königreich für einen tatsächlichen Ort im Himmel hält. Die früheste Verwendung dieser Formulierung könnte bereits in der Hebräischen Bibel vorliegen (vgl. Ps 103,19, der andeutet, dass der Thron des Herrn im Himmel ist.). Vgl. auch PesR 15,36, wo das „Himmelreich“ mit Sach 14,9 assoziert wird. 3,3 Jes 40,3: Ursprünglich geschrieben, um Juden im babylonischen Exil zu ermutigen, nach Judäa zurückzukehren. 1QS 8,12–14 kann auch so verstanden werden, als solle die Stimme in der Wüste lokalisiert werden. Die masoretischen Kantillationszeichen, die auch als Interpunktion dienen, beziehen in der Wüste eher auf den nachfolgenden Satzteil („In der Wüste bereitet“) als zum vorherigen. 3,4 Kamelhaare […] Gürtel, erinnert an Elia (2Kön 1,8; vgl. Mt 11,14; 17,11–13), der auch im Tanach als ein neuer Mose dargestellt wird. 3,6 Jordan, zu Reinigungsriten mit Wasser vgl. Jes 4,4; 44,3; Jer 4,14; Ez 36,25–27; Sach 13,1; Jos.Bell. 4,205; mJom 8,9. Bekannten ihre Sünden, vgl. tJom 2,1; vgl. auch jJom 8,9/45c; WaR 3,3. Zur Kraft des Jordans vgl. die Erzählung über Elisa, dem Jünger von Elia, in 2Kön 5,1–19. 3,7 Pharisäer und Sadduzäer, jüdische Strömungen (Jos.Bell. 2,164–65; Ant. 13,171–173.297–298; 17,42; 18,16–17). Vgl. „Strömungen innerhalb des Judentums in neutestamentlicher Zeit“. In Lk 3,7 richtet Johannes das Wort allgemeiner an eine Menschenmenge. Otterngezücht, man nahm an, dass sich neugeborene Ottern durch den Magen ihrer Mutter fressen und sie dadurch töten. Künftiger Zorn, eschatologisches Gericht. 3,8 Frucht, gute Werke; die Taufe allein ist nicht ausreichend. 3,9 Abraham, der Vater des jüdischen Volkes, vgl. Anm. zu 1,2, Gen 17,7; Spr 17,2; bJev 64b: „Schauet auf Abraham, euren Vater“. Zum Vater, vielleicht eine Bezugnahme auf das „Verdienst der Väter“ (hebr. sechut avot), also die Vorstellung, dass die guten Werke und Charaktereigenschaften der hebräischen Patriarchen das Gericht Gottes (zum Vorteil) des jüdischen Volkes beeinflussen würden; Mose fleht, dass Gott des Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob gedenkt (z.B. Ex 32,11–14). Steine […] Kinder, ein Wortspiel im Hebräischen (avanim […] banim – Steine […] Kinder). 3,11 Feuer, wurde zur Reinigung benutzt (Num 31,23; bSan 39a).
13 Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. 14 Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? 15 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er‘s ihm zu.
16 Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. 17 Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Mt 3,13–17 Jesu Taufe (Mk 1,9–11; Lk 3,21–22; Joh 1,29–34) 3,14 Johannes erkennt Jesu Hoheit. 3,15 alle Gerechtigkeit zu erfüllen, eine messianische Erwartung (Jer 23,5–6; 33,15–16; TestJud 24,1), vgl. Anm. zu 1,19. 3,16 Tat sich ihm der Himmel auf, Hinweis auf eine bevorstehende göttliche Offenbarung (Jes 63,19; Ez 1,1). Geist Gottes, Jes 11,2; 42,1; 61,1; bChag 15a. 3,17 Stimme aus dem Himmel, in der jüdischen Tradition ertönt die bat qol (hebr. „Tochter [der] Stimme“), eine himmlische Stimme, die Gottes Verkündigung oder Gericht repräsentiert, v.a. in der Periode nach dem Erlöschen der Prophetie (z.B. bBer 3a; bJom 9b; bSan 96b; bEr 13b; Targum Hoheslied zu Hld 2,12). Dies ist mein lieber Sohn, vgl. Dtn 14,1; 2Sam 7,14; Jes 42,1; Jer 31,9; Ps 2,7; zu der Verbindung von „Sohn“ und „geliebter“ vgl. die Bindung Isaaks (Gen 22,2) und Hos 11,1.
Gerechtigkeit
Das Matthäusevangelium betont die Vorstellung der Gerechtigkeit (Mt 1,19; 3,15; 5,10–11; 6,1.33; 9,13; 10,41; 13,43; 21,31–32; 22,14; 23,35; 25,46). Der Ausdruck selbst (gr. dikaiosynē; hebr. zedaqa wie im Begriff Zaddiq, Gerechter) beinhaltet in jüdischen Texten auch die Konnotation der Freigebigkeit gegenüber Armen oder des „Almosengebens“ (Dtn 14,22; 16,20) und darauf aufbauend jede Liebestat. Manche rabbinischen Traditionen betrachten Zedaqa (gerechtes Handeln) als wichtiger als alle anderen Gebote zusammen (bBB 9b) und betonen, dass jemand, der Zedaqa ausübt, die Welt mit Güte füllt (bSuk 49a). Bei Matthäus erweist sich Josef dadurch als ein „gerechter“ Mann, dass er sich von Maria in aller Stille trennen (Mt 1,19) und keinen Skandal produzieren will. Jesus verkörpert diese höhere Gerechtigkeit, indem er darauf besteht, dass Johannes ihn tauft (Mt 3,15), und sich so Johannes unterwirft. Seine Bergpredigt ist dadurch sehr jüdisch, dass sie vom Streben nach „Gerechtigkeit“, dem Leben in einer gerechten Beziehung sowohl mit anderen als auch mit Gott, durchdrungen ist (Mt 5,6.10.20; 6,33).
Der Gebrauch des Begriffs Gerechtigkeit bei Matthäus unterscheidet sich vom Sprachgebrauch bei Paulus (Röm 1,16f; 3,25f u.ö) (Anm. der Hg. der deutschen Ausgabe).

Matthäus 4
1 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. 2 Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. 3 Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. 4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben (Deuteronomium 8,3): »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.«
5 Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels 6 und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 91,11–12): »Er wird seinen Engeln für dich Befehl geben; und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« 7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben (Deuteronomium 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.«
8 Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 9 und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. 10 Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben (Deuteronomium 6,13): »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« 11 Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.
Mt 4,1–11 Die Versuchung Jesu (Mk 1,12–13; Lk 4,1–13) 4,1 Vom Geist … geführt, deutet an, dass Gott die Versuchung geplant hatte (z.B. Jes 63,14; Ps 107,7; auch 1Sam 16,13; 1Kön 18,12; 2Kön 2,16; Ez 3,14). Versucht, Jub 17,17 bemerkt, dass Abraham Glaubensprüfungen durchstanden hat, die unter anderem in der Form von Hunger, königlichen Reichtümern und der Beschneidung über ihn kamen (vgl. auch mAv 5,3, wo von zehn Versuchungen berichtet wird, denen Abraham widerstanden hat). Teufel, gr. diabolos, identisch mit hebr. satan, übers. „Ankläger“ (Num 22,22; Sach 3,1; Ps 109,6; Hiob 1,6; 1Chr 21,1; bSchab 89b; vgl. auch „Übernatürliche Wesen“). 4,2 Gefastet, Mose fastete, als er auf dem Sinai war (Dtn 9,9; vgl. auch Ex 34,28). Vierzig Tage und vierzig Nächte, erinnert u.a. an Noah, Mose, die Wüstenepisoden und Elia etc. (vgl. Gen 7,12; Ex 24,18; 34,28; Num 13,25; Dtn 8,2; 1Kön 19,8; Ez 4,6; Jona 3,4). 4,3 Sprich, dass diese Steine […], Num 20,8. 4,4 Dtn 8,3. Jesu Antworten stammen alle aus dem Deuteronomium, dem am häufigsten zitierten Buch der Tora im Neuen Testament, in den Schriften aus Qumran und in der rabbinischen Literatur. 4,6 Ps 91,11–12. 4,7 Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, die Autorität Gottes in Frage stellen, Dtn 6,16 (vgl. auch Num 14,22; Jes 7,12; Ps 95,9; Sir 3,16; 18,23; bSchab 32a). 4,8 Alle Reiche, das Angebot setzt voraus, dass die Welt unter der Kontrolle des Satans steht, vgl. Mt 20,28. 4,10 Dtn 6,13. 4,11 Da traten Engel herzu, Gott leistet den ihm Treuen entweder direkt oder durch göttliche Diener Beistand (Mt 13,41–42; 16,27; 18,10; 24,30–31; vgl. Gen 48,16; 1Kön 19,5–8; Hebr 1,14).
12 Da nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. 13 Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am Galiläischen Meer liegt im Gebiet von Sebulon und Naftali, 14 auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht (Jesaja 8,23; 9,1): 15 »Das Land Sebulon und das Land Naftali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, 16 das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen; und denen, die saßen im Land und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen.«
17 Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!
Mt 4,12–17 Beginn des Wirkens Jesu (Mk 1,14–15; Lk 4,14–15) 4,12 Gefangen, durch Herodes Antipas (vgl. Mt 14,3). Er [zog] sich nach Galiläa zurück, weit nördlich des Toten Meeres. Galiläa ist Jesu Heimat und ein zukünftiges Zentrum des rabbinischen Judentums (mMach 1,3; bEr 29a; bSota 45a; bQid 20a; bAr 30b). 4,13 Kapernaum, eine Stadt am nordwestlichen Ufer des Galiläischen Meeres (See Genezareth). 4,15–16 Jes 9,1. Galiläa der Heiden, „Heiden“ meint Nichtjuden. Zur Zeit Jesu war Galiläa allerdings überwiegend jüdisch; die Wendung könnte metaphorisch gemeint sein und dazu dienen, den Unglauben der Jüdinnen und Juden dieser Region zu verurteilen (Jos.Ant. 13,337; 18,37; Vit. 12–14; 65; 112–14; 128; 134; 190–92; 418). 4,17 Tut Buße, in Jesu Botschaft klingt die Verkündigung von Johannes dem Täufer an (vgl. Mt 3,2).
18 Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder; die warfen ihre Netze ins Meer; denn sie waren Fischer. 19 Und er sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach! Ich will euch zu Menschenfischern machen. 20 Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach.
21 Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. 22 Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach.
23 Und er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. 24 Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Qualen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte; und er machte sie gesund. 25 Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den Zehn Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans.
Mt 4,18–25 Die Berufung der ersten Jünger (Mk 1,16–20; Lk 5,1–11 ; Joh 1,35-51) 4,18 Simon, gr. Variante des hebr. Namens schim‘on, übers. „[Gott] hat gehört“. Petrus, gr. für „Stein“ (Mt 16,18). Es war für Jüdinnen und Juden jener Zeit nicht ungewöhnlich, sowohl einen hebräischen als auch einen griechischen (oder lateinischen) Namen zu führen (Apg 12,25). Andreas, der Name ist aus der gr. Wurzel für „mann-“ gebildet. Joh 1,44 gibt an, dass Petrus und Andreas aus Betsaida stammen. 4,23 Synagogen, Versammlungen, nicht zwangsläufig Gebäude (Mt 9,35; 10,17; 12,9; 13,54); vgl. „Die Synagoge“. Evangelium, gr. euangelion, die „gute Nachricht“. 4,24 Syrien, es gab dort einen großen jüdischen Bevölkerungsanteil (Jos.Bell. 2,461–68). Besessene, von einem dämonischen Geist ergriffen (Jos.Ant. 8,42–49). 4,25 Zehn Städte, gr. dekapolis; neun dieser Städte lagen östlich vom Jordan: Philadelphia, Gerasa, Gadara, Pella, Dion, Raphana, Damaskus, Kanatha, Hippos und Scythopolis; in bGit 7b wird dieses Gebiet als „Land der weltlichen Völker“ diskutiert.
Matthäus 5
1 Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. 2 Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach:
3 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.
4 Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.
5 Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen[*].
6 Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.
7 Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
8 Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
9 Selig sind, die Frieden stiften[*]; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
10 Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich.
11 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. 12 Seid fröhlich und jubelt; es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.
Mt 5,1–12 Die Seligpreisungen Gr. makarios, übers. „gesegnet, glücklich“ (vgl. „Seligpreisungen und Antithesen“). Ähnliche Seligpreisungen mit der Einleitungsformel „Wohl dem/glücklich, wer“ und analogen Themen wie Arme und Demütige finden sich im Psalter (Ps 2,12; 32,1–2; 40,5; 41,1–2; 65,5; 84,5–6; 94,12; 112,1 u.a.); vgl. auch Hiob 5,17; Dan 12,12; Sir 14,1–2; 4Q525. 5,1–2 Analog zu Mose entrinnt Jesus dem Tod, flieht nach Ägypten, steigt in Wasser, geht in die Wüste und erklimmt einen Berg (Ex 2,15; 5,1; 14,26–29; 19,3). 5,3 Selig sind, gr. makarioi, vgl. hebr. aschrej (z.B. Ps 1,1). Geistlich arm, demütig (Jes 61,1; 66,2; Zef 2,3; 1QM 14,7 verkündet, dass Gott „die demütigen Geistes sind“ retten wird. 5,4 Die da Leid tragen, beschränkt sich nicht nur auf die Totentrauer, sondern könnte auch leidende Gerechte sowie diejenigen einschließen, die wegen der Sünden der Gemeinschaft in Trauer sind. Es handelt sich um ein matthäisches Motiv (Mt 5,10–12; 7,15–22; 10,23; 13,53–58; 16,24–25; 19,28; 21,12–13; 24,9–10), das aber allgemein im Judentum verbreitet ist (Jes 61,1–3; 66,10; Tob 13,14). 5,5 Sanftmütige […] werden das Erdreich besitzen, im Hintergrund steht Ps 36,11 (LXX); der MT bekundet, dass die Sanftmütigen das „Land“ (hebr. erez) erben werden (Ps 37,11). Sanftmütige, Menschen, die ihre Position nicht ausnutzen (Jes 49,13; Ps 22,27; Spr 16,19; bSchab 30b; bNed 38a; PesR 36; Jos.Ant. 19,330; Philo Mos. 2,279). 5,6 Vgl. Anm. 1,19. (vgl. Jes 51,1–5; äthHen 58,2–3). 5,7 Barmherzige, erinnert an hebr. chesed, eine hoch angesehene Eigenschaft und einer der beiden Hauptaspekte Gottes (zusammen mit der Gerechtigkeit, vgl. Ps 145,9; bSchab 151b; WaR 33). 5,8 Vgl. Ps 24,3–4; WaR 23,13. Herz, galt als Zentrum des Denkens und der Überzeugung (Dtn 28,47; Jes 35,4; Spr 27,11). 5,9 Die Frieden stiften, die Rabbinen gingen davon aus, dass weise Menschen Frieden stiften wollen (bBer 64a; PesK 18,6–9). 5,10–12 Die Jünger werden gemeinsam leiden (vgl. Mt 10,23; 13,53–58; 16,24–25; 24,9–10; Röm 8,17; Offb 1,9; 20,4). 5,10–11 Um der Gerechtigkeit willen verfolgt, die Jesusgläubigen sahen sich von jüdischer ebenso wie von nichtjüdischer Seite mit Feindseligkeiten konfrontiert (vgl. 1Thess 2,2.14–15; 1Petr 3,14; 4,14; 5,8; vgl. auch Ps 37,11). Der Vers könnte auch auf die Jüdinnen und Juden verweisen, die lieber den Tod wählten, als eine schwere Sünde zu begehen. Das jüdische Konzept des kidusch ha-schem (übers. „Heiligung des Namens [Gottes]“) verfügt, man solle besser den Tod erleiden als Götzendienst, Unzucht oder einen Mord zu begehen (vgl. bSan 74a). 5,12 Vgl. Mt 23,30–37; Apg 7,52.
Seligpreisungen und Antithesen
Der Ausdruck „Selig sind …“ (gr. makarioi) kommt in der LXX 68 Mal vor, zumeist als Wiedergabe des hebräischen ’aschrej („glücklich sind …“); s. z.B. Ps 84,5: „Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar.“ Für die Seligpreisungen gibt es auch in inhaltlicher Hinsicht biblische Vorläufer. So könnten „Selig sind, die da geistlich arm sind“ (Mt 5,3) und „Selig sind, die da Leid tragen“ (Mt 5,4) von Jes 61,1–3 abhängig sein, wo ebenfalls von den Armen und den Trauernden gesprochen wird. „Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen“ ist eine Anspielung auf Ps 37,11 (LXX Ps 36,11; s.a. Jes 61,7). Der hebräische Text des Psalms spricht vom Erben des „Landes“ (ha-’ārez), was man als Anspielung auf das Land Israel sehen sollte. Die LXX und in ihrem Gefolge das NT liest gē, was entweder als „Land“ oder „Erde“ übersetzt werden kann. Die Übersetzung mit „Erde“ wurde von manchen Christen als Universalisierung eines Textes verstanden, der ursprünglich das Volk Israel mit seinem Stammland Israel verband. Das Eintreten für die, die „hungern“ oder „dürsten“, lässt Ps 107,5–6.9 anklingen (s.a. Ps 22,26); Spr 14,21LXX (s.a. Spr 17,5LXX) steht im Hintergrund der Sorge um die Barmherzigen. „Reinen Herzens“ erinnert an Ps 24,3–6 (s.a. Ps 73,1), wo ebenfalls auf das Land Bezug genommen wird; in dem Ausdruck klingt auch Ps 51,12 (LXX 50,12) an.
Kap.5 schließt mit einer Reihung von sechs Sprüchen, die wegen ihrer Form als Antithesen bekannt sind: „Ihr habt gehört, dass gesagt ist … Ich aber sage euch …“ (Mt 5,21–48). Manche Fachleute missverstehen diese Antithesen als Absagen an die Tora. Da Jesus jedoch kurz vorher festgestellt hat, dass er nicht gekommen sei, die Tora aufzulösen (Mt 5,17–20), ist dies allerdings bestimmt nicht gemeint. Vielmehr verschärfen diese Antithesen das Gesetz oder in jüdischer Begrifflichkeit: sie „errichten einen Zaun um die Tora“ (s. mAv 1,1), d.h. sie gebieten, ein Gebot oder Verbot deutlich über seine Mindesterfordernisse hinaus zu befolgen, um sicherzustellen, dass das Gebot selbst beachtet wird. Die „Zäune“ in den Antithesen betreffen sowohl die Einstellung als auch das Handeln: Um Mord und Totschlag zu wehren, zürnt nicht; um Ehebruch zu verhindern, begehrt nicht; um einem falschen Schwur vorzubeugen, schwört gar nicht, denn alle Aussagen eines Menschen sollten ehrlich sein. In zwei Fällen schlagen die Antithesen von Geboten in Verhaltensmaßregeln um: Erstens wandelt Jesus das Thema der Verstümmelung, das sich in „Auge um Auge“ (Mt 5,38) ausdrückt, in nicht-körperliche Verletzungen ab. Zweitens gibt es kein Gebot, seinen Feind „zu hassen“ (Mt 5,43); Spr 24 und 25 ordnen vielmehr seine faire Behandlung an. Auch hier wieder verschärft Jesus die Tora, indem er nicht nur gerechtes Verhalten gegenüber dem Feind gebietet, sondern die Feindesliebe.
13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt[*], womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten.
14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. 15 Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. 16 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Mt 5,13–16 Salz und Licht (Mk 9,49–50; Lk 14,34–35) 5,13 Salz, nach alten mesopotamischen Vorstellungen symbolisiert Salz Reinheit und Weisheit (Ex 30,35; 2Kön 2,19–22; Ez 16,4; bSota 49b). 5,14 Licht der Welt, Phil 2,15; Joh 8,12 verwendet das Epitheton mit Bezug auf Jesus; vgl. auch Jes 42,6; 49,6; 51,4–5; Spr 6,23; Dan 12,3; Sir 32,16; Joh 1,4–5; Tan 2. Die Schriften vom Toten Meer sprechen von den „Kindern des Lichts“, die auf der Seite Gottes stehen (vgl. 1QS 2,3; 3,3.19–21; 1QM 13,5–6.14–15). 5,16 Gute Werke, Matthäus besteht darauf, dass der Glaube immer von Taten begleitet wird (Mt 25,32–46).
17 Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. 18 Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. 19 Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich.
20 Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
Mt 5,17–20 Ansichten bezüglich der Tora 5,17 Gesetz, gr. nomos, in der LXX für hebr. tora. An dieser Stelle verweist der Begriff (in Verbindung mit „die Propheten“, gr. prophētēs) auf die Tora und die Nevi’im des Tanach (und nicht auf die Propheten selbst wie in V. 12); es wäre möglich, dass „das Gesetz und die Propheten“ ein Terminus technicus für den entstehenden jüdischen Kanon war. Nicht gekommen aufzulösen, der Jesus des MtEv hält an der Tora fest. Apg 6,13–14 vertitt die Ansicht, dass die Anschuldigung, Jesus habe die Tora aufgehoben, eine falsche Behauptung sei. 5,18Mk 13,31. Kleinste Buchstabe, gr. iota, für hebr. jod, der kleinste Buchstabe. Wenn selbst der kleinste Buchstabe nicht verändert werden kann, muss sicherlich auch der Rest der Tora auf dieselbe Weise aufrechterhalten werden. Tüpfelchen vom Gesetz, die rabbinische Lehre erlaubt nicht, auch nur einen Buchstaben der Tora zu verändern (jSan 2,6/20c; bSan 90a; SchemR 6,1, WaR 19,2). Das „Tüpfelchen“ bezeichnet den kleinsten Teil eines Buchstabens, der ihn von anderen unterscheidet. 5,19 Kleinsten Gebote, alle Gebote der Tora sind zu befolgen, egal wie scheinbar unbedeutend sie erscheinen mögen (vgl. Jak 2,10; mAv 2,1; 4,2; mQid 1,10; bNed 39b; bSchab 70b; ARN B 35). 5,20 Besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, ein hoher Anspruch, da die Pharisäer als rechtschaffene Menschen galten.
21 Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist (Exodus 20,13; 21,12): »Du sollst nicht töten«; wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. 22 Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt: Du Nichtsnutz!, der ist des Hohen Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr!, der ist des höllischen Feuers schuldig.
23 Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, 24 so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe.
25 Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. 26 Wahrlich, ich sage dir: Du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast.
27 Ihr habt gehört, dass gesagt ist (Exodus 20,14): »Du sollst nicht ehebrechen.« 28 Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen.
29 Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf‘s von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. 30 Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre.
31 Es ist auch gesagt (Deuteronomium 24,1): »Wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben.« 32 Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht; und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe.
33 Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist (Levitikus 19,12; Numeri 30,3): »Du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten.« 34 Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron; 35 noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße; noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. 36 Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören; denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. 37 Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen.
38 Ihr habt gehört, dass gesagt ist (Exodus 21,24): »Auge um Auge, Zahn um Zahn.« 39 Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern: Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. 40 Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. 41 Und wenn dich jemand eine Meile nötigt[*], so geh mit ihm zwei. 42 Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will.
43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen Nächsten lieben« (Levitikus 19,18) und deinen Feind hassen.[*] 44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen,[*] 45 auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.
46 Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? 47 Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? 48 Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Mt 5,21–48 Antithesen Die übliche Bezeichnung „Antithesen“ (wörtl. „Gegensätze“) für diese sechs Lehrsprüche ist irreführend; manche dieser Sätze stellen keine entgegengesetze Lehrmeinung, sondern eine Zuspitzung dar (vergleichbar zum Prinzip „einen Zaun um die Tora [machen]“; vgl. mAv 1,1). 5,21 Du sollst nicht töten, Ex 20,13; Dtn 5,17. Wer aber tötet, vielleicht eine Paraphrase von Gen 9,6; Ex 21,12. Gericht, ein Todesurteil für Mord konnte nur von einer jüdischen Instanz ausgesprochen werden (Dtn 16,18; 21,1–9). Die Rabbinen erörtern die nötigen Verfahrensschritte für Zivil- und Strafrechtsprozesse, vgl. mSan 1,4; bSan 35a; 72a-b. 5,22 Du Nichtsnutz, Beleidigungen konnten eine strafbare Handlung sein (z.B. konnte das jüdische Gericht eine Person, die ihren Lehrer beleidigt hatte, aus der Gemeinschaft ausschließen; vgl. bBer 19a; vgl. auch bBM 58b). Hoher Rat, gr. synhedrion, hebr. sanhedrin, verweist allgemein auf das jüdische Gerichtswesen, wobei sich Sanhedrin auch konkret auf den obersten Gerichtshof in Jerusalem beziehen könnte (Mt 26,57). Aber auch Bezugnahmen auf ortsansässige Gerichte sind üblich, vgl. mMak 1,10; mSan 1,6; tSan 1,7). Höllisch, Hölle, gr. gehenna, abgeleitet vom hebr. gehinnom, dem Namen eines Tales südlich von Jerusalem, das mit Kinderopfern assoziiert wurde (2Kön 23,10; Jer 7,31; 2Chr 28,3; 33,6). In neutestamentlicher Zeit wurde gehinnom aufgrund seines düsteren Rufs mit dem Purgatorium und/oder der Hölle in Verbindung gebracht, wo – nach manchen Überlieferungen – die Gottlosen nach dem Tod gefoltert werden (vgl. Mt 25,41; die Rabbinen erwähnen Gehenna als Ort des ewigen Feuers, wo Frevler und Feinde bestraft werden; vgl. bEr 19a; bSan 110b; bPes 54a; bBer 8b). 5,23–24 Auf dem Altar, Matthäus setzt voraus, dass die Menge, zu der Jesus spricht, am Tempelopfer teilgenommen hat; vielleicht handelt es sich auch um eine Anspielung auf Gen 4 (Kain und Abel). 5,24 Versöhne dich, im Judentum wurde gefordert, zuerst Frieden mit dem Nächsten zu schließen, bevor eine Versöhnung mit Gott möglich ist (Spr 6,1–5; 16,7; mAv 3,10: „Jeder, durch den sich der Geist der Menschen beruhigt, durch den beruhigt sich der Geist des Ortes [=Gottes]“; vgl. auch mJom 8,9; BerR 93,1). 5,25–26 (Lk 12,57–59) Vgl. Spr 6,1–5. 5,27 Ehebrechen, Ex 20,14; Lev 20,10; Dtn 5,18. 5,28 Begehren, in jüdischen Quellen zeigt sich eine tiefe Verachtung gegenüber diesem Vergehen (z.B. Hiob 31,1.9; Sir 9,8; 23,18–28; 41,21; bBer 16a; WaR 23,12 [zum ehebrecherischen Auge]; 11QT 59,14). 5,29–30Mk 9,43–48, wiederholt in Mt 18,8–9. Hau sie ab, es handelt sich um hyperbolische Sprache. 5,31 Scheidebrief, hebr. sefer keritut, Dtn 24,1–4; vgl. Mt 19,9. 5,32 Unzucht, gr. porneia (vgl. Mt 19,3–9; vgl. auch Mk 10,2–12; Lk 16,18; 1Kor 7,11–13), umfasst mehr als Ehebruch; vgl. z.B. Ehen, die in Levitikus als inzestuös gelten (Lev 18,6–18). Die Sexualethik Jesu ist strenger als in den meisten Strömungen des frühen Judentums; vgl. aber 11QT 57,17–19; CD 4,12–5,14 (dort wird Gen 2 als Verbot von Wiederheirat und Polygamie ausgelegt); vgl. auch mNed 11,12; bSan 22a und Fragen zu Scheidung und Tod, v.a. mit Blick auf die erste Frau. 5,33Falschen Eid schwören, Paraphrase von Ex 20,7; Lev 19,12; Num 30,3–15; Dtn 5,11; 19,16–21. 5,34 Überhaupt nicht schwören, vgl. Pred 5,4 („Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst“) und Jak 5,12. Manche Rabbinen verboten bestimmte Schwüre (z.B. mNed 1,3 über verbindliche Gelübde; mSan 3,2 weist darauf hin, dass manche Eide – in diesem Fall in Bezug auf Schulden – widerrufen werden können). Gottes Thron, vgl. Mt 23,22; Hebr 12,2; Offb 7,15; 22,1–2. 5,35 Jes 66,1. 5,37 Vgl. bBM 49a (mündliche Zusagen und Verträge können als gültig anerkannt werden); RutR 7,6. 5,38 Auge um Auge, Ex 21,23–25; Lev 24,19–20; Dtn 19,21; 11QT 61,10–12; Jub 4,31–32; LAB 44,10; vgl. Lk 6,27–36); mBQ 8 verfügt die finanzielle Kompensation solcher Verletzungen. 5,39–40 Vgl. 1Thess 5,15. Jesus wird geschlagen und seiner Kleider beraubt werden (Mt 26,67; 27,35). Rechte Backe, nimmt einen Schlag mit der rechten Hand an. Biete die andere auch dar, antworte weder mit Gewalt noch mit Unterwürfigkeit (vgl. auch Klgl 3,30). Lass auch den Mantel, die meisten Menschen besaßen nur zwei Kleidungsstücke; sich komplett zu entblößen würde die Ungerechtigkeit der Justiz aufdecken. 5,41 Eine Meile, römische Soldaten hatten das Recht, Einheimische einzuziehen, damit diese ihre Ausrüstung für eine Meile trugen: Die zusätzliche Meile verdeutlicht die fehlende Gegenwehr. 5,42 Gib dem, der dich bittet, die Tora fordert das Geben von Almosen (Ex 22,25; Lev 25,36–37; Dtn 15,7–11). 5,43 Deinen Nächsten lieben, Lev 19,18; vgl. „Der ‚Nächste’ in der jüdischen und christlichen Ethik“. Deinen Feind hassen, kein biblischer Text beinhaltet diese Aussage; vgl. aber 1QS 9,21, wo es gutgeheißen wird, Frevler zu hassen. 5,44 Liebt eure Feinde, im Judentum ist es nicht gestattet, Feinde schlecht zu behandeln, vgl. Spr 24,17; 25,21-22; Jos.Apion. 2,211. 5,45 Vgl. Lk 6,35; 10,6; Joh 8,39. Kinder eures Vaters, vgl. Joh 1,12; Röm 8,14–15; Gal 3,26–27; 4,5; Eph 1,5. Auch jüdische Quellen beschreiben Gott mit elterlichen Begriffen (2 Sam 7,14; Ps 82,6; 1Chr 22,9–10; bQid 36a lehrt, dass Jüdinnen und Juden sich verhalten sollen wie „Söhne des Herrn, eures Gottes“; vgl. auch SchemR 46,4). 5,46 Zöllner, Beauftragte Roms; für Matthäus diejenigen, die die Verkündigung des Evangeliums nötig haben (Mt 9,10–14; 11,19; 18,17; 21,31–32). 5,48 Vgl. Lk 6,36; Röm 12,2; Kol 3,13; 1Joh 4,19. Vollkommen sein, gr. teleios, beinhaltet Weisheit und Reife, vgl. Mt 19,21; Jak 1,4; 3,2; vgl. auch Lev 19,2; Dtn 18,13 (und die Targumim); 1QSa 1,8–9.13; 2,1–2; 8,9–10; MTeh 119,3. Lk 6,36 fordert von den Jüngern Barmherzigkeit. In jüdischer Tradition könnte der hebr. Begriff tamim (übers. „vollkommen, tadellos“; vgl. Gen 6,9, wo Noah „ohne Tadel“ ist) die vollkommene Ausrichtung auf Gott bedeuten, was jedoch nicht notwendigerweise volle moralische Vollkommenheit einschließt. Vgl. „Jesus in der rabbinischen Tradition“.