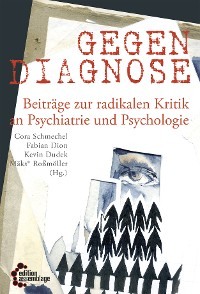Kitabı oku: «Gegendiagnose», sayfa 4
Psychiatrie heute: viele Eingänge, kein Ausgang?
Die Psychiatrie in Deutschland hat sich seit den 1970er Jahren nach Fachgebieten und Behandlungsformen ausdifferenziert, die Zahl der psychiatrischen Institutionen hat sich mehr als verdoppelt. Zahlreiche kleinere, an bestimmte Diagnosen, Zielgruppen, Lebenswelten angepasste Einrichtungen sind entstanden: anstelle einer De- fand eine Transinstitutionalisierung statt. Die nun ins allgemeine Gesundheitswesen integrierte Klinik bleibt im Zentrum des Systems, wird aber zur Akutpsychiatrie transformiert und soll primär der Krisenintervention dienen: die ›Kranken‹ werden nicht mehr zeitlebens weggesperrt, sondern sollen ›aktiv mitwirken‹ an ihrer eigenen, möglichst schnellen ›Genesung‹, indem sie den Prozess der medizinisch-diagnostischen (Selbst-) Verdinglichung widerspruchslos akzeptieren. Die Drohung des psychiatrischen Souveräns mit dem jederzeit abrufbaren klinischen Ausnahmezustand – Einweisung, Fixierung, bloßer Zwang – schwebt über allen Betroffenen des psychiatrischen und psychosozialen Systems. Aufgrund der klinischen Liegezeiten findet die dauerhafte Verwahrung der Aussortierten und Unnützen nun vorwiegend in Heimen inner- und außerhalb des eigentlichen psychiatrischen Gebietes oder in der Forensik statt. Zugleich hat sich die Gemeindepsychiatrie für die Klient_innen zur Psychiatriegemeinde mit meist langen Betreuungszeiten entwickelt. Trotz der kontinuierlichen Schaffung neuer, angeblich klientenzentrierter Leistungstypen – Betreutes Einzelwohnen für Autist_innen hier, Krisenintervention bei schwangeren Migrant_innen dort – wirkt sie normierend, hospitalisierend und paternalistisch: »[E]ine Transformation der Umstände der Entmündigung [hat sich] vollzogen, von der entrechtlichten zur verrechtlichten, auf einem Vertragsabschluß beruhenden Entmündigung.« (Hellerich 1988: 59) Der Sozialpsychiatrische Dienst registriert als staatlich-psychiatrisches Auge und Ohr präventiv Abweichungen und steuert mit weiteren Behörden und Gremien den gemeindepsychiatrischen Sektor; die gesetzlichen Betreuer_innen verwalten die Psychiatrisierten, die nicht mehr gesellschaftsfähig sind. Vorwiegend für sogenannte leichte und mittelschwere Fälle wird eine sich ausweitende Palette von ambulanten Psychotherapien angeboten, die sanfte psychologische Anpassung verheißen. Zugleich wurden auch die stationären psychiatrischen Settings durch die Anstellung von Therapeut_innen zunehmend psychologisiert, das heißt ein psychiatrischer Zugriff auf zuvor private Emotionen und Verhaltensweisen erschlossen. Aus dem Wunsch nach Alleinsein wird nun eine pathologische, zu behebende Kontaktschwäche, aus Nicht-Mitmachen eine manifeste, zu therapierende Hemmung etc. Franco Basaglia kritisiert diesen therapeutischen Prozess als »politische[n] Akt der Integration, insofern als er versucht, eine bestehende Krise – regressiv – wieder zurechtzubiegen, indem er letztlich das hinnehmen lässt, was die Krise überhaupt erst verursacht hat« (Basaglia 1971: 138). Nicht zuletzt aufgrund der quantitativen und qualitativen Ausweitung der psychiatrischen Diagnosen schreitet die Medikalisierung der Gesellschaft11 hin zur Bedarfsmedikation für alle voran. Gefühlszustände, die im Fordismus noch als normal galten, werden »als ›krank‹ und ›behandlungsbedürftig‹ einem umfassenden pharmazeutisch-therapeutischen Normalisierungsregime« (Graefe 2011) unterworfen. Die Pharmakolisierung bedeutet dabei die »absolute Verdinglichung des Patienten, die krasseste Form der Behandlung einer Sache« (Hellerich 1988: 65) – Symptome werden nicht erfasst, um sie zu verstehen, sondern allein, um sie chemisch zu beseitigen.
Entsprechend der Forderung der Enquête, den Blick »von den Kranken auf die viel größere Zahl der Gesunden und möglicherweise Gefährdeten [zu] richten und […] vom Einzelindividuum […] auf ganze Gruppen und Bevölkerungsteile, bis hin auf die Gesellschaft als Ganzes« (Deutscher Bundestag 1975: 385), wurde ein neuartiges psychiatrisch-therapeutisches Präventionsregime erschaffen. Zwischen einem Drittel und der Hälfte der Bevölkerung hätten im Laufe ihres Lebens eine behandlungsbedürftige ›psychische Krankheit‹, verlautbaren Politik und Gesundheitswesen unisono. Staatlicherseits werden daher – neben den schon erwähnten Sozialpsychiatrischen Diensten und vorgelagerten Beratungsstellen – Kampagnen unter dem Motto ›Vorbeugen statt heilen‹ aufgelegt. Tatsächlich geht es weniger um eine vorbeugende Verbesserung der Lebensumstände, sondern mehr um das Registrieren einer Prä-Devianz. Schon ›Anzeichen einer Störung‹ können zu sozialpsychiatrischen Begutachtungen und weiteren Eingriffen führen, die von einer Antragsstellung der Betroffenen unabhängig sind: Prävention erhält damit den Status einer »Zuführungsfunktion zum vorhandenen Versorgungssystem« (Reichel 1983: 99). Diagnosenspezifische Kompetenznetze schulen Hausärzt_innen, Altenpfleger_innen, Lehrer_innen und Betriebsräte und animieren sie, Auffällige in Früherkennungszentren zu überweisen. Durch Hirnforschung und Humangenetik weitet sich Prävention auf Potentialitäten aus, die angeblich im Körper jeder Einzelnen schlummern können. Die Psychiatrie ist damit aus dem gesellschaftlichen Schattendasein der alten Anstalt getreten, zu Teilen enttabuisiert und weit in die soziale und geografische Mitte gerückt, und zwar »vom Paradigma der Internierung zum allgemeinen Interventionismus« (Castel 1983: 308). Anstatt einer Minderheit von ›Verrückten‹ steht die ganze Bevölkerung, segregiert in einzelne Risikopopulationen, im Fokus. Zusätzlich zu dem ärztlich dominierten Panoptikum der Klinik und des Heims hat sich ein multiinstitutionelles und interdisziplinäres Kontrollregime entwickelt, das in den gemeindepsychiatrisch durchdrungenen Sozialraum – den Stadtteil, die Nachbarschaft, den Betrieb und die Familie – ausgreift. Wenn es auch vorwiegend Sozialarbeiter_innen, (Haus-)Ärzt_innen und Pädagog_innen sind, die für die Frühregistrierung und die Nachsorge zuständig sind, so kann doch jede_r Bürger_in zur potentiellen psychiatrischen Zuträger_in werden – sei es durch eine Mail an den Sozialpsychiatrischen Dienst, durch die Anregung einer Betreuung oder einen Anruf bei der Polizei.
Auch auf der Ebene der psychiatrischen Strukturen selbst hat eine scheinbare Öffnung stattgefunden: unter den Schlagwörtern des Trialogs und der Partizipation werden Betroffene und Angehörige in Gremien einbezogen, sogenannte Patientenorientierung gilt als »zentraler Unternehmenswert« (Kohler 2013) und Inklusion wird »große volkswirtschaftliche Bedeutung« (Wagner 2013) beigemessen. Betroffene werden als Genesungsbegleiter_innen in manchen Kliniken angestellt als Vorbild für jene, die krisenbedingt von der Norm abfallen und, wie es eine Sozialpsychiaterin formuliert, zum »tieferen Verständnis für […] psychische Krankheit« (Amering 2013). Sie dienen damit lediglich als kostengünstiges Add-On, an den psychiatrischen Strukturen und Zielen ändert sich nichts Grundlegendes. Eine Opposition gegen ein solchermaßen integratives System, das sich sogar kompatible Teile des Wissens und der Erfahrungen Betroffener zu eigen macht, fällt offenbar schwer. So stellt sich die früher mitunter radikale Selbsthilfe-Bewegung stark entpolitisiert dar, weite Teile sind – gefördert durch die Reformpsychiatrie und die Pharma-Industrie – in nach Diagnosen spezifizierten und professionell angeleiteten Gruppen geendet.
Der massiv erweiterte Anspruch der reformierten Psychiatrie ›abgestimmte Versorgungspfade‹ zu bahnen und ›Versorgungslücken‹ zu vermeiden, bildet sich nirgends so deutlich ab wie in der häufig gebrauchten Metapher des psychiatrischen Netzes, durch das niemand fallen soll. Gerhard Mutz schreibt dazu: »[D]ie Kontrollinstanzen werden verlängert und das Netz der sozialen Kontrolle erweist sich als engmaschiger, da es bereits in alltäglichen Lebensbereichen wirksam wird, die bisher durch die Ideologie der Normalität vor staatlichen Kontrollmaßnahmen relativ geschützt waren.« (Mutz 1983: 263f.) Die Kontrollfunktionen wurden so verfeinert, dass die geschmeidigen psychiatrischen Strukturen eine »enge Verbindung mit dem sozialen Leben der Devianten« (Hellerich 1985: 161, zit. n. Balz/Bräunling/Walther 2002: 4) eingehen. Die Konsequenzen für Betroffene in der Gemeindepsychiatrie beschreibt Hannelore Klafki: »Einmal im psychosozialen Netz gefangen, gibt es so für die meisten Menschen kein Entkommen mehr. Was ursprünglich ein Netz von Hilfeangeboten sein sollte, erweist sich auf Dauer als ein Netz, in dem Betroffene hängen bleiben.« (Klafki 2003) Das psychiatrische Netz umfasst gerade durch seine Sektorierung vielschichtige, aufeinander abgestimmte Komponenten, ganze Behandlungsketten, die je nach Subjekt und Lebenslage auf Freiwilligkeit oder Zwang, ambulante oder stationäre Settings, kurze oder lange Verweildauer angelegt sind. Integrative Maßnahmen der Gemeindepsychiatrie, die sogenannte Teilhabe ermöglichen sollen und damit auch den Verbleib auf dem ersten Arbeitsmarkt, stehen neben exkludierenden Komponenten wie Einweisung, Heimaufnahme oder starker medikamentöser Sedierung. Nicht zuletzt für das Gelingen der rehabilitativen Maßnahmen ist das System darauf angewiesen, eine Binnendifferenzierung vorzunehmen und sogenannte schwierige Fälle von der Re-Integration auszuschließen. Beide Facetten verbinden sich somit zu einem flexiblen, tendenziell niedrigschwelligen und proaktiven System, das fallbezogen auf Einschluss oder Ausgrenzung steuern kann. Gesprächsangebot und Fixierung, Trialog und Autorität, offenes Setting und straffe Sanktionierung bilden eine mitunter widersprüchliche, aber funktionale Einheit. Gerhard Mutz sieht die Stärke des psychiatrisch-psychosozialen Systems darin,
dass beide Pole – Integrations- und Desintegrationsprozesse – ein einheitliches Ganzes bilden, in dem die einzelnen Elemente ineinander verschachtelt sind, sich ergänzen, überlagern und selbst wenn sie miteinander rivalisieren, wie beispielsweise Sozialpsychiatrische Dienste und Anstalten, innerhalb dieses Gesamtkomplexes gleichzeitig funktionieren, indem sie als Normalisierungsinstanzen das Feld zwischen Norm und Abweichung regulieren und kontrollieren (Mutz 1983: 328).
Balz/Bräunling/Walther (2002: 4) verorten in der »Pharmakolisierung das Bindeglied dieses Transformationsprozesses«: die Psychopharmaka sind demnach die konstitutive Bedingung für den Wandel von der unipolar-internierenden zur multipolaren Einschluss-Ausschluss-Psychiatrie.
Von der Anstalt zur Vielfalt: Psychiatrie im Postfordismus
Die Transformation der Psychiatrie in Deutschland ist nicht zu verstehen ohne die gesellschaftlichen Veränderungen seit den 1970er Jahren. Mit dem Übergang vom fordistischen zum postfordistischen Akkumulationsregime haben sich wesentliche Parameter der Produktion und Reproduktion verschoben. Die Fabrik als zentrales Paradigma des Fordismus war der Massenproduktion von standardisierten Konsumgütern verpflichtet. Entsprechend zeichnete sich die Produktionssphäre in weiten Teilen durch monotone Tätigkeiten, eine stark hierarchische Strukturierung und evidente Fremdbestimmung aus. Salopp gesagt: das Gehirn musste am Fabriktor abgegeben werden, das Fließband übernahm das ›Denken‹, eine entfaltete Subjektivität war für den Produktionsprozess nicht vonnöten, oftmals sogar störend. Wo das Band stockte, griff der Vorarbeiter oder Meister ein. Dem entsprachen tradierte autoritäre Strukturen im öffentlichen Leben – in der Politik, Schule, Kirche, im Verein und Dorf – und eine patriarchal organisierte Familie mit einer stark vergeschlechtlichten Rollenaufteilung. Zugleich wurde von der sozialen Marktwirtschaft unter der Losung ›Wohlstand für Alle‹ ein Glücksversprechen ausgegeben, das in der Beteiligung der Mehrheit am Massenkonsum ein materielles Substrat hatte. Als soziales und politisches Subjekt agierte im Wesentlichen jedoch der ›deutsche‹, nichtjüdische und heterosexuelle Mann – Frauen, Homosexuellen, Migrant_innen, Menschen mit Behinderung wurde lediglich ein eingeschränkter Subjektstatus zugesprochen, in der bürgerlichen Öffentlichkeit waren sie nur mit Abstrichen oder gar nicht präsent. So wurden beispielsweise sogenannte Gastarbeiter_innen in den 1960er Jahren nach Deutschland geholt – eine politische oder betriebliche Mitbestimmung war für sie aber undenkbar, sie waren reines Objekt der Ausbeutung im Niedriglohnsektor. Entsprechend dieser normativexkludierenden Leitkultur wurden Menschen mit psychiatrischen Diagnosen als eigene besondere Gruppe konstituiert, die weit jenseits der Normalität angesiedelt war. Als ›Verrückte‹ oder ›Geisteskranke‹ radikal ausgegrenzt, wurden sie in die Anstalt und damit quasi in das Außen der Gesellschaft, verwiesen – maximal der ›Dorftrottel‹ konnte im sozialen Raum verbleiben. Da kein gesamtgesellschaftliches Interesse an ihrer Verwertung bestand, mussten für sie auch keine aufwändigen Settings und Angebotsstrukturen zur Rehabilitation geschaffen werden. Wie abgeschottet die damalige Psychiatrie funktionierte, zeigt sich auch daran, dass die meist unbezahlte, überausgebeutete Arbeitskraft ihrer Insass_innen – etwa als Küchenhilfen oder Landarbeiter_innen auf den klinikeigenen Ackerflächen – wesentlich den Anstalten selbst zugutekam und nicht in die reguläre Marktökonomie eingespeist wurde.
Zwischen dieser Form der Anstalt, die noch in den 1960er Jahren starke kloster- und gefängnisartige Züge trug, und der heutigen reformierten Psychiatrie mit ihren Mischformen aus ambulanten und stationären Settings liegt die postfordistische Transformation der Gesellschaft. Die Fabrik wurde weitgehend in die Peripherie des Weltmarktes ausgelagert, während in Deutschland wie generell in den kapitalistischen Zentren der Dienstleistungssektor seinen Siegeszug antrat. Harte körperliche Lohnarbeit wurde zurück-, wenn auch nicht komplett verdrängt. Stattdessen haben sich Formen der immateriellen Lohnarbeit verbreitet, bei denen kommunikative und subjektive Kompetenzen gefragt sind. Das widersprüchliche Leitbild der hoch engagierten, lebenslang lernenden und selbstverantwortlichen Teamplayer_innen korrespondiert mit realiter flacheren Hierarchien, erhöhtem Arbeitsdruck, zum Teil sinkenden Löhnen und einem abgebauten Sozialstaat. Von einer Burnout-Kritik in der Folge von Alain Ehrenbergs »Das erschöpfte Selbst« (Ehrenberg 2004), die von der Gouvernementalitätstheorie12 inspiriert ist, wird auf die zunehmende Überforderung der Subjekte hingewiesen. In Arbeitswelt wie im Privatleben seien sie zu andauernder Selbstinitiative, -management und -kontrolle angehalten, als »Arbeitskraftunternehmer_innen« (vgl. Voß/Pongratz 1998) seien die Subjekte der »ruhelosen Gehetzheit moderner Arbeitsverhältnisse« (Neckel/Wagner 2013: 16) ausgesetzt und müssten sich im Wettbewerb andauernd neu inszenieren und positionieren. Zum einen würden ihre Subjektivität und Sozialkompetenz betrieblich vernutzt, zum anderen müssten sie sich stärker als aktiv handelnde, den Arbeitsprozess steuernde Subjekte einbringen. Die räumlich-zeitliche Entgrenzung, Flexibilisierung und Prekarisierung des Arbeitslebens gehe mit einer Ausweitung von Diagnosen(-stellung), des psychotherapeutischen Marktes und der Psychopharmakaverabreichung einher. Betroffen seien vorwiegend Angestellte in Dienstleistungs- und Verwaltungsberufen und dem sozialen Sektor. Deren ›Störung‹ drückt sich nach Alain Ehrenberg nicht wie noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Ergebnis eines Widerspruchs zwischen Individuum und repressiver Disziplinargesellschaft in Form der ›Neurose‹ aus. Stattdessen herrsche ›Erschöpfung‹ und ›Burnout‹ als Selbstleiden ohne Bezugnahme auf einen evidenten Konflikt. Diese eher akademisch daherkommende Kritik fokussiert meines Erachtens wesentlich auf die ›Depression‹ der Mittelschicht und blendet weite Teile des psychiatrischen Systems und den unmittelbaren Zwang der Kliniken und Heime aus. Dennoch verweist die Burnout-Kritik auf einen wichtigen Punkt, indem sie einen Zusammenhang zwischen psychologischpsychiatrischem Diskurs, dem postfordistischen Wandel der Produktionsverhältnisse und der sozialen Beziehungen herstellt.
Mit der zunehmenden Auflösung der Grenze zwischen Produktion und Reproduktion geht tatsächlich ein immer direkterer Zugriff auf die vorher privatisierten Facetten der Subjekte einher: das Subjektive und Emotionale wird weitestgehend in Verwertungsprozesse einbezogen. Die Flexibilisierung der Produktion – ›just in time‹, ob in Büro, Agentur oder Verwaltung – geht mit einer Flexibilisierung der sozialen Beziehungen einher: trotz einer ideologischen Retraditionalisierung und Refamilialisierung steht de facto vermehrten lockeren Kontakten die Abnahme lebenslanger Bindungen entgegen. Die klassische Kleinfamilie hat an Einfluss verloren, in einer Stadt wie Berlin etwa besteht heute die Mehrzahl der Haushalte aus einer Person.13 Patriarchale Arbeitsteilung existiert dennoch in gewandelter Form fort und hat sich für viele Frauen durch die Doppelbelastung aus Beruf und Familie teilweise noch verschärft. Mit der Atomisierung und Individualisierung geht auch eine Ausdifferenzierung von Milieus und Subkulturen einher. Ideologisch und teilweise de facto fand in den letzten Jahrzehnten ein auch durch soziale Bewegungen erkämpfter integrativer Prozess statt: Migrant_innen, Homosexuellen und Menschen mit Behinderungen wurden vermehrt nicht nur juristisch, sondern auch politisch und sozial als Subjekte anerkannt. Damit gingen teils verbesserte Rechtsansprüche und partiell erleichterter Zugang zu sozialen Ressourcen und zum Arbeitsmarkt einher. Dieser Integrationsprozess steht im Zeichen des Kapitals, das durch die vollzogene globale Expansion an seine äußeren Grenzen gestoßen ist und daher eine intensivierte innere Kapitalisierung vorantreibt. Die kapitalistische Zentrifuge scheint immer schneller zu rotieren: jeder Winkel der Gesellschaft wird auf seine Verwertbarkeit beforscht, keine Person oder Fraktion kann mehr per se von der Verwertung ausgenommen werden. Die Integration bringt so neben individuellen Chancen vor allem einen vermehrten Anpassungs- und Leistungsdruck mit sich: der Schwule darf zwar Bürgermeister werden, aber keine Tunte sein; die Autistin ist am besten eine logisch begabte IT-Spezialistin; die Blinden müssen GEZ-Fernsehgebühren zahlen; die Langzeitarbeitslosen – früher rein passive Empfänger_innen von Transferleistungen – werden in einem dauernden Hamsterrad gefördert und gefordert und auch die Lohnarbeitenden müssen sich dem Diktum lebenslangen Lernens unterwerfen. Wo diese Anpassung dennoch scheitert, wird menschlicher ›Ausschuss‹ produziert, der nicht verwertet werden kann.
Mit dem beinahe unbeschränkten Siegeszug des Kapitals, das zunehmend vehementer auf die und in den Subjekten wirkt, erklärt sich auch die massive Ausweitung und der Formwandel der reformierten Psychiatrie. Die krisenhaft verfasste Gesellschaft des Postfordismus, die im Zeichen eines hohl gewordenen Integrations- und Partizipationsversprechens steht, ermöglicht es nicht einmal mehr der Mittelschicht, ihr Leben auf einer nachhaltigen Subjektebene zu planen. Die für die bürgerliche Selbstdisziplinierung so wichtige Zukunftsperspektive bröckelt. Institutionen wie die Familie oder die Nachbarschaft entfalten ungeachtet der sozialpsychiatrischen Romantisierung der Gemeinde nur noch bedingt kompensatorische Kräfte. Benötigt werden daher weit ausgreifende Kompensations-, Korrektur- und Kontrollmechanismen, um die Funktionalität der Subjekte zu erhalten. Gerhard Mutz beschreibt den Wandel von der privaten zur öffentlich psychiatrisch-psychosozialen Reproduktion wie folgt:
Indem die Familie, nun auch zunehmend für die bürgerlichen Schichten wahrnehmbar, nicht in der Lage ist, psychosoziale Grundqualifikationen zu vermitteln und zu sichern, d.h. eine stabile Identitätsstruktur zu entwickeln, die es ermöglicht, den gesellschaftlichen Alltag in der Produktions- und Reproduktionssphäre zugleich anpassend und gestaltend zu bewältigen […], verlagert sich der Schwerpunkt der Sozialisations- und Kontrollprozesse; […] öffentliche Reproduktionssysteme müssen in der Lage sein, Techniken der Identitätsfindung zu vermitteln. Dies hat zur Folge, dass bestehende Sozialisationsinstanzen (z.B. Schule) ›psychologisiert‹ werden und dass ›neue‹ […] Institutionen der psychosozialen Versorgung entstehen. (Mutz 1983: 285)
Affirmativ formuliert wurde dieser Zusammenhang von Karl Peter Kisker, dem erwähnten Vordenker der Psychiatriereform, bereits 1967: »Die Psychiatrie […] hat in diese Lücken […] einzuspringen, Ersatz für die versagende Primär-Gruppen zu leisten und hier ihr Bestes zu tun.« (Kisker 1967: 40) Der Psychiatrie kommt so immer mehr eine zentrale Filterfunktion zu, um subjektive Krisen zu registrieren und die fluide gewordenen Grenzen zwischen Normalität und Abweichung zu regulieren – wobei Normalität die klaglose Unterordnung unter den stummen Zwang der Verhältnisse meint:
Je zentraler diese Funktion der Unterscheidung zwischen systemerhaltendem und systemstörendem Verhalten im totalen Kapitalismus wird, desto wichtiger wird die Psychiatrie, die […] das Funktionieren der Subjekte (scheinbar) unterstützt und steuert und Probleme mit […] unerwünschten Verhaltensweisen aufzeigt und der Behandlungssphäre zuführt. (Sanin 2012)
Die Psychiatrie versteht sich als Lotsin, die den schwachen und dysfunktionalen Subjekten die passende Behandlung zuweist. Seit jeher zeichnet sich die Psychiatrie allerdings durch einen Doppelcharakter aus: sie ist sowohl für die öffentliche Ordnung als auch für das ›verrückte‹ Subjekt, für Sicherheit und Heilung zuständig, ist ergo Polizei und Medizin in einem. Dieser widersprüchliche Doppelcharakter wurde durch die Psychiatriereform nicht aufgehoben, jedoch wird seitdem die Seite des Subjekts betont. Die alte objektivierende Verwahrpsychiatrie, in welcher das Staatsinteresse und die Staatsgewalt unmittelbar im Arzt personalisiert waren, wurde durch die Reformpsychiatrie umgeformt und ergänzt. Die neue Psychiatrie entspricht den oben beschriebenen postfordistischen Integrationstendenzen: keine Bürger_in aus ideologischen Gründen a priori ausschließen, alle aktivieren und fordern, nicht einmal eine längere psychiatrische Absenz gönnen, solange noch die Option der Verwertbarkeit besteht. Bei der Gemeindepsychiatrie handelt es sich dabei um einen Sektor, der ähnlich dem JobCenter-Regime die Betroffenen in seine Obhut nimmt und sie – trotz häufig geringer Erfolgsaussichten und entsprechend hoher ›Verweildauern‹ im Betreuten Einzelwohnen und Arbeitslosengeld – andauernd sozialarbeiterisch schein-aktiviert. Durch die Ausweitung der Werkstätten, die meist auf stupider unqualifizierter Arbeit beruhen und zum Teil profitabel von großen Unternehmen betrieben werden, wurde ein irregulärer Niedrigstlohnsektor geschaffen. Dem stehen gemeindepsychiatrische Versuche zur Seite, die angeblich besonderen Ressourcen von Psychiatrie-Erfahrenen, wie Kreativität und Sensibilität, arbeitsmarkttechnisch in Wert zu setzen. Einige Betroffene werden auch im Zuge des Trialogs als Expert_innen in die klinische und gemeindepsychiatrische Versorgung einbezogen, wo sie meist zu niedrigeren Löhnen als die meisten anderen psychiatrischen Professionellen angestellt werden.
Während die unmittelbar persönliche Autorität der Ärzt_innen als einstige ›Götter in Weiß‹ abgenommen hat, wurde zugleich die psychosoziale Gesundheit als Verantwortung der Einzelnen etabliert und entgrenzt. Neben den Typus der entsubjektivierten Anstaltsinsass_innen, die es vor allem in den Heimen und in der Forensik wieder vermehrt gibt, sind die Figuren der mündigen Patient_innen und der empowerten Klient_innen getreten. Wo ›psychisch Kranke‹ noch nicht als ›austherapiert‹ gelten, sollen sie in ihrer Subjektivität gestärkt werden. Doch Subjektivieren bedeutet neben Ermöglichen auch Unterwerfen, es handelt sich daher nicht um individuelle Freiheit: analog zum Zwang andauernder kreativer Selbstverwertung entsteht ein Zwang zur psychischen und psychiatrisch initiierten Selbstregulierung. Damit sind nicht nur die Diskurse um Burnout, Stress-Resilienz und ADHS gemeint, sondern auch die Ausweitung von Ratgeberliteratur, Therapieangeboten, temporären klinischen Auszeiten und scheinbar selbstbestimmter Neuroleptikaeinnahme. Im nicht immer freiwilligen Zusammenspiel mit den psychiatrischen Professionellen und Institutionen sollen die Subjekte an der individuellen Regulierung ihrer psychischen Balance arbeiten. Der Chefarzt ist damit nicht mehr (nur) äußere Instanz, sondern wird analog zum postfordistischen Kapitalisten in das Über-Ich zumindest der Mittelschicht integriert. Es ist nur folgerichtig, dass die von der Psychiatriereform propagierte Selbsthilfe in den letzten Jahren zunehmend unter dem Schlagwort des psychiatrischen Selbstmanagements propagiert wird. Diagnosen auf Grundlage von Selbstbefragungsbögen gelten diesem Diskurs als effektiver denn die ärztlicherseits gestellten Diagnosen. Ebenso übernehmen die psychiatrischen Einrichtungen postfordistische Management-Strategien, die statt auf Verwahrung auf Case Management, statt auf persönlicher Autorität auf Sachzwang und Psychologisierung beruhen. Dass die Menschen sich tendenziell nicht nur als Patient_innen oder Klient_innen, sondern auch noch in Personalunion als Ärzt_innen begreifen sollen, lässt den früher manifesten Widerspruch zur internierenden Psychiatrie zunehmend unsichtbar werden. Vielleicht kommt daher die vielkonstatierte ›Erschöpfung‹: der Widerspruch wird kaum noch externalisiert, der Konflikt zwischen eigenen Bedürfnissen und kapitalistischen wie psychiatrischen Anforderungen muss kontinuierlich im Subjekt verhandelt werden – ein andauernder, lähmender Kampf gegen sich selbst. Ohne falschen Gleichsetzungen das Wort zu reden, scheint doch der individuelle wie kollektive antipsychiatrische Kampf ähnlich wie der proletarische Klassenkampf durch Bürokratisierung und Subjektivierung, Prävention und Integrationsversprechen eingedämmt. Wo die psychiatrische Einbindung vom Subjekt trotz allem nicht angenommen wird, stehen jedoch immer noch die altbewährten Methoden der gewaltförmigen Unterwerfung parat, die angesichts krisenbedingter Exklusion ganzer Populationen in den letzten Jahren wieder stärker in Anspruch genommen werden, z.B. in Form von Zwangseinweisungen hunderttausender Menschen. Gerhard Mutz weist darauf hin, dass aufgrund der spezifischen Verknüpfung der multipolaren psychiatrischen Strukturen »Herrschaft und Repression […] unerkannt bleiben müssen, weil [die Strukturen] sich selbst von den harten differenzierenden Techniken der Ausgrenzung distanzieren, während die gesellschaftlichen Normalitäts- und Abweichungsdefinitionen von den Individuen selbst verlangt werden« (Mutz 1983: 259). Die sozialpsychiatrisch inspirierte Psychiatriereform hat einen entscheidenden Anteil zu dieser Transformation beigetragen und damit zur Bewahrung von Ruhe und Ordnung auch in Zeiten ökonomischer Krisen. Franco Basaglia, der italienische Antipsychiater, beschreibt die sozialpsychiatrische Aufhebung der Widerstände und Stillstellung der sozialen Konflikte so:
Der neue Sozialpsychiater, der Psychotherapeut, der Sozialarbeiter […] sind nichts Anderes als die neuen Verwalter der Gewalt […]; denn durch die Abschwächung der Gegensätze […] ermöglichen sie mit ihrer vermeintlich wiedergutmachenden gewaltlosen technischen Arbeit in Wahrheit nur den Fortbestand der globalen Gewalt. (Basaglia 1971: 125)
Erst wenn dem Fortwesen dieser allgemeinen globalen Gewalt ein Ende gesetzt wurde, wird auch die Psychiatrie keine Notwendigkeit mehr beanspruchen können und ihr verdientes Ende finden.