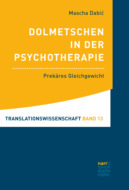Kitabı oku: «Kreativität und Hermeneutik in der Translation», sayfa 2
1.2 Marcus Fabius Quintilianus
Bei Quintilian geschieht dies in expliziterer Form, wenn dabei auch nicht die freie Übersetzung ins Spiel kommt, zumindest nicht ausdrücklich. Durch ihn wird die Eingliederung der Übersetzung in das System der septem artes liberales, genauer gesagt in das sog. Trivium vorbereitet (vgl. Albrecht 2009: 875 und infra Abschnitt 2). Im zehnten Buch seiner Institutio oratoria weist er darauf hin, dass schon die alten römischen Redner (veteres nostri oratores) das Übersetzen aus dem Griechischen (vertere Graeca in Latinum) für eine ausgezeichnete Übung zur Schulung der eigenen Ausdruckfähigkeit erachtet hätten (Quintilian 1988: Buch X, 5, 1–4). Die Inanspruchnahme der Übersetzung in die Muttersprache zur Schulung der eigenen Ausdrucksfähigkeit (später auch zur Bereicherung der Zielsprache) sollte später zu einem Topos werden, der sich in zahlreichen Rhetoriken, Poetiken und Grammatiken findet (vgl. Albrecht 1998, Kap. 4.3). Leider ist diese frühe und über Jahrhunderte hindurch überlieferte Erkenntnis in der modernen Sprachdidaktik weitgehend verloren gegangen (vgl. Albrecht 2009: 884).
2 Die Stellung der Übersetzung im Kreis der freien Künste
Übersetzungstheoretische Traktate erscheinen nicht selten als Teile umfangreicherer Arbeiten, die eine der Disziplinen des Triviums im System der freien, d.h. eines freien Mannes würdigen (vgl. Moos 2009: 800), Künste behandeln. Der katalanische Humanist Juan Luis Vives veröffentlichte seine Abhandlung „Versiones seu interpretationes“, auf die zurückzukommen sein wird, als Schlusskapitel seiner Rhetorik De ratione dicendi (Vives 1993 [1532]). Johann Christoph Gottsched, einer der letzten der deutschen Gelehrten, die sich der klassischen Rhetorik verbunden fühlte, bringt seine übersetzungstheoretischen Überlegungen ebenfalls in einem Kapitel seiner Rhetorik, der Ausführlichen Redekunst unter (Gottsched 1975 [1736]). Justus Georg Schottel[ius] behandelt jedoch die Übersetzung als Teil der Grammatik. In seiner Ausführliche[n] Arbeit Von der Teutschen HaubtSprache ist ein Kapitel mit „Wie man recht verteutschen sol“ überschrieben (Schottelius 1967 [1663]). Es empfiehlt sich also, das Verhältnis zwischen der Grammatik, der Rhetorik und nicht zuletzt der Poetik, die einen Sonderstatus einnimmt, etwas genauer in den Blick zu nehmen.
Das ‚Untergeschoss‘ der sieben freien Künste, das zur Blütezeit dieses Bildungssystems keineswegs als „trivial“ angesehene Trivium, besteht aus Grammatik, Dialektik (statt Dialektik gelegentlich auch Logik) und Rhetorik. Zwar lassen sich diese Disziplinen inhaltlich nicht klar trennen, jedoch besteht zwischen ihnen eine Reihenfolgebeziehung. Ernst Robert Curtius zitiert in diesem Zusammenhang einen mittelalterlichen Merkvers, der den Aufbau des gesamten Gebäudes der freien Künste betrifft:
Gram. loquitur; Dia. vera docet; Rhe. verba ministrat;
Mus. canit; Ar. numerat; Geo. ponderat; As. colit astra.
(Zit. n. Curtius 21954: 47)
Dabei wird die Reihenfolge nicht selten als eine Rangordnung interpretiert, die sich den jeweils verfolgten Zwecken unterordnen lässt: Im Hinblick auf dignitas steht die Rhetorik, im Hinblick auf necessitas jedoch die Grammatik an oberster Stelle (vgl. Albrecht 2009: 876). Im praktischen Lehrbetrieb entwickelt sich eine Tradition, die sich – in späteren Jahrhunderten völlig losgelöst von ihren Ursprüngen im Trivium – in der Sprachdidaktik bis ins 20. Jahrhundert behauptet hat: Die Übersetzung in die Fremdsprache (frz. thème) steht im Dienst der Grammatik, der ars recte loquendi; die Übersetzung in die ‚eigene‘ Sprache (frz. version) in dem der Rhetorik, der ars bene dicendi (vgl. Albrecht 2014: 428f.), die schon früh zu einer ars copiose et ornate scribendi geworden war (Albrecht 2007: 1080). Dabei spielen, wie noch zu zeigen sein wird, neben der interpretatio im engeren Sinn freiere Formen wie die imitatio und die aemulatio eine große Rolle.
2.1 Die Rhetorik als Lehrmeisterin der Übersetzung: Texttypologie und Übersetzungsstrategie
Die Überzeugung, dass die beim Übersetzen anzuwendende Strategie vom Typ des zu übersetzenden Textes abhängt, gilt gemeinhin als Erkenntnis der neueren Übersetzungswissenschaft; sie gehörte jedoch bereits in der Antike zum festen Inventar rhetorischer Lehrmeinungen. Zugrunde lag eine nicht ganz leicht nachzuvollziehende Unterscheidung von res und verba, die sich in derjenigen zwischen figurae elocutionis und figurae sententiae widerspiegelt (vgl. Lausberg 1963: 81–154). Die einen sind dem Bereich der elocutio, die anderen dem der inventio zuzuordnen, doch müssen auch die „Gedankenfiguren“ im Rahmen der elocutio behandelt werden, da sie ebenfalls durch Wörter ausgedrückt werden. Der Unterscheidung zwischen res und verba entspricht derjenigen von unterschiedlichen Texttypen (materiae oder auctores), die besonders klar von Pierre-Daniel Huet (1630–1721) ausgearbeitet wurde. Er korreliert die auctores mit den drei ersten Produktionsstadien der Rede: Die historici berichten über tatsächlich vorgefallene Ereignisse, bei ihnen hat der Übersetzer die inventio und die dispositio zu bewahren, bei der elocutio hat er freie Hand. Bei den rhetores und den poetae geht es in erster Linie um den sprachlichen Ausdruck; er muss im Rahmen der elocutio unter Beachtung der Angemessenheit (aptum) besonders sorgfältig übertragen werden (vgl. Rener 1989: 182–257; Schneiders 1995: 55). Ein gutes Jahrhundert früher hatte Juan Luis Vives eine auf den gleichen Prinzipien beruhende, jedoch subtilere Typologie vorgeschlagen. Er unterscheidet (im Hinblick auf die Übersetzung):
Texte, bei denen es nur auf den allgemeinen Inhalt ankommt ([ubi] solus spectatur sensus);
Texte, bei denen es vor allem auf die Formulierung ankommt (sola phrasis et dictio);
Texte, bei denen es auf beides ankommt (ubi res et verba ponderantur).
(Vgl. Vives 1993 [1532]: 232; Coseriu 1971: 573).
Selbstverständlich spielt die „Dreistillehre“ (genera elocutionis oder dicendi) auch bei der Behandlung der Übersetzung innerhalb der Rhetorik eine Rolle. Der Übersetzer hatte darauf zu achten, in welchem genus (humile, medium oder sublime) sein Text abgefasst war und dementsprechend zu verfahren. Dabei wurde manchmal die Grenze der Einzelsprachen überschritten: Im Zeitalter des „vertikalen“ Übersetzens wurde ein descensus, z. B. eine Übersetzung vom Lateinischen ins Deutsche, als Gattungswechsel betrachtet; der deutsche Text gehörte notwendigerweise dem genus humile an (vgl. Albrecht 2011: 2596).
2.2 Rhetorik und Poetik
Für Aristoteles war die Poetik im Gegensatz zur Rhetorik eine ausschließlich den sprachlichen Ausdruck betreffende Disziplin. Wo immer Denkinhalte innerhalb der Poetik berührt wurden, galt die Rhetorik als zuständig:
Über alles andere ist damit gehandelt, es bleibt nur noch zu reden über Sprache und Denkweise. Die Denkweise soll in den Büchern über die Redekunst niedergelegt sein, da sie ihrem Verfahren viel näher liegt. (Aristoteles 1959: 85 = Poetik 19 1456a)
Nun hat sich, wie wir in der Einführung aus dem Munde des fiktiven Tzvetan Todorov erfahren haben, in der Geschichte der Rhetorik der Schwerpunkt des Interesses von den res (oder besser rebus) auf die verba verlagert. Rem tene, verba sequentur soll Cato gesagt haben, wie der Verfasser einer Rhetorik aus dem 4. Jahrhundert berichtet. Zu dieser Zeit fand eine solche Devise noch uneingeschränkte Zustimmung. Mit der Annäherung der Rhetorik an die Poetik, an die „seconde rhétorique“, wie sie unser Pseudo-Todorov nennt, gerät sie zumindest außerhalb der schöngeistigen Milieus zunehmend in Misskredit, wie der abschätzige Ausdruck „reine Rhetorik“ bezeugt. Andererseits entwickelt sich die Übersetzung im Zuge dieser Entwicklung von einem wenig geschätzten Handwerk (Cicero spricht immer einmal wieder abschätzig von den interpretes indiserti) zu einer Kunstform. Nicht nur die Übersetzung im engeren Sinn, die interpretatio, sondern auch die freieren Formen wie imitatio und aemulatio geraten in den Umkreis jener „zweiten Rhetorik“:
Dichten wird als gelehrte Auseinandersetzung (imitatio/aemulatio) mit den Texten vorbildhafter Dichter (vor allem der Antike) verstanden. Im Ideal des poeta doctus vereinigen sich umfassende Kenntnis der Sachen (Wissenschaften) und der poetischen und rhetorischen Theorie, wie es die römischen Rhetoriker auch vom Redner fordern (Till 2005: 145; vgl. ebenfalls Till 2003: 1305f.).
3 Der freie Umgang mit fremdsprachlichen Texten: imitatio und aemulatio
Bei dem freien Umgang mit Textvorlagen, von denen nun die Rede sein soll, ist es im Grunde unerheblich, ob damit ein Sprachwechsel verbunden ist oder nicht. Gérard Genette, der in dem Roman, der uns in unser Thema eingeführt hat, beim Begräbnis von Roland Barthes als vergleichsweise seriöser Gelehrter an der Seite Todorovs in Erscheinung tritt, spricht in diesem Fall von Transtextualität (Genette 1982: 7). Alle drei Formen des Umgangs mit fremdsprachlichen Texten kommen auch ohne Sprachwechsel vor: die interpretatio als „Interpretation“ im modernen Verständnis bzw. als intralinguale Übersetzung im Sinne Roman Jakobsons (1959); die imitatio als „Nachdichtung“ oder „Bearbeitung“ im herkömmlichen Sinn, die aemulatio als „augmentative Bearbeitung“, mit der die Vorlage übertroffen werden soll (vgl. Schreiber 1993: 263ff.). In den folgenden Abschnitten sollen die beiden freien, mit Sprachwechsel verbundenen Formen des Umgangs mit einer Textvorlage jeweils anhand eines einzigen Beispiels illustriert und kommentiert werden.
3.1 Giacomo Leopardi
Das folgende Gedicht figuriert seit der Werkausgabe von 1835 als Nummer XXXV in Leopardis Canti:
Imitazione
Lungi dal proprio ramo,
povera foglia frale,
dove vai tu? – Dal faggio
là dov’io nacqui, mi divise il vento.
Esso, tornando, a volo
dal bosco alla campagna,
dalla valle mi porta alla montagna.
Seco perpetuamente
vo pellegrina, e tutto l’altro ignoro.
Vo dove ogni altra cosa,
Dove naturalmente
Va la foglia di rosa,
E la foglia d’alloro.
Es handelt sich um die Nachdichtung – als poeta doctus hat Leopardi den Titel Imitazione sicher bewusst gewählt – einer „Fabel“ des heute fast völlig vergessenen Lyrikers, Dramatikers und (vor allem) Politikers Antoine-Vincent Arnault (1766–1834):
La Feuille
De la tige détachée,
pauvre feuille desséchée,
où vas-tu ? – Je n’en sais rien.
L’orage a brisé le chêne
qui seul était mon soutien.
De son inconstante haleine,
le zéphir ou l’aquilon
depuis ce jour me promène
de la forêt à la plaine,
de la montagne au vallon ;
je vais où le vent me mène
sans me plaindre ou m’effrayer ;
je vais où va toute chose,
où va la feuille de rose
et la feuille de laurier.
Leopardi soll diesen Text im Jahre 1818 in einer Zeitschrift gelesen und angeblich nichts über den Verfasser gewusst haben. So geriet er gar nicht erst in Versuchung, die für zeitgenössische französische Leser unmittelbar zu entschlüsselnden biographischen Anspielungen auch in seiner Nachdichtung erkennbar zu machen: Bei der geborstenen Eiche handelt es sich um Napoleon, nach dessen Sturz sich der Dichter für einige Zeit ins Exil begeben musste.
Ein gewissenhafter Vergleich der beiden Texte ist im Rahmen eines kurzen Aufsatzes nicht möglich; einige generische Hinweise müssen genügen: Einer metrisch relativ strengen Vorlage mit einem ziemlich komplizierten Reimschema, bei dem die Alternanzen zwischen männlichem und weiblichem Reim viel zur Wirkung beitragen, steht eine um zwei Verse verkürzte ‚freie‘ Strophe gegenüber, in die sich endecasillabi (Verse 4, 7, 9) ähnlich wie unregelmäßig auftretende Reime gewissermaßen ‚beiläufig einschleichen‘. Der Wechsel von der martialischen Eiche zu der mit weniger Konnotationen behafteten Buche trägt mit dazu bei, der imitatio einen im Vergleich zur Vorlage nüchterneren und intimeren Charakter zu verleihen.
Das muss zur Charakterisierung genügen. Wichtiger sind in dem Zusammenhang, um den es hier geht, die äußeren Umstände. In der Literatur zu Leopardi wird der Titel imitazione öfter mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Warum hat er nicht einfach von ‚Übersetzung‘ gesprochen? Das scheint darauf hinzudeuten, dass zumindest den späteren Kritikern der rhetorisch-poetische Fachausdruck nicht mehr geläufig war. Hätte Leopardi sein Gedicht unter dem Titel traduzione in die Ausgabe seiner Canti aufnehmen können? Wohl kaum. Es musste schon im Titel darauf hingewiesen werden, dass es sich um einen Text handelt, der als eigenständiges Werk des Verfassers gelten darf. Noch heute gibt es in der Rechtsprechung eine klar ausgeprägte Tendenz, nur ‚freie‘ Übersetzungen als schutzwürdiges geistiges Eigentum anzuerkennen (vgl. Körkel 2016). In einer Ausgabe ausgewählter Werke von Leopardi in deutscher Übersetzung findet sich auch die Imitazione unter dem Titel Nachahmung (Leopardi 1978: unpaginiert = 262–263). Die französische Vorlage wurde immerhin mit abgedruckt. Hätte die „Übersetzung einer Übersetzung“ dort Platz finden können?
3.2 Wolfram von Eschenbach und die drei Blutstropfen im Schnee
Bei den Nachdichtungen französischer romans courtois durch deutsche Autoren im Mittelalter hat man davon auszugehen, dass ein großer Teil des Publikums, das dem mündlichen Vortrag der Versromane lauschte, die französischen Vorlagen kannte. Stieß der deutsche Dichter auf einen Passus, der in der französischen Vorlage besonders gut gelungen schien, begnügte er sich oft mit einer knappen Zusammenfassung. Sein ganzer Ehrgeiz galt den Passagen, die in der Vorlage nur wenig ausgearbeitet waren. Hier konnte er den kundigen Zuhörern zeigen, wozu er selbst im Stande war. Huby spricht in diesem Zusammenhang von einer règle de compétition (vgl. Huby 1968: 205; Werdermann 1998: 99). Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für diese Form der aemulatio hat Wolfram von Eschenbach mit seiner Ausarbeitung der Episode von den drei Blutstropfen im Schnee geliefert.
Bei Chrétien handelt es sich um einen schlichten, nur von knappen Kommentaren durchsetzten Bericht, der vor allem dadurch authentisch wirkt, dass er den Eindruck erweckt, man müsse so etwas selbst erlebt haben, dergleichen könne man sich nicht ausdenken: Eines Morgens fand sich der umherirrende Perceval auf einer Wiese am Rand eines Waldes wieder. Es lag Schnee, denn er befand sich in einem kalten Landstrich (Que froide estoit molt la contrée; V. 4097). Er sieht eine Schar von Wildgänsen, vom Schnee geblendet, die von einem Falken verfolgt wurden. Dieser stürzte sich auf eine der Gänse, die sich ein wenig von den anderen entfernt hatte und schlug sie zu Boden, ließ jedoch gleich wieder von ihr ab. Sie war am Hals verletzt und verlor drei Tropfen Blut, die in den Schnee fielen (la gente fu navree el col/Si saigna III goutes de sang/Qui espandirent sor lo blanc,/Si senbla naturel color; V. 4120–4123). Die Gans war jedoch nicht ernsthaft verletzt und konnte weiterfliegen. Erst jetzt tritt der allwissende Erzähler in Erscheinung, der weiß, was in seinem Helden vorgeht. Perceval betrachtet auf seine Lanze gestützt die Blutstropfen im Schnee und wird durch das Farbenspiel an seine ferne Geliebte erinnert (V. 4141–4144).
Bei Wolfram wird aus dieser Episode ein um etwa zwanzig Verse vermehrtes raffiniertes Gemisch aus Bericht und Kommentaren des Erzählers. Schon der Schnee wird nicht knapp auf das rauhe Klima der Gegend zurückgeführt, sondern als ungewöhnliches Ereignis dargestellt. Dabei bringt der Autor die bei Chrétien nie in Frage gestellte Authentizitätsfiktion ins Wanken, indem er sich selbst als Erzähler ins Spiel bringt (ez enwas iedoch niht snêwes zît, istz als ichz vernomen hân; 281, 14f.), und er lässt seine Hörer/Leser auch nicht darüber im Zweifel, dass es sich hier nicht um einen nüchternen Bericht, sondern um eine ziemlich absonderliche Geschichte handelt (diz mǣre ist hie vast undersniten/ez pariert sich [„mischt sich“] mit snêwes siten; 281, 21f.). Und auch mit der schlichten Erwähnung eines Falken gibt sich Wolfram nicht zufrieden. Bei ihm gehört der Falke zu König Artus’ und seinen Rittern, die sich in der Nähe aufhielten (was Parzival nicht weiß) und war abends nicht heimgekehrt, weil er zu viel zu fressen bekommen hatte (von überkrüphe daz geschah; 281, 29). Hier wendet sich ein in der Falknerei bewanderter Erzähler augenzwinkernd an ein fachkundiges Publikum. Die wenigen Verse, mit denen Chrétien schildert, wie die roten Farbflecke im weißen Schnee für Perceval das Bild seiner Geliebten evozieren, wird schließlich bei Wolfram zu einer längeren ‚polyphonen‘ Meditation ausgestaltet, bei der die Stimme des Erzählers mit der seines Protagonisten verschmilzt.
Wolfram folgt an dieser Stelle, sicherlich ohne es zu wissen, einer Aufforderung, die Horaz in seiner sog. ars poetica (Epistula ad Pisones) an die Dichter gerichtet hat. Es handelt sich dabei nicht, wie bis heute immer wieder irrtümlich behauptet wird, um ein Plädoyer für die ‚freie Übersetzung‘, sondern um eine Ermunterung zur aemulatio:
Publica materies privati iuris erit, si
Non circa vilem patulumque moraberis orbem
Nec verbum verbo curabis fidus
Interpres nec desilies imitator in artum,
unde pedem proferre pudor vetet aut operis lex …
(Horaz 1967: 238)
In freier Paraphrase unter Berücksichtigung des hier nicht wiedergegebenen Kontexts: Für den Dichter, der das Publikum von seinen Fähigkeiten überzeugen will, ist es oft wirkungsvoller, sich nicht mit einem selbst erfundenen, sondern mit einem allgemein bekannten Stoff vorzustellen. Dabei darf er sich allerdings nicht genau an seine Vorlage halten, wie ein gewissenhafter Übersetzer, und auch als Nachahmer darf er keine Scheu vor eigenwilligen Abweichungen zeigen.
4 Rückblick und Ausblick
Kehren wir nochmals zu Todorovs seconde rhétorique zurück, die eng mit dem Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit verbunden ist. Unser Jubilar hat sich Gedanken dazu gemacht. Er stellt einen Bezug zur Übersetzung her, der bisher noch nicht behandelt wurde:
Die rhetorische Leistung der öffentlichen Rede erfährt durch ihre schriftliche Ausformulierung eine weitere künstlerische Verarbeitung, der die Intention zugrunde liegen dürfte, mit den Mitteln der Schrift die mündliche Wirkung zu evozieren und sogar zu erhöhen. Diese doppelte Steigerung des Künstlerischen stellt den translatorischen Prozess vor besondere Zwänge, die vornehmlich mit der Wiedergabe ausgefeilter rhetorischer Mittel in einer anderen Sprachkultur zu tun haben. Insbesondere interessiert also die Frage, welche sprachlichen Kunstgriffe sich eher übertragen lassen, weil sie als allgemein rhetorisch einzustufen sind, und welche translatorische Barrieren bilden, die es zu überwinden gilt. (Gil 2012: 153f.)
Hier geht es weder um die Übersetzung im Dienste der Rhetorik noch um die Rhetorik als Lehrmeisterin der Übersetzung, sondern um den rhetorisch ausgefeilten Text als Gegenstand der Übersetzung, als Übersetzungsproblem. Alberto Gil interessiert sich weniger für die Fälle, in denen aufgrund einer langen gemeinsamen Tradition unter dem Dach der Latinität zumindest in den meisten europäischen Sprachen Äquivalente gewissermaßen gebrauchsfertig zur Hand sind, sondern für diejenigen, in denen „translatorische Barrieren“ auf einer höheren Ebene der Äquivalenz als der rein sprachlich-textlichen zu überwinden sind. Dieser Frage kann hier nicht weiter nachgegangen werden; sie gibt jedoch Anlass, zum Beginn dieses kurzen Beitrags zurückzufinden.
In dem Moment, in dem die Rhetorik Gegenstand der Übersetzung wird, ist sie endgültig in der Poetik aufgegangen und zur Stilistik mutiert. Der Verfasser des Romans, der die Einleitung ins Thema geliefert hat, trägt diesem Umstand spielerisch Rechnung, vermutlich ohne damit eine gezielte Absicht zu verfolgen. Die „erste Rhetorik“, bei der es tatsächlich um etwas geht, bei der die Rede in erster Linie überzeugend zu sein hat, spielt dort eine große Rolle, aber nur noch als eine Art von Spiel, genauer, eine Art von sadistischem Gesellschaftsspiel. In einem geheimnisvollen Logos Club, der ähnlich wie die Freimaurerlogen über ganz Europa verteilt ist, disputieren zwei Kontrahenten über ein vorgegebenes Thema. Dabei geht es unter anderem auch, im Rahmen von Platons Schriftkritik, um Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit (cf. Binet 2015: 195–200). Der Gewinner erntet Ruhm und Ansehen, der Unterlegene verliert augenblicklich coram publico einen Finger. Nur dem, der es wagt, gegen den Grand Protagoras anzutreten, hinter dessen venezianischer Maske sich kein Geringerer als Umberto Eco verbirgt, und der dabei den Kürzeren zieht, nur dem widerfährt Schlimmeres: „Alors là, c’est plus cher“ bemerkt ein Eingeweihter sarkastisch (cf. Binet 2015: 439).
Alberto Gil hätte im Logos Club sicherlich eine glänzende Figur abgegeben und wäre mühelos als Nachfolger Ecos in den Rang des Grand Protagoras aufgestiegen; doch dürfen wir alle froh darüber sein, dass er sich längst von der agonalen Kunst der Überredung ab- und der friedlichen Kunst des Verstehens zugewandt hat. Wer in seinen zahlreichen Arbeiten blättert wird feststellen, dass es da noch viel weiterzuführen und auszuarbeiten gibt.