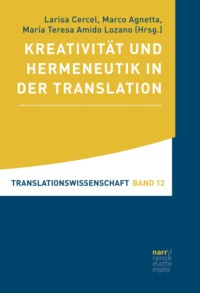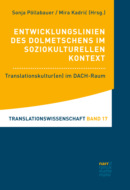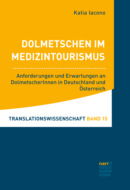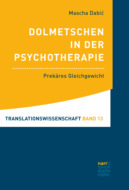Kitabı oku: «Kreativität und Hermeneutik in der Translation», sayfa 8
2 Kategorien von Kinderliteratur
Der Ausdruck Kinderliteratur ist in zweifacher Hinsicht mehrdeutig. Er ist einerseits unscharf als Gegenbegriff zur „richtigen“, zur Erwachsenenliteratur. Heute differenziert man – sinnvollerweise – gelegentlich zwischen Kinder- und Jugendliteratur, ohne dass die Grenze zwischen diesen beiden Kategorien scharf gezogen werden könnte. Als logische Konsequenz werden Kinder- und Jugendliteratur denn auch wieder fast immer in einem Atemzug genannt und wissenschaftlich behandelt (vgl. z. B. das deutsche Referenzwerk von Wild 1990).
Neben der Einteilung, die primär auf das Alter abzielt, ist noch eine andere Kategorisierung zu berücksichtigen. Es gibt das idealtypische Kinderbuch, von Erwachsenen für Kinder geschrieben und illustriert, in dem etwa lebensweltliche Bereiche thematisiert werden (Stadt, Baustelle, Bauernhof; Lebensformen in fremden Ländern etc.). Nicht selten aber findet man auf dem Buchmarkt Publikationen mit intendierter Doppeladressierung. Damit meine ich nicht – was unter diesem Terminus auch manchmal verstanden wird – die unleugbare Tatsache, dass im Verlagswesen Kinderbücher oft durch die Brille von Erwachsenen beurteilt werden, weil sie es ja sind, die die Bücher kaufen und daher ihren Geschmack bedient sehen wollen. Als doppelt (bzw. mehrfach) adressiert bezeichne ich hier – in Übereinstimmung mit der üblichen Verwendung des Ausdrucks – solche Produkte, die sich vorgeblich (ausschließlich) an Kinder richten, aber auch von älteren Leserinnen und Lesern – Jugendlichen oder Erwachsenen – auf einer anderen Ebene mit Vergnügen und Gewinn gelesen werden können. Das weltweit verbreitetste und in die größte Zahl an Sprachen bzw. Varietäten übersetzte Beispiel dieser Art ist der schon erwähnte Kleine Prinz, in dem sich der Erzähler ja explizit an Kinder wendet und z. B. die Phantasielosigkeit der „grandes personnes“ (ein kindersprachlicher Ausdruck für „adultes“, ‚Erwachsene‘) tadelt.
Die Mehrfachadressiertheit ist zweifellos auch das Erfolgsrezept der Petit-Nicolas-Serie des französischen Autors René Goscinny und seines Illustrators Jean-Jacques Sempé (in deutscher Übersetzung: Der kleine Nick):
Ecrites sous forme de courts récits dans lesquels se mêlent l’humour et la tendresse de l’enfance, les aventures du Petit Nicolas mettent en scène un petit garçon dans un environnement urbain pendant les années 1960. Le personnage y livre ses pensées intimes grâce à un langage enfantin créé par Goscinny et les thèmes sont avant tout ceux de l’enfance (la camaraderie, les disputes, les rapports avec la maîtresse d’école, les premières amourettes, …) mais Goscinny y décrypte également le monde complexe des adultes : l’éducation, les disputes familiales, les rapports entre voisins, la relation du père avec son patron, etc.1
Das spanische Pendant Manolito, auf das ich noch zu sprechen kommen werde, funktioniert ganz analog, hatte aber aus kulturideologischen Gründen nicht denselben Erfolg, wird jedoch gleichwohl als Schullektüre für den Fremdsprachenunterricht im Reclam-Verlag angeboten (Lindo 2010; 2013). Damit ist klar, dass Nicolas und Manolito zunächst für gleichaltrige Leserinnen und (wohl vor allem) Leser als Identifikationsfiguren wirken (zumindest insofern, als sie die Probleme des Protagonisten kennen und teilen); als fremdsprachliche Schullektüre lösen die Texte beim postpubertären Lesepublikum aber vermutlich eher ein Gefühl der Überlegenheit aus („ja, so war ich auch einmal; vieles erinnert mich an meine kleinen Geschwister“ etc.); Erwachsene könnte die Lektüre dagegen zum Überdenken und zu einer Relativierung ihrer Erziehungsprinzipien, wo nicht generell ihrer Einstellung zum Alltagsleben anregen.
Eine dritte, zahlenmäßig (besonders unter translatorischem Gesichtspunkt) sehr kleine als Kinderliteratur bezeichnete Klasse konstituiert sich aus Texten, die von Kindern geschrieben wurden. Ich erwähne sie hier der Vollständigkeit halber, gehe aber in der Folge nicht weiter auf sie ein. Eltern und PädagogInnen wissen natürlich, dass es Kinder gibt, die bereits im Grundschulalter umfangreiche Geschichten verfassen; deren Distribution beschränkt sich aber gewöhnlich auf den Verwandtenkreis, sofern sie nicht überhaupt nur ins Familienarchiv wandern. Doch es sind auch schon einzelne Kinder, vorwiegend Mädchen, in die Literaturgeschichte eingegangen. Ihre Werke repräsentieren in etwa das, was man in der Kunst als „art brut“ bezeichnet. Ein berühmter Fall sei immerhin erwähnt, zumal der namhafte Schriftsteller H. C. Artmann als Übersetzer seine Hand im Spiel hatte.2 Angeregt durch die Lektüre zahlreicher konventioneller Beziehungsromane, verfasste die neunjährige Daisy Ashford, die bezeugtermaßen unbeschränkten Zugang zum elterlichen Bücherbestand hatte, Ende des 19. Jahrhunderts Geschichten, deren orthographische Unbekümmertheit noch mehr zum Charme ihrer Werke beiträgt als die altklugen Kommentare der auktorialen Erzählerin. Was die Adressierung betrifft, so kehren sich hier die üblichen Verhältnisse um, denn das literarisch frühreife Mädchen hat handlungsmäßig herkömmliche Liebesromane geschrieben, die wohl für Erwachsene gedacht waren, da sich gleichaltrige Kinder für solche Themen ja noch nicht begeistern.
3 Übersetzungstheoretisches
Man kann, wie Walter Benjamin in seinem berühmten Aufsatz über „Die Aufgabe des Übersetzers“ (1923 / 1963), die Auffassung vertreten, dass Kunstwerke nicht im Hinblick auf Rezipienten entstehen – „kein Gedicht gilt dem Leser, kein Bild dem Beschauer, keine Symphonie der Hörerschaft“ (Benjamin 1963: 182) – und dass dasselbe analog auch für die Übersetzung gilt: „Wäre sie […] für den Leser bestimmt, so müßte es auch das Original sein“ (Benjamin 1963: 183). Die meisten modernen Literatur- und Übersetzungstheoretiker folgen ihm darin allerdings nicht, und am wenigsten wohl diejenigen, die sich mit Kinderliteratur beschäftigen. Es ist nicht abwegig sich vorzustellen, dass ein Mensch seinen Liebeskummer in ein Gedicht gießt, das er der Öffentlichkeit vorenthält, aber es wäre wohl eine sehr ungewöhnliche Reaktion, sich mit dem Verfassen eines Kinderbuchs über die Enttäuschung hinwegzutrösten. Dabei muss man freilich nicht von der Idee einer unüberschaubaren Leserschaft ausgehen; nicht wenige Bucherfolge in diesem Sektor sind, den Berichten ihrer AutorInnen zufolge, zunächst für ein einziges ganz bestimmtes Kind, in der Regel natürlich ein eigenes, entstanden, aber ganz ohne den Gedanken an ein Publikum – und sei es zahlenmäßig noch so beschränkt – wird man sich Kinderbücher nicht entstanden denken dürfen.
Wie generell mit Übersetzungen literarischer Texte umgegangen wird, hängt – sehr verallgemeinernd gesprochen – von der Translationskultur des jeweiligen Landes ab. In den – ohnedies nicht sonderlich übersetzungsfreudigen – anglophonen Sprachgemeinschaften dominiert die Einbürgerung, domestication, covert translation; im deutschen Sprachraum genießt dagegen seit den kanonisierten Übersetzungen der Sturm-und-Drang-Zeit und der Frühromantik die Verfremdung, foreignization, overt translation, mehr Kredit; Frankreich hat nach dem Zweiten Weltkrieg seine Orientierung an den Idealen der Belles Infidèles schrittweise aufgegeben und bisweilen dem entgegengesetzten Extrem gehuldigt.
Für Kinderliteratur aber scheint europaweit zu gelten, dass die Anpassung an die Zielkultur das unhinterfragbare Mittel der Wahl ist, um die jungen LeserInnen nicht zu irritieren oder zu verunsichern. Dabei sind allerdings weniger rein sprachliche Aspekte als im weitesten Sinn kulturelle Faktoren im Fokus. Die Untersuchung von Juliane House (2004) – übrigens das einzige mir bekannte repräsentative Forschungsprojekt – hat an zahlreichen aus dem Englischen ins Deutsche übersetzten Kinderbüchern zeigen können, wie in den zielsprachlichen Versionen kulturelle Filter unterschiedlichster Art eingezogen werden.
Es wäre zweifellos aufschlussreich, kulturbedingte Übersetzungsprobleme auch für andere Sprachenpaare auf so breiter Basis zu untersuchen. Bekannt und oft nacherzählt: die Auseinandersetzung Astrid Lindgrens mit ihrem französischen Verleger, der Pippi Langstrumpf im Namen des gesunden Menschenverstands französischer Kinder verwehren wollte, ein Pferd zu stemmen; ein Pony sei das äußerste Zugeständnis (Blume 2001: 102ff., bes. Fußnote 175), was die Autorin zu einer sarkastischen Replik veranlasste.
Nicht allgemein bekannt dürfte der Grund dafür sein, warum der Hamburger Klopp-Verlag die Übersetzungen der in Spanien (und weit darüber hinaus) außerordentlich erfolgreichen Manolito-Bände von Elvira Lindo aus dem Programm genommen hat. Auf Anfrage einer Innsbrucker Dozentin (zum Anlass vgl. infra 4.2) antwortete die Vertreterin des Verlags: „Leider konnte trotz intensivster Bemühungen kein TB-Verlag gewonnen werden. Deren Ablehnungen gipfelten in dem unguten Gefühl, dass die häusliche Gewalt in diesen Geschichten für den deutschen Markt nicht erfolgversprechend sei.“1
Es ist nachvollziehbar, dass im Zusammenhang mit Kinderliteratur viel von kulturellen Unterschieden und dem zweckmäßigen oder faktischen Umgang mit ihnen die Rede ist. Es sind die Phänomene, die am deutlichsten auffallen und sich bei wissenschaftlichen Untersuchungen am ehesten aufdrängen. Ob sie in Zeiten der Globalisierung das Privileg nahezu exklusiver Aufmerksamkeit verdienen, ist eine andere Frage. Über kulturelle Unterschiede wissen Kinder heute als Mitglieder von Patchworkfamilien, aus Urlauben oder durch Klassenkameraden mit fremdkulturellem Hintergrund oft gut Bescheid, so dass das Eliminieren solcher Diskrepanzen wie eine Verbeugung vor der Skopostheorie erscheint, wenn man nicht überhaupt von einem Akt der Zensur sprechen will.
Was mich als Leser (bzw. hauptsächlich als Vorleser) von Kinderbüchern dagegen immer verwundert hat, ist die Seltenheit von Kommentaren hinsichtlich der Sprache. Diesbezüglich werden Kinder, die viel lesen (oder vorgelesen bekommen), vermutlich weit öfter mit irritierenden Erlebnissen konfrontiert. Die heutigen deutschsprachigen Kinder werden durch die Medien zwar an die Existenz unterschiedlicher Varietäten sehr viel früher gewöhnt als noch ihre Großeltern, aber besonders wenn es um Geschichten aus dem täglichen Leben geht, stellen Kinder mit einer altersgemäß entwickelten sprachlichen Sensibilität fest, dass Figuren in ihren Büchern häufig nicht „ihre“ Sprache sprechen. Eine deutsche Kollegin aus Rheinland-Pfalz hat mir vor Jahren berichtet, ihre Tochter verschlinge die Geschichten von Christine Nöstlinger, aber eines Tages habe sie gefragt: „Warum reden die in diesen Büchern so komisch?“
4 Sprachgefühl
4.1 Annäherung an einen umstrittenen Begriff
Mit dieser Frage der jungen Leserin kommen wir nun zum zentralen Punkt unserer Überlegungen. Wissen Verfasserinnen und Verfasser von Kinderliteratur, wie ihre Heldinnen und Helden „in Wirklichkeit“ reden? Findet sich eine achtjährige Grundschülerin in der gleichaltrigen Hauptfigur wieder? Das gilt natürlich in gleichem Maß für Originale wie für übersetzte Werke, denn wir haben es ja mit Texten zu tun, bei denen die „performative Unauffälligkeit“ (Heller 2013) zur elementaren Rezeptionsbedingung gehört; das heißt, das Translat wird nicht als Translat wahrgenommen und schon gar nicht als solches reflektiert.
Wenn Radegundis Stolze in ihrem Einführungswerk in den hermeneutischen Ansatz demonstrieren will, was für „vielfältiges sprachliches Wissen“ (Stolze 1992: 272) zum Handwerkszeug des kompetenten Übersetzers gehört, ruft sie als Theoretiker Mario Wandruszka und dessen Konzept der muttersprachlichen Mehrsprachigkeit (Wandruszka 1979: 13ff.) auf und bemüht als Praktiker den renommierten Übersetzer Curt Meyer-Clason, der die ganze Bandbreite dieser innersprachlichen Mehrsprachigkeit durch Aufzählung von VertreterInnen diatopischer und diastratischer Varietäten eindrucksvoll (und wohl auch ein wenig großsprecherisch) vorführt:
Im Kopf muß das vorhanden sein, womit der Übersetzer arbeitet: vor allem seine Sprache, die Sprache von Vater und Mutter, seiner Geschwister, die Sprache vieler Menschen und Gesellschaftsklassen, seines Landes, seiner engeren Heimat mit ihrem Tonfall, Dialekt, Jargon, Slang. Der Übersetzer muß also im Ohr gespeichert haben, wie ein Handwerker, ein Hilfsarbeiter, ein Bürger der Vorkriegs- und Nachkriegszeit spricht, ein Beamter, ein Landedelmann aus dem Bayerisch-Österreichischen etwa, wie ein Hochschullehrer, ein Schulmann, wie ein Griechenschwärmer oder ein Atomkraftgegner redet, er muß die Suada der Medienarbeiter kennen, aber auch den Tonfall der Toilettenfrau in den Residenzstuben. (Zit. nach Stolze 1992: 272)
Und da Meyer-Clason offenbar bemüht war, nichts auszulassen, was je an Anforderungen an ihn gestellt wurde oder hätte gestellt werden können, fragt man sich, ob denn niemals in den vielen Werken, die er übersetzt hat, ein sprechendes Kind vorgekommen ist, dessen Tonfall im Ohr zu haben nötig gewesen wäre, um seine Äußerungen glaubwürdig wiederzugeben.
Niemand unter den deutschsprachigen Übersetzungswissenschaftlern hat nachdrücklicher als Rainer Kohlmayer betont, dass der Übersetzer sich in seine Figuren einfühlen müsse: „Das Einfühlungsvermögen ist die unhintergehbare Voraussetzung des Verstehens“ (Kohlmayer 2004: 23). Er hat als Theaterübersetzer und Theaterpraktiker naturgemäß primär Bühnenfiguren vor seinem geistigen Auge, aber viele seiner Forderungen lassen sich getrost verallgemeinern und sind auch so gemeint:
Die Originalfiguren haben als ästhetische Schöpfungen des Autors ein Recht auf ihre möglichst authentische Stimme und Sprache. Der Literaturübersetzer übersetzt nicht ‚Text‘, sondern Menschen und menschliche Stimmen. (Kohlmayer 2004: 19)
Dabei gesteht Kohlmayer dem Übersetzer zu, dass ihm die Empathie, die Einfühlung nicht die gesamte Figur in all ihren Facetten erschließt. Deswegen müsse die Fantasie, die er als „Fähigkeit zur emotionalen Hypothesenbildung“ (Kohlmayer 2004: 25; Kursivsetzung im Original) versteht, einspringen und weiterhelfen. Da solche Hypothesen in Bezug auf literarische Figuren nie auf ausreichend abgesicherte Indizien gestützt werden können, also im Stadium der Abduktion bleiben, wird vom Übersetzer Kreativität gefordert: „Der Begriff der ‚Kreativität‘ in der Übersetzungswissenschaft, wenn er nicht auf der Ebene eines Modebegriffs bleiben soll, müsste folglich als abduktive Kompetenz beschrieben werden“ (Kohlmayer 2004: 25; Kursivsetzung im Original).
Kohlmayer, der „der emotionalen Blindheit zerebraler Translationstheorien“ (Kohlmayer 2004: 25) das Einfühlungsvermögen entgegensetzt, fordert hier etwas, was in der translationsdidaktischen Fachliteratur wenig thematisiert wird, um es vorsichtig auszudrücken. Das bedeutet nun allerdings – ich kann das aus eigener Erfahrung behaupten – keineswegs, dass in praktischen Übungen, wenn es um ästhetisch geformte bzw. fiktionale Texte geht, das Hineindenken in Handeln und Sprechen von Figuren eine untergeordnete Rolle spielen würde. Im Gegenteil: Gerade wenn es um direkte Rede geht, sind die Studierenden oft recht unterschiedlicher Meinung darüber, wie denn nun die authentischste Äußerung einer Figur in einer bestimmten Situation lauten müsse. Nach längeren und manchmal ergebnislosen Diskussionen werden auch verschiedentlich Stimmen laut, die nach Anleitungen verlangen. Es müsse doch wissenschaftliche Literatur geben, aus der man lernen könne, was man bislang offenbar nicht richtig beherrsche. Andererseits verhärten sich die Positionen auch im Zug der Diskussion, wobei die Berufung auf das eigene Sprachgefühl eine zentrale Rolle zu spielen pflegt.
Solche Auseinandersetzungen, die nicht mit einem Kompromiss enden, auf den sich schließlich und endlich – und nicht vollends überzeugt – alle einigen, gehören zu den Glücksmomenten der Didaktik. Es genügt meistens, die Studierenden selbst zu der Einsicht kommen zu lassen, dass sich ihr eigenes Sprachgefühl in unterschiedlichen Regionen, in unterschiedlichen Milieus, durch unterschiedliche Lektüreerfahrungen und – was man leicht vergisst – durch unterschiedliche Nutzung der sozialen Medien herausgebildet hat. Dennoch sollten sich Gelegenheiten ergeben und wahrgenommen werden, über das Sprachgefühl und seine Bedeutung für ÜbersetzerInnen nachzudenken. Sowohl in der Sprach- als auch in der Übersetzungswissenschaft begegnet man dem Begriff selten. Das Sprachgefühl hatte einen kurzen öffentlichen Auftritt, nachdem im Jahr 1980 die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung die Preisfrage gestellt hatte: „Ist Berufung auf das ‚Sprachgefühl‘ berechtigt?“
Rufen wir uns in Erinnerung, warum wir überhaupt auf das Problem des Sprachgefühls gestoßen sind. Es ging darum, für Äußerungen (insbesondere in direkter Rede) einen möglichst lebensnahen, glaubwürdigen Ausdruck zu finden. Und entsprechend unserem Thema wollen wir uns im Besonderen die diesbezügliche Aufgabe einer Übersetzerin oder eines Übersetzers von Kinderbüchern vergegenwärtigen.
Sind die von der Akademie publizierten Antworten (Gauger et al. 1982) der Autoren (es sind sämtlich Männer) hilfreich, speziell im Hinblick auf unsere Thematik?
Die preisgekrönte Schrift (Gauger / Oesterreicher 1982) verengt den Horizont von Anfang an auf die transregionale Norm und auf die Dichotomie ‚richtig‘ vs. ‚falsch‘: „Die Berufung auf Sprachgefühl kann ja, offensichtlich, nur berechtigt sein, wenn es Gründe gibt, im Sprachgefühl einen verläßlichen Zeugen für Sprachrichtigkeit zu erblicken“ (Gauger / Oesterreicher 1982: 14). Soll das heißen, dass es in Bezug auf Dialekte oder sprachlichen Substandard kein Sprachgefühl – oder um ganz fair zu bleiben – keine berechtigte Berufung auf das Sprachgefühl gibt? So ist es, sagt Gauger, denn Dialekte sind nicht normiert, also fehlt der Maßstab für die Beurteilung der Richtigkeit.
Die Antwort von Helmut Henne wird ÜbersetzerInnen mehr Zustimmung entlocken. Henne bringt das Konzept der innersprachlichen Mehrsprachigkeit (ohne speziell auf Wandruszka zu verweisen) ins Spiel und sieht ganz realistisch, dass man rückfragen müsse: „Sprachgefühl in welcher Sprache? Wird nicht die Mehrzahl der Deutschsprachigen mehrere Varietäten teilweise sprechen und teilweise verstehen?“ (Henne 1982: 104), um danach zu schildern, wie sich Studierende an der Universität nach und nach die Praktiken des akademischen Diskurses aneignen müssen.1
In Übersetzungen steht man viel öfter als vor einem Urteil über ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ vor der Frage, ob eine Formulierung ‚angemessen‘ ist oder nicht. Angemessen für welche Person, für welche Situation? Hier haben ÜbersetzerInnen von Kinder- und Jugendbüchern vielfach ständig Entscheidungen jenseits übersetzerischer Routinen zu treffen.
4.2 Beispiele
Kommen wir nun zurück zu unserem Ausgangspunkt für das Kapitel über das Sprachgefühl: Es war die Frage der jungen Leserin aus der Südpfalz, warum die Figuren in Christine Nöstlingers Geschichten „so komisch“ reden. Nun weiß man, wenn man sich für Kinderliteratur interessiert, dass ein falscher Zungenschlag ihrer Heldinnen und Helden der geringste Vorwurf ist, den man der österreichischen Schriftstellerin machen kann. Die Lebensnähe der von ihr geschaffenen Gestalten und ihrer Konflikte ist Anlass für viele einschlägige Preise und für ihr hohes Ansehen in der Branche.
Die Antwort liegt auf der Hand. Während sich LeserInnen etwa in Frankreich, um sich ein Urteil über die sprachliche Authentizität eines jungen Protagonisten zu bilden, fragen würden: Wie alt ist das Kind und in welchem sozialen Milieu bewegt es sich?, muss im deutschen Sprachraum die erste Frage der regionalen Herkunft gelten. Kinder aus Berlin sprechen anders als Kinder in München oder in Wien, auch wenn sie derselben sozialen Schicht angehören. So wie es im deutschen Sprachraum keinen überregionalen Substandard gibt, existiert auch keine gesamtdeutsche Kinder- und Jugendsprache, auch wenn TV-Serien für die Verbreitung einer Reihe von sprachlichen Innovationen sorgen, die von Kindern leicht aufgenommen und oft auch schnell von Erwachsenen in ihren Sprachschatz integriert werden.
Die Verschränkung von Diatopik und Diastratik im deutschen Sprachraum ist ÜbersetzerInnen als Problem wohlvertraut (und gut beschrieben, z. B. bei Albrecht 2005: 243ff.). Dagegen muss man sich bei Übersetzungen aus dem Deutschen in der Regel keine Gedanken über Helvetismen oder Austriazismen machen. Wenn Nöstlingers Kinder über die Schule reden und von ihren Fünfern oder vom Sitzenbleiben erzählen, ist das für italienische oder französische ÜbersetzerInnen kein Anlass, sich irgendwelche Normabweichungen auszudenken.1 Die sprachliche Irritation ist eine rein innerdeutsche. Es scheint, als sollte es zur leichteren Verbreitung österreichischer Kinderliteratur intralinguale Übersetzungen geben. Wir werden gleich sehen, dass die Idee nicht so skurril ist, wie sie auf den ersten Blick anmuten könnte.
Die Tatsache, dass das Deutsche eine plurizentrische Sprache ist, wurde bei der Buchproduktion lange Zeit ignoriert. Was richtiges Deutsch ist, wurde mit demographisch-statistischen Argumenten geklärt. Seit einigen Jahrzehnten wehren sich viele Sprecher jedoch gegen die traditionelle Ansicht, ihr Deutsch sei eine – mit welchen wohlwollenden Adjektiven auch immer belegte – Abweichung von der einzig gültigen Norm. Organisierter (friedlicher) Widerstand hat bei den ‚Minderheiten‘ sowohl zu größerer sprachlicher Sensibilität als auch zur Stärkung des Selbstbewusstseins geführt und im Bereich der für Kinder produzierten Lesestoffe für Initiativen gesorgt, die dem Sprachgefühl Qualitäten abverlangen, die bislang wenig gefragt und noch weniger trainiert wurden. Dazu im Anschluss drei unterschiedlich gelagerte Fälle.
a) Wenn deutsches Lesematerial an österreichischen Schulen verwendet werden soll, kommt es neuerdings relativ häufig vor, dass es an den österreichischen Sprachgebrauch angepasst wird. Eine Mitarbeiterin des Innsbrucker Instituts für Translationswissenschaft etwa bearbeitet die von einem im Rheinland beheimateten Verlag herausgegebenen Lies mal-Hefte für österreichische SchülerInnen, indem sie Lexik, Idiomatik und Syntax an den Sprachgebrauch des Zielpublikums anpasst (z.B. also Schnürsenkel zubinden durch Schuhbänder binden, ausmalen durch anmalen, Grundschule durch Volksschule ersetzt). Diese Art der intralingualen Übersetzung hat in Österreich wenig Tradition und erfordert daher, da die Routine fehlt, sehr viel Konzentration und Fingerspitzengefühl, natürlich auch sprachliches Wissen. Manchmal, aber längst nicht immer, kann man sich heute im Variantenwörterbuch des Deutschen (Ammon et al. 2004) Rat oder Rückendeckung holen. Das Verständnis des deutschen Verlegers für die Bearbeitung kommt in einer bemerkenswerten Formulierung zum Ausdruck: Er ersucht die Bearbeiterin, „besonders auf die Unterschiede in unseren Sprachen[!] zu achten“.2
b) Das zweite Beispiel wurde bereits unter Punkt 3 angesprochen. Es handelt sich um die Manolito-Reihe. Bevor die Innsbrucker Studierenden die Übersetzung eines weiteren Manolito-Bandes in Angriff genommen haben, wurde eine genaue Übersetzungsanalyse eines schon publizierten Buchs erstellt. Neben vielen übersetzerischen Defiziten wurde auch die unüberhörbare sprachliche Verortung im norddeutschen Raum bemängelt.
Die eigene Übersetzung der Studierenden (Manolitos geheimstes Geheimnis, 2004) ist nun sehr bewusst von Austriazismen freigehalten. Dennoch ist die sprachliche Identität Manolitos, der ja als Ich-Erzähler den Büchern seine Stimme verleiht, eine völlig andere als in den Übersetzungen von Sabine Müller-Nordhoff. Wäre die Version der österreichischen Studentinnen vom Hamburger Verlag übernommen worden, hätte die Manolito-Lesergemeinde sie sicherlich herb kritisiert, weil der Protagonist ein neues sprachliches Profil – diesmal ein eher süddeutsches – bekommen hat. Die Aufgabe, die sich die Übersetzerinnen gestellt hatten, war schlicht nicht lösbar, weil die Varietäten-Architektur der deutschen Sprache hier eine unüberwindbare Hürde errichtet.
c) Eine überaus innovative Konstellation stellt die französische Buchreihe Les P’tites Poules mit ihren Übersetzungen dar. Der Autor Christian Jolibois und der Illustrator Christian Heinrich zeichnen für eine Reihe von Büchern verantwortlich, die sowohl zum Vorlesen als auch zum Selberlesen gedacht sind. Die Protagonisten sind Hühner, die mehr oder weniger aufregende Abenteuer – vom Familienzuwachs (Jolibois/Heinrich 2002) bis zur Atlantiküberquerung (Jolibois/Heinrich 2000) – erleben.
Die Übersetzungen erscheinen beim Wiener Ringelspiel3-Verlag in zwei Versionen: in einer österreichischen Übersetzung von Martina Ebmer und in einer – laut Homepage – „deutschlandtauglichen“ Fassung von Heike Kriston. In gewisser Weise handelt es sich um experimentelle, also überaus kreative Übersetzungen, denn für die Sprachenpaare Französisch-Österreichisch und Österreichisch-Bundesdeutsch wird man nirgends ausgebildet. Auf der Homepage des Ringelspiel-Verlags wird natürlich begründet, warum die Bücher immer paarweise erscheinen:
Ökonomisch ist Vereinheitlichung immer die günstigere Variante. Und das Große schluckt mit der Zeit das Kleine. Im Kulturbereich führen solche Entwicklungen zu einer langweiligen Verarmung. Deshalb geht es dem Ringelspiel Verlag um die Erhaltung von Artenvielfalt. Und um die Erhaltung von jeder Menge Spaß in der Kommunikation zwischen deutschsprachigen Menschen aus Österreich und Deutschland.4
Wie die Versionen der P’tites Poules-Serie aussehen, sei an einigen wenigen Beispielen vorgeführt. Die österreichische Varietät manifestiert sich hier (und in anderen Büchern) schon im Titel:
| Frz.: | La petite poule qui voulait voir la mer |
| Ö.-dt.: | Ein kleines Henderl will das Meer sehen |
| Dt.: | Ein kleines Hühnchen will das Meer sehen |
Die Henne Carméla ist des eintönigen Lebens auf dem Hühnerhof überdrüssig. Sie lässt sich lieber von dem weitgereisten Kormoran Pédro Geschichten erzählen, auch wenn nicht alle seine Berichte absolut vertrauenswürdig sind:
| Frz. | Pédro a beaucoup voyagé! Et même s’il est un peu menteur, la petite poule adore les histoires merveilleuses qu’il raconte. (6)5 |
| Ö.-dt. | Pedro ist nämlich weit gereist! Er ist zwar manchmal ein Schmähtandler, aber das kleine Henderl liebt seine wunderbaren Geschichten. |
| Dt. | Pedro ist nämlich weit gereist! Er ist zwar manchmal ein Aufschneider, aber das kleine Hühnchen liebt seine wunderbaren Geschichten. |
Und dann macht sich Carméla selbst auf den Weg, eine ganze Nacht lang, bis sie ihre Beine nicht mehr spürt:
| Frz. | Mais, au matin, ses efforts sont récompensés. Arrivée au sommet d’une dune, elle aperçoit enfin … / … la mer ! (16/18) |
| Ö.-dt. | Aber am nächsten Tag in der Früh wird sie für alle Anstrengungen belohnt […] |
| Dt. | Aber am nächsten Morgen wird sie für alle Anstrengungen belohnt. |
Schließlich landet Carméla mit der Flotte des Kolumbus in Amerika und wird dort von einer Hühnerfamilie willkommen geheißen. Der kleine rote Hahn Pitikok nimmt sich ihrer an und lässt Carméla eine Menge neuer kultureller Erfahrungen machen:
| Frz. | – Pitikok? Je voudrais te demander … Pourquoi les poules de chez vous ont-elles le derrière tout nu ? |
| – C’est la coutume. Les Indiens utilisent nos plus jolies plumes pour se faire beaux ! Suis-moi dans ma cachette secrète, Carméla, on sera plus tranquilles ! | |
| – Chouette ! Dis ? Je peux reprendre de ces bonbons jaunes ? | |
| – C’est pas des bonbons, c’est du maïs ! (35) | |
| Ö.-dt. | – Du, Pitikok ? Ich habe eine Frage … warum haben die großen Hendln bei euch eigentlich alle einen nackerten Popsch? |
| – Das ist bei uns so Brauch. Die Indianer verwenden unsere schönsten Federn, um sich damit zu schmücken! Komm mit in mein Geheimversteck, Carmela! Da haben wir mehr Ruhe. | |
| – Ja, gute Idee! Sag, darf ich noch ein paar von diesen gelben Zuckerln haben? | |
| – Sicher. Aber das sind keine Zuckerln, sondern Kukuruzkörner! | |
| Dt. | – Ähm, Pitikok? Ich habe da mal eine Frage … warum haben die großen Hühner bei euch eigentlich alle einen nackten Popo? |
| – Das ist bei uns so Brauch. Die Indianer verwenden unsere schönsten Federn, um sich damit zu schmücken! Komm mit in mein Geheimversteck, Carmela! Da haben wir mehr Ruhe! | |
| – Ja, gute Idee! Sag mal, kann ich noch von diesen gelben Bonbons haben? | |
| – Klar. Aber das sind keine Bonbons, das sind Maiskörner! |
Auch wenn an mehreren Stellen klar ersichtlich ist, dass die (bundes-)deutsche Fassung auf der österreichischen und nicht auf der französischen beruht, also eine intralinguale und keine interlinguale Version darstellt, sind die Unterschiede beachtlich. Da österreichische Kinder im Allgemeinen Bücher lesen, die für den gesamtdeutschen Markt bestimmt sind, kann man ermessen, wie weit die deutschen Fassungen gewöhnlich von ihren alltagssprachlichen Erfahrungen entfernt sind.