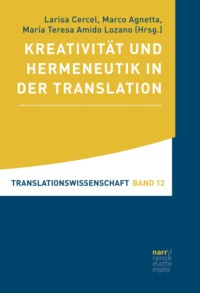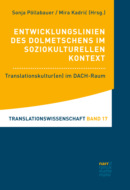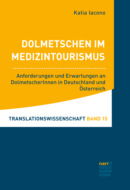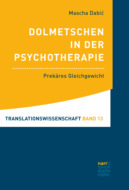Kitabı oku: «Kreativität und Hermeneutik in der Translation», sayfa 9
Für die beiden Übersetzerinnen stellte der Übersetzungsauftrag sicher eine große Herausforderung an ihr sprachliches Einfühlungsvermögen dar, da österreichische ÜbersetzerInnen nicht gewohnt sind, in Übersetzungen auf die Ressourcen ihrer Varietät zurückgreifen zu dürfen (sondern ihnen im Gegenteil während der Ausbildung alles, was aus bundesdeutscher Sicht diatopisch markiert ist, konsequent „abtrainiert“ zu werden pflegt), und bundesdeutsche TranslatorInnen kaum je in die Situation kommen, Texte aus einer anderen deutschen Varietät ins „Hochdeutsche“ zu bringen.
5 Fazit und Ausblick
Das Übersetzen von Kinderliteratur hat bisher wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, auch innerhalb des hermeneutischen Paradigmas, was etwas verwundert. In ihrer umfassenden Darstellung von Geschichte und Leistung dieses Ansatzes hebt Larisa Cercel (2013: 126) die besondere Breite des Blickwinkels bei der namhaftesten Vertreterin hermeneutischen Übersetzungsdenkens im deutschen Sprachraum, Radegundis Stolze, hervor: „Sie demonstriert den hermeneutischen Ansatz an den diversesten Textsorten, reichend von technischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen bis hin zur Bibelübersetzung und Übersetzung von Dichtung.“
Von Texten für Kinder ist in den einschlägigen Monographien, soweit ich sehe, jedoch nur ein einziges Mal die Rede, und zwar ganz en passant in einem Zitat, dessen Aussage noch dazu dringend korrekturbedürftig ist. Reiß/Vermeer dekretieren bezüglich der Funktion des Translats (wobei es hier mehr um textsortenadäquaten Stil als um die Funktion geht): „So soll z. B. ein Fachtext für Fachleute sachlich und klar informieren […]; Kinder erwarten Kindersprache; Geschäftsbriefe sind sachlich und höflich […]“ (zit. in Stolze 1992: 195). Kinder erwarten Kindersprache nicht grundsätzlich, sondern nur dort, wo tatsächlich Kinder sprechen; ansonsten lassen sie sich von ‚erwachsenen‘ Erzählern sehr wohl in sprachliche Regionen entführen, die ihnen (noch) weniger vertraut sind; das ist ja eines der ‚Geheimnisse‘ des Bildungswerts von Lektüre.
Von Texten abgesehen, die man auf mehreren Ebenen lesen kann und deren Faszination nicht zuletzt auf der Mehrfachadressierung beruht, sind Kinderbücher im Allgemeinen aus der Sicht erwachsener Leser inhaltlich nicht in der gleichen Weise deutungsbedürftig wie höhenkammliterarische Texte, denen das Merkmal der Polyinterpretabilität eignet. Daraus abzuleiten, dass das Übersetzen von Kinderliteratur deshalb anspruchslos sei, ist ein Fehlschluss, der zu jenem Prestigedefizit führt, von dem in der Einleitung die Rede war.
Ob es treffend ist, das Übersetzen als solches in Anlehnung an Wittgenstein eine „exakte Kunst“ zu nennen (vgl. Cercel 2013: 60, Ausdruck im Zitat von George Steiner), sei dahingestellt; mir scheint die Charakterisierung als „gelehrte Kunst“ (Kohlmayer/Pöckl 2004) besser zu passen, auch im Sinn der hermeneutischen Lehre, die verlangt, dass ein Übersetzer die Adäquatheit seiner Vorschläge reflektieren und begründen können muss: „Auch wenn seine Übersetzungslösungen im ersten Impuls intuitiv-kreativ erfolgen, muss er in der Lage sein, sie im Nachhinein anhand linguistischer Kriterien zu begründen“ (Stolze 2008: 228).1 In unserem Zusammenhang würde also eine wesentliche Frage lauten: Reden Kinder tatsächlich so, wie ich sie reden lasse?
In Bezug auf den deutschen Sprachraum – das sollte aus den vorangegangenen Ausführungen klar hervorgegangen sein – ist die Frage präziser zu stellen: Wo, sollte sich die Übersetzerin, der Übersetzer fragen, siedle ich die Kinder meiner Geschichte an? Gebe ich ihnen (bewusst) eine regionale sprachliche Identität? Dagegen stehen meist ökonomische Überlegungen; oft ist auch die Logik der Geschichte nicht kompatibel mit der Wahl einer bestimmten deutschen Sprachlandschaft (z. B. wenn die Handlung in einem anderen Land spielt). Die Strategie des Ringelspiel-Verlags ist bisher ein Ausnahmefall, sie dürfte aber in absehbarer Zeit Nachahmer finden. Die gelegentlich gewählte Alternative besteht in der Situierung im sprachlichen Niemandsland, in einer weitgehend neutralisierten Sprache, in der sich Kinder allerdings nicht wiederfinden. Eine neue Orientierungsgröße, die den Medien zu verdanken ist, scheint das TV-Synchronisationsdeutsch von Kinderserien darzustellen. Es dürfte seitens der AdressatInnen auf relativ wenig Ablehnung stoßen, da es vielen Kindern vertraut ist; als Mittel zum Ausbau der Sprachkompetenz und der sprachlichen Sensibilität taugt es freilich wenig.
Bleibt als Erkenntnis, dass das Übersetzen von Kinderbüchern doch keine langweilige und leichte, sondern gerade im deutschen Sprachraum fast immer eine heikle, ja unmögliche Aufgabe ist. Ein deutschsprachiger Kinderbuch-Übersetzer wird sich gelegentlich an den guten Utopisten von José Ortega y Gasset (1937/1963) erinnert fühlen, und das ist eine Assoziation, die ihn einerseits vor Routine und andererseits vor Resignation bewahrt.
Bibliographie
Primärtexte
Jolibois, Christian / Heinrich, Christian (2000): La petite poule qui voulait voir la mer. Paris: PKJ.
Dies. (2012): Ein kleines Henderl will das Meer sehen. Übersetzung: Martina Ebmer. Wien: Ringelspiel.
Dies. (2012): Ein kleines Hühnchen will das Meer sehen. Lektorat: Heike Kriston und Christian Suppan. Wien: Ringelspiel.
Dies. (2002): Le jour où mon frère viendra. Paris: PKJ.
Dies. (2012): Wenn mein kleiner Bruder auf die Welt kommt. Übersetzung: Martina Ebmer. Wien: Ringelspiel.
Dies. (2012): Der Tag, an dem mein Brüderchen schlüpft. Lektorat: Heike Kriston und Christian Suppan. Wien: Ringelspiel.
Lindo, Elvira (2000): Manolito. Deutsch von Sabine Müller-Nordhoff. Mit Illustrationen von Oliver Wenniges. Hamburg: Klopp.
Lindo, Elvira (52003): Manolito tiene un secreto. Ilustraciones de Emilio Urberuaga. Madrid u.a.: Alfaguara.
Lindo, Elvira (2004): Manolitos geheimstes Geheimnis. Übersetzung von Studierenden der Universität Innsbruck. Axams bei Innsbruck: Steiger (Selbstverlag).
Lindo, Elvira (2010): Manolito Gafotas. Mit Zeichnungen von Emilio Urberuaga. Hg. von Klaus Amann. Stuttgart: Reclam (= RUB 19785).
Lindo, Elvira (2013): Pobre Manolito. Mit Zeichnungen von Emilio Urberuaga. Hg. von Klaus Amann und Ana López Toribio. Stuttgart: Reclam (= RUB 19857).
Sekundärliteratur
Albrecht, Jörn (2005): Übersetzung und Linguistik. Tübingen: Narr.
Ammon, Ulrich et al. (2004): Varietätenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. Berlin / New York: de Gruyter.
Benjamin, Walter (1923 / 1963): „Die Aufgabe des Übersetzers“. In: Störig, Hans Joachim (Hrsg.): Das Problem des Übersetzens. Stuttgart: Goverts, 182–195.
Blume, Svenja (2001): Pippi Långstrumps Verwandlung zur „dame-bien-élevée“. Hamburg: Kovač.
Cercel, Larisa (2013): Übersetzungshermeneutik. Historische und systematische Grundlegung. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.
Gauger, Hans-Martin / Oesterreicher, Wulf (1982): „Sprachgefühl und Sprachsinn“. In: Gauger et al. (Hrsg), 9–90.
Gauger, Hans-Martin / Henne, Helmut / Geier, Manfred / Müller, Wolfgang (Hrsg.) (1982): Ist Berufung auf ‚Sprachgefühl‘ berechtigt? Heidelberg: Lambert Schneider.
Heller, Lavinia (2013): Translationswissenschaftliche Begriffsbildung und das Problem der performativen Unauffälligkeit von Translation. Berlin: Frank & Timme.
Henne, Helmut (1982): „Der Berufung wird stattgegeben. Plädoyer für die Entwicklung von Sprachgefühl“. In: Gauger et al. (Hrsg.), 91–137.
House, Juliane (2004): „Linguistic Aspects of the Translation of Children’s Books”. In: Kittel, Harald et al. (Hrsg.): Übersetzung / Translation / Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung, Bd. 1. Berlin / New York: de Gruyter, 683–697.
Kohlmayer, Rainer (2004): „Einfühlungsvermögen – Von den menschlichen Grundlagen des Literaturübersetzens“. In: Kohlmayer, Rainer / Pöckl, Wolfgang (Hrsg.): Literarisches und mediales Übersetzen. Ansätze zu Theorie und Praxis einer gelehrten Kunst. Frankfurt am Main: Lang, 11–30.
Ortega y Gasset, José (1937/1977): Miseria y Esplendor de la Traducción / Elend und Glanz der Übersetzung. München: Deutscher Taschenbuch Verlag (= dtv zweisprachig).
Pöckl, Wolfgang (2011): „Dichter übersetzt Kind. H. C. Artmann und Daisy Ashford“. In: Bauer, Matthias et al. (Hrsg.): Sprache, Literatur, Kultur: Translatio delectat. Festschrift für Lothar Černý zum 65. Geburtstag. Berlin/Münster: LIT, 233–245.
Stolze, Radegundis (1992): Hermeneutisches Übersetzen. Linguistische Kategorien des Verstehens und Formulierens beim Übersetzen. Tübingen: Narr.
Stolze, Radegundis (2008): Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 5., überarb. u. erw. Aufl. Tübingen: Narr.
Störig, Hans Joachim (1963): „Einleitung.“ In: ders. (Hrsg.): Das Problem des Übersetzens. Stuttgart: Goverts, VII–XXXIII.
Wandruszka, Mario (1979): Die Mehrsprachigkeit des Menschen. München: Piper.
Wild, Reiner (Hrsg.) (1990): Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. Stuttgart: Metzler.
Wilke, Beatrice (2015): „Zur Übersetzbarkeit der Austriazismen: Christine Nöstlingers Romane auf Italienisch“. In: Lavric, Eva / Pöckl, Wolfgang (Hrsg.): Comparatio delectat II. Akten der VII. Internationalen Arbeitstagung zum romanisch-deutschen und innerromanischen Sprachvergleich. Frankfurt am Main: Lang, 817–832.
Unendliche Vervielfachung. Raymond Queneaus Exercices de style und ihre deutschen Übersetzer
Angela Sanmann (Lausanne)
Abstract: Raymond Queneau’s Exercices de style was first translated into German by Ludwig Harig and Eugen Helmlé in 1961, and retranslated by Frank Heibert and Hinrich Schmidt-Henkel in a new, extended version in 2016. By confronting and analyzing the different versions of Queneau’s Exercices Maladroit, Métaphoriquement, Olfactif and Paréchèses, my essay shows how the French author’s formal strategies and self-imposed constraints in each “exercise”, far from resulting in untranslatability, in fact activate (and even enhance) the creative potential of the translational act. Necessarily, every translator of the Exercices becomes, to a certain extent, a writer in his or her own right. Moreover, I argue that the fundamental principle of Queneau’s œuvre, namely, the “infinite proliferation” of a banal everyday scene, is best realized through translation and its inevitable proliferation of meaning(s) and variations. In this neverending process, every (re-)translation is tied up to its predecessor(s), deliberately or not, in a differential fashion. In my contrastive analysis of the German versions of Queneau’s Exercices de style, I distinguish between (I) retranslation as continuation and (II) retranslation as updating, not only of aesthetics, but also of the social reality represented in Queneau’s texts.
Keywords: Raymond Queneau, Exercices de style, creativity, (re-)translation, infinite proliferation.
40 Jahre nach Raymond Queneaus Tod und 55 Jahre nach Erscheinen der ersten deutschen Exercices de style-Fassung von Ludwig Harig und Eugen Helmlé haben Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel eine erweiterte Neuübersetzung vorgelegt. Der folgende Beitrag stellt ausgewählte Stilübungen in beiden Versionen vergleichend nebeneinander und analysiert sie im Rückgriff auf die von ihren Verfassern formulierten Zielsetzungen. Dabei soll zweierlei gezeigt werden: Erstens, dass sprachliche Kreativität durch die Vorgabe bestimmter Regeln und Koordinaten, wie sie formbewussten (lyrischen) Texten zugrunde liegen, nicht eingeschränkt, sondern im Gegenteil gerade herausgefordert wird – und zwar im Ausgangs- wie auch im übersetzten Text. Zweitens, dass die Grundidee von Queneaus Exercices, die „prolifération infinie“1, die unendliche Vervielfachung eines banal-alltäglichen Themas, sich ihrer Anlage nach überhaupt erst im unabschließbaren Prozess des (Neu‑)Übersetzens realisieren lässt.
Seit Barbara Wright 1958 die erste Exercices-Übersetzung verfasst hat, haben insgesamt mehr als 32 Übersetzungen diese „prolifération“ der ursprünglich 99 Varianten von Queneaus Autobusgeschichte fortgeführt. Bereits im Vorwort zu ihrer englischsprachigen Fassung Exercises in Style reflektiert Wright die Spannung zwischen der Sprache als System und der Eigenlogik der Einzelsprachen, wie sie von Queneau-Übersetzern bis heute fruchtbar gemacht wird – allen Zweifeln an der Übersetzbarkeit der Exercices zum Trotz:
I thought that [Exercices de style] was an experiment with the French language as such, and therefore as untranslatable as the smell of garlic in the Paris metro. But I was wrong. In the same way as the story as such doesn’t matter, the particular language it is written in doesn’t matter as such. Perhaps the book is an exercise in communication patterns, whatever their linguistic sounds. And it seems to me that Queneau’s attitude of enquiry and examination can, and perhaps should? – be applied to every language […]. (Wright 1958/2009: 16)
Queneaus Exercices, so lässt sich folgern, verlangen also geradezu danach, übersetzt zu werden, denn in jeder neuen Fassung verschieben sich, entsprechend der inneren Logik der jeweiligen Zielsprache, die im Ausgangstext angelegten Bedeutungsvektoren und generieren – ganz im Sinne Queneaus – ihrerseits neue Bedeutungen. Auf diese Weise inszenieren Queneau, und nach ihm seine Übersetzerinnen und Übersetzer, die von Wilhelm von Humboldt formulierte Einsicht, dass „die Sprachen nicht eigentlich Mittel sind, die schon erkannte Wahrheit darzustellen, sondern weit mehr, die vorher unbekannte zu entdecken.“ Denn, so Humboldt weiter, die Verschiedenheit der Sprachen „ist nicht eine von Schällen und Zeichen, sondern eine Verschiedenheit der Weltansichten selbst. Hierin ist der Grund, und der letzte Zweck aller Sprachuntersuchung enthalten“ (Humboldt 1820: 27). Queneaus Exercices lassen sich als eine poetisch umgesetzte „Sprachuntersuchung“ im Sinne Humboldts verstehen, die im Vorgang des Übersetztwerdens unendlich potenziert wird – worin sich überhaupt erst ihre Verfasstheit als „prolifération infinie“ manifestiert.
Die besondere Komplexität von Queneaus „Sprachuntersuchung“ liegt nun darin, dass die sprachliche Virtuosität des OuLiPo-Autors sich nicht im Aufstellen bzw. (Über-)Erfüllen oder Unterwandern der selbstauferlegten Regeln erschöpft. Tatsächlich generieren seine poetischen Verfahrensweisen ihrerseits Überschüsse, die sich selbst nicht mehr aus diesen Regeln ableiten lassen: Klangketten, Motivreihen oder doppelte Lesarten – die „Nebenprodukte“ von Queneaus verdichtenden poetischen Prozessen sind so unterschiedlich wie die ursprünglich 99 Stilübungen selbst. Und wiederum ist die Übersetzung der prädestinierte Ort, an dem sich die poetischen Strukturen der Exercices vervielfachen, in jeder zielsprachlichen Fassung neu.
1 Neuübersetzung als Fortschreibung
Besonders gut nachvollziehen lässt sich der Prozess der poetischen Vervielfachung in der vergleichenden Analyse zweier Übersetzungen in die gleiche Sprache. Mal variiert die Neuübersetzung die in der Erstübersetzung gefundenen Lösungen (1), mal entwickelt sie diese weiter und spinnt sie fort (2).
(1.) Ein sprechendes Beispiel für die Neuübersetzung als Variation bietet die Analyse der deutschen Übersetzungen von Queneaus Stilübung Botanique, in der es vom Protagonisten heißt: „Mais, des dattes ! fuyant une récolte de châtaignes et de marrons, il alla se planter en terrain vierge“ (Queneau 2012: 142).1 Harig und Helmlé finden für jede der von Queneau verwendeten Redensarten samt ihres botanischen Kontextes eine Entsprechung in der deutschen Sprache: „Aber Pusteblume, um keine Knallschoten zu ernten, schlug er sich in die Büsche und verpflanzte sich dann in Brachland“ (Harig/Helmlé 1961: 135). Die hier gewählte Herangehensweise steht im Einklang mit der von Harig beschriebenen Strategie der „Naturalisierungen“ oder „Umsetzungen“, bei der „an Stelle der scharfen Deckung des Wortmaterials Äquivalenz“ angestrebt werde (Harig 1961: 284). Ähnlich gehen auch Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel vor, die in ihrer Neuübersetzung (ob bewusst oder unbewusst) einzelne Elemente der Erstübersetzung übernehmen und andere variieren oder ganz ersetzen: „Aber, Pusteblume! Da flüchtet er lieber, bevor er Nüsse und Feigen erntet, und pflanzt sich in jungfräuliche Erde“ (Heibert/Schmidt-Henkel 2016a: 104).
(2.) Dass eine Neuübersetzung in Bezug auf die Erstübersetzung aber auch eine Weiterentwicklung darstellen kann, zeigt der Vergleich der deutschen Fassungen der Stilübung Maladroit. In dieser Exercice klagt ein schriftstellerisch ambitionierter Ich-Erzähler über die Mühe, die es ihm bereitet, seine Erlebnisse auf der Plattform des Autobusses niederzuschreiben. In seiner Not versucht er, sich mit Hilfe eines abgewandelten französischen Sprichworts Mut zu machen: „C’est en écrivant qu’on devient écriveron“ (Queneau 2012: 98), heißt es in Anlehnung an die Redewendung „C’est en forgeant qu’on devient forgeron” (dt.: „Nur durchs Schmieden wird man zum Schmied“). In ihrer Fassung von 1961 konzentrieren sich Ludwig Harig und Eugen Helmlé bei der Übertragung des Sprichworts auf das Stilmittel der Wiederholung: „Nur schreibend wird man Schreibender“ (Harig/Helmlé 1961/2007: 80). Ausgespart bleibt in dieser Lesart die Dimension der spielerischen Transformation: Während Queneau nach dem Vorbild „forgeron“ das Kunstwort „écriveron“ (in Anlehnung an „écrivain“) bildet, beschränken sich Harig und Helmlé auf eine relativ wörtliche Übertragung ohne Wortbildungsambitionen.
In ihrer Neuübersetzung lösen Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel sich offenbar stärker vom Original als ihre Vorgänger es getan haben und erschließen sich damit einen Spielraum, der eine kreative Umsetzung des französischen Sprichworts begünstigt. Das Ergebnis ist ein Neologismus, der Queneaus eigener Wortneuschöpfung strukturell verwandt ist: „Übung macht den Schreibster“ (Heibert/Schmidt-Henkel 2016a: 62). „Meister“ und „Schreibster“ stehen in einem ähnlichen Verhältnis zueinander wie „forgeron“ und „écriveron“. Darüber hinaus weckt das Wort „Schreibster“ Assoziationen an aktuell im deutschen Sprachraum geläufige Wendungen wie „Hipster“ oder „Flinkster“ und markiert die Fassung offensiv als eine Re-Inszenierung in der Zielsprache Deutsch. Queneaus poetische Verfahren werden als solche im Deutschen fortgeführt – ein Vorgehen, das mit Hinrich Schmidt-Henkels Aussage korrespondiert, Übersetzen sei für ihn „Schreiben wie der Autor – mit den Mitteln der anderen Sprache“ (Heibert/Schmidt-Henkel 2016c: 18).
Dass Übersetzen aber nicht nur ein „Schreiben wie der Autor“, also nicht nur ein Nachschreiben, sondern in bestimmten Fällen auch ein Fortschreiben des Ausgangstextes sein kann, das die Bedeutungsdimensionen der jeweiligen Stilübung in der Zielsprache noch einmal potenziert, lässt sich beispielhaft an den Übersetzungen der Stilübung Métaphoriquement aufzeigen. In dieser Variante der Autobus-Szenerie greift Queneau auf eine Reihe bildlicher Ausdrücke aus dem Tierreich zurück:
Métaphoriquement
Au centre du jour, jeté dans le tas des sardines voyageuses d’un coléoptère à l’abdomen blanchâtre,2 un poulet au grand cou déplumé harangua soudain l’une, paisible, d’entre elles et son langage se déploya dans les airs, humide d’une protestation. Puis attiré par un vide, l’oisillon s’y précipita.
Dans un morne désert urbain, je le revis le jour même se faisant moucher l’arrogance pour un quelconque bouton.
(Queneau 2012: 33)
Die Passagiere als ein Haufen dicht zusammengedrängter Sardinen, der Autobus als weißer Käfer und der Protagonist selbst als Huhn mit kahlgerupftem Hals – diese Verkettung von Bildspendern aus der Tierwelt bildet nur eine Dimension der vorliegenden Exercice. Zusätzlich lässt sich eine konsonantische Klangkette aus p- und k-Lauten ausmachen, die den gesamten ersten Teil des Textes strukturiert: „coléoptère“ – „carapace“ – „poulet“ – „cou“ – „déplumé“ – „paisible“ – „déploya“ – „protestation“ – („puis“) – („par“) – „précipita“. Allein anhand der lautlich miteinander verbundenen Substantive und Verbformen ließe sich der Ablauf von Queneaus Kürzestgeschichte rekonstruieren.
Mit welchen Strategien reagieren Queneaus deutsche Übersetzer auf diese Verknüpfung aus Motiv- und Klangverkettung? Die Fassungen von 1961 bzw. 2016 lauten:
Metaphorisch
Im Zentrum des Tages, auf den Haufen reisender Sardinen eines Käfers mit dickem, weißem Rückenschild geworfen, kanzelte mit einem Male ein Hähnchen, mit großem, gerupftem Halse eine von ihnen, die friedliebende, ab, und seine Rede breitete sich, feucht von Einspruch, in den Lüften aus. Dann, von einer Leere angezogen, stürzte sich das Vögelchen hinein.
In einer düsteren Häuserwüste sah ich es am selben Tage wieder, als es sich den Dünkel wegen irgendeines Knopfes aus der Nase ziehen ließ.
(Harig/Helmlé 1961/2007: 11)
Metaphorisch
Im Zenit des Tages predigte in einem Käfer mit weißlichem Unterleib, der als Dose für reisende Sardinen diente, ein Hähnchen mit gerupftem Langhals überfallartig einer friedlichen unter ihnen, und seine Worte entfalteten sich klagefeucht in den Lüften. Dann stürzte sich der Jungvogel in eine lockende Leere. Am selben Tage erblickte ich ihn in einer trüben städtischen Wüstenei, als er sich gerade wegen irgendeines Knopfes auf die Hühneraugen steigen ließ.
(Heibert/Schmidt-Henkel 2016a: 10)
Während sich die Erstübersetzung von Ludwig Harig und Eugen Helmlé auf die Bildung einer ü-Klangkette fokussiert („Lüften“ – „stürzte“ – „düsteren“ – Häuserwüste“ – „Dünkel“), greifen Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel Queneaus klangakrobatische Verfahren auf und erfinden sie im Deutschen neu. Entsprechend wird die gesamte Stilübung klanglich durchformt: Neben einer ü-Assonanz, die sich teilweise mit derjenigen aus Harigs/Helmlés Fassung deckt („überfallartig“ – „Lüften“ – „stürzte“ – „trüben“ – „Wüstenei“ – „Hühneraugen“), stehen Echoeffekte („Sardinen“ – „diente“) und Alliterationen („lockende Leere“). Diese Lautspiele bereiten jedoch nur den Rahmen für ein ungleich komplexeres Klanggebilde, mit dem sich die Übersetzer vom Original emanzipieren und es mit den Mitteln der deutschen Sprache fortschreiben. Dazu lassen Heibert und Schmidt-Henkel metaphorische, lautliche und idiomatische Elemente interagieren. Den Ausgangspunkt bildet das bei Queneau angelegte Vogelmotiv („poulet“/„l’oisillon“), das in der Übersetzung auf zweierlei Weise weitergesponnen wird:
1. Aus dem Doppelvokal „ei“ legen die Übersetzer eine Klangkette durch den gesamten Text und spielen damit immer wieder auf das dem Vogelmotiv zuzuordnende „Ei“ an („weißlichem Unterleib“/„reisende“, Anm. A.S.). Auf der Klangebene geht das „Ei“ damit dem Huhn bzw. Hähnchen voraus und findet sich im letzten Satz – entgegen aller Regeln der Etymologie – noch einmal in der „Wüstenei“ wieder.
2. Das bei Queneau angelegte Vogelmotiv („Huhn“/„Jungvogel“) wird in der deutschen Fassung darüber hinaus auch insofern intensiviert, als die Übersetzer für die französische Redewendung „se faire moucher l’arrogance“ (bei Harig/Helmlé: „sich den Dünkel aus der Nase ziehen lassen“) ein das Vogelmotiv fortführendes deutsches Sprichwort einsetzen – wenn es vom Protagonisten dieser Exercice heißt, er ließe sich „wegen irgendeines Knopfes auf die Hühneraugen steigen“. Offenbar haben sich die (Klang-)Motive von „Ei“ und „Huhn“ in der Übersetzung von Heibert und Schmidt-Henkel soweit verselbständigt, dass sie das konventionelle Verständnis von Metaphorik unterlaufen: Denn wenn das Huhn noch insofern mit dem „Hühnerauge“ verknüpft ist, als eine gewisse visuelle Ähnlichkeit zwischen einer Hornhautschwiele und einem Vogelauge besteht, so hat das „Vogelei“ selbstverständlich keinerlei Bezug zur „Wüstenei“. Die poetische Assoziationskraft lässt die Wörter „Ei“ und „Wüstenei“ jedoch auf phonetisch-graphischer Ebene wie selbstverständlich zusammenrücken. Das Hühneraugen-Sprichwort generiert also eine Querverbindung zum Vogelmotiv, die in dieser Form nur im Rahmen des deutschen Wortschatzes möglich ist, während die französische Wendung „se faire moucher l’arrogance“ keinen auch noch so entfernten Bezug zur Welt der Vögel hat. Auch hier erweist sich das Übersetzen als ein ‚Über das Original hinaus-Schreiben‘ mit den im Original angelegten Techniken, ganz im Sinne von Queneaus Idee der „prolifération infinie“.
Die Stilübung Olfactif ist vielleicht das sprechendste Beispiel dafür, dass die sprachliche Virtuosität von Queneaus Exercices gerade nicht auf das jeweilige titelgebende Verfahren beschränkt bleibt, sondern sich darüber hinaus auf einer zweiten oder dritten Bedeutungsebene niederschlägt, die sich bei der Lektüre womöglich erst nach und nach erschließt. Im ersten Teil der Olfactif-Stilübung erzeugt die Aufzählung der im Bus präsenten Gerüche klanglich die Buchstabenfolge des ABC:
Olfactif
Dans cet S méridien il y avait en dehors de l’odeur habituelle, odeur d’abbés, de décédés, d’œufs, de geais, de haches, de ci-gîts, de cas, d’ailes, d’aime haine au pet de culs, d’airs détestés, de nus vers, de doubles vés cés, de hies que scient aides grecs, il y avait une certaine senteur de long cou juvénile, une certaine perspiration de galon tressé, une certaine âcreté de rogne, une certaine puanteur lâche et constipée tellement marquées que lorsque deux heures plus tard je passai devant la gare Saint-Lazare je les reconnus et les identifiai dans le parfum cosmétique, fashionable et tailoresque qui émanait d’un bouton mal placé.
(Queneau 2012: 104)
Die Vielschichtigkeit von Queneaus Exercice, die in der Simultaneität von olfaktorischer Autobus-Variation und homophonem Alphabet besteht, ist eng mit der französischen Sprache und ihrer Vielzahl gleichklingender Worte verbunden. Im Anmerkungsapparat zu ihrer Übersetzung haben Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel Queneaus Alphabet aufgeschlüsselt: „abbés (A, B), décédés (C, D), œuf (E, F), geais (G), haches (H), ci-gîts (I, J), cas (K), ailes (L), aime haine au pet de culs (M, N, O, P, Q), hies que scient aides grecs (X, Y, Z – das Z nur sehr verschlüsselt)“ (Heibert/Schmidt-Henkel 2016b: 182). Wie der Vergleich zwischen den beiden deutschen Olfactif-Fassungen zeigt, realisiert die Neuübersetzung von Heibert/Schmidt-Henkel erstmals dieses homophone ABC. Harig und Helmlé haben ihrerseits eine relativ wörtliche Umsetzung vorgelegt, in der das Klang-ABC nicht hörbar wird:
Geruchlich
In diesem mittägigen S gab es außer dem gewöhnlichen Geruch: Geruch nach Äbten, nach Gestorbenen, nach Eiern, nach Eichelhähern, nach Äxten, nach Verblichenen, nach Kot, nach Flügeln, nach Haßliebe mit Arschfürzen, nach abscheulichen Gasen, nach nackten Maden, nach doppelten WC’s, nach alten Jungfern, es gab den gewissen Duft eines langen, jugendlichen Halses, die gewisse unmerkliche Ausdünstung einer geflochtenen Kordel, die gewisse Herbe schlechter Laune, den gewissen flauen und verstopften Gestank, der so stark war, daß ich ihn, als ich zwei Stunden später vor der Gare Saint-Lazare vorbeikam, sofort wiedererkannte und ihn am kosmetischen, fashionablen und tailoresken Parfum, das von einem falschplatzierten Knopf ausging, identifizierte.
(Harig/Helmlé 1961/2007: 88)
Olfaktorisch
In diesem mittäglichen S wehte einen der übliche Geruch – mal Ah!, mal Bäh!, nach Zeh, nach Deo, nach Äffchen, ach geh! Ha! Ihh! Jottojott! Ka-ka!, nach Elli, Emmi und Enno, nach Pest, Kuh, Ähren, Essen, Tee, Uhu, Pfau, o weh, hicks, üpsel – an, dazu so ein Aroma von langem Junghals, so ein Hauch von geflochtener Borte, so ein beißender Stinkwutgestank, so ein feiger, verklemmter Mief, derart ausgeprägt, dass ich ihn, als ich zwei Stunden später an der Gare Saint-Lazare vorbeikam, wiedererkannte und sogar aus dem kosmetischen, fashionablen Schneiderduft, den ein falsch platzierter Knopf verströmte, noch herausroch.
(Heibert/Schmidt-Henkel 2016a: 69)
Das ‚Verschweigen’ des homophonen ABC in der Erstübersetzung sollte jedoch nicht vorschnell mit einem mangelnden Verständnis seitens der Übersetzer erklärt werden. Ein Blick in Ludwigs Harigs Artikel Raymond Queneau – übersetzt im Saarland. Die Stilübungen und ihre Schwierigkeiten vom 13. Mai 1961 zeigt, dass ihm die klanglich-semantische Komplexität der vorliegenden Stilübung offenbar nicht entgangen ist. Seine vorläufige „Leseart der alphabetischen Laute“ (Harig 1961: 85) heißt:
| AB | C | D | E | F | G |
| Abbé | Zeh | De(gen) | E(sel) | Äff(chen) | Ge(n) |
| HIJ | KLM | N | OPR | Q | S |
| Hj. | Kah lem | En(te) | Oper | Kuh | Ess(en) |
| T | U | V | W | X | Z |
| Tee | U(hu) | (P)fau | Weh | (W)ichs | Zett(el) |
Offen bleibt die Frage, zu welchem Zeitpunkt dieses ABC-Gerüst, dem lediglich das Y fehlt, entstanden ist, ob noch vor oder erst nach der Drucklegung des Übersetzungsmanuskripts. Das Erscheinen der ersten Rezensionen zu den Stilübungen Autobus S. Ende Juni 19613 legt die Annahme nahe, dass die Übersetzung selbst in den vorausgehenden Wochen publiziert sein worden muss, also in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu Harigs Beitrag in der Saarbrücker Zeitung. Insofern ist es nicht auszuschließen, dass Eugen Helmlé und Ludwig Harig erst auf das homophone Alphabet aufmerksam geworden sind, als der Druckprozess schon im Gange und eine weitere Fahnenkorrektur ausgeschlossen war. In diesem Fall wäre es denkbar, dass der Beitrag aus der Saarbrücker Zeitung möglichen Kritikern zuvorkommen sollte. Möglich ist aber auch, dass die beiden Übersetzer mit ihren bis dato erarbeiteten deutschsprachigen Lösungen unzufrieden gewesen sind und deshalb darauf verzichtet haben, das homophone Alphabet in die Buchfassung aufzunehmen. Denn was dem Klang-ABC im vorliegenden Stadium in der Tat noch fehlt, ist die Bindung der mit den einzelnen Buchstaben verknüpften Wörter an das Motto „mögliche Gerüche in einem Autobus“. Dazu fehlt mehreren der gewählten Wörter die klanglich-semantische Doppelfunktion: Während Begriffe wie „Zeh“, „Esel“ und „Äffchen“ oder auch „Essen“, „Tee“ und „Uhu“ beim Leser recht klare Geruchsassoziationen wecken, lassen sich andere Motive wie z.B. „Degen“ oder „Zettel“ entweder allenfalls vage geruchlich zuordnen (Degen – metallischer Geruch; Zettel – muffiger Geruch alter Papiere) oder auch gar nicht, wie im Fall des Worts „Gen“. Andere Begriffe wie z. B. „Oper“ lassen sich zwar unter Umständen mit bestimmten Gerüchen wie z. B. einem aufdringlichen Parfüm in Verbindung bringen, sind aber im Kontext eines mittäglichen Autobusses wenig plausibel.