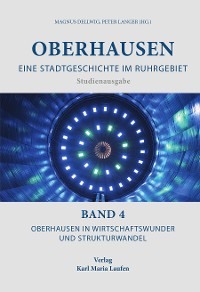Kitabı oku: «Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 4», sayfa 13
Wie hat sich denn die Politik in den Jahren vor 1992/1993, vor der Ansiedlung von CentrO verhalten?
Politik in Oberhausen war eigentlich dafür. Es gab ja ein paar Vorläufer. Das Grundstück stand seit einigen Jahren zur Verfügung. Und wir haben uns immer wieder bemüht, dort zu einer Neuansiedlung zu kommen. Diese Neuansiedlung musste aber für uns mit Arbeitsplätzen verbunden sein. Und es gab dann die Absicht eines japanischen Autoherstellers zu einem Auslieferungslager für Deutschland in Oberhausen. Aber da konnten wir gut drauf verzichten. Denn diese Fläche dazu zu benutzen, Autos abzustellen und da 50 Arbeitsplätze zu schaffen, das konnte es nicht sein. Die Grünen haben damals lange dafür gekämpft, da eine grüne Oase zu schaffen. Das konnte es aber auch nicht sein, denn wir brauchten neue Arbeitsplätze. Wir waren z. B. in ernsthaften Verhandlungen mit Heidelberger-Druck. Und wir hatten mit dem Arbeitsamt auch schon gesprochen: Wie kann man denn jetzt hier die Leute qualifizieren für die Tätigkeit bei Heidelberger-Druck? Dann kam die Wiedervereinigung 1990 und Heidelberger-Druck ist in die neuen Bundesländer gegangen. Da gab es ganz andere Fördermittel. Also war wieder nichts. Wir haben jedenfalls immer versucht, wenn wir in solchen Verhandlungen waren, nichts nach draußen dringen zu lassen, weil wir uns gesagt haben, wenn so etwas bekannt wird und es geht zwei, drei Mal daneben, dann kommen andere Investoren erst gar nicht, weil die sagen: Das haben schon drei Leute versucht: Warum soll ich da hin gehen? Deswegen sind in der Öffentlichkeit unsere Versuche, hier vor 1992 was Neues zu schaffen, eigentlich nie deutlich geworden. Aber wir hatten immer daran gearbeitet. Und als dann Healey kam mit seinem Konzept, ist das in der Politik eigentlich auf große Zustimmung gestoßen. Mit Ausnahme von den Grünen.
Haben Sie selber an den Erfolg geglaubt, so wie es sich heute darstellt?
Ich sag mal, an den Erfolg des CentrOs ja. Aber an das, was da drum herum geschehen ist, beispielsweise die Arena, so was konnte ich mir nicht vorstellen. Ich wusste zwar, das gibt eine Veranstaltungshalle. Selbst wenn man Baupläne sieht, man glaubt das noch nicht. Man muss erst die Dimensionen selbst gesehen haben. Vieles was dann dazu gekommen ist im Laufe der Zeit, wie Sealife und der Jachthafen, waren ja von Anfang an eigentlich geplant. Also an den Erfolg habe ich schon geglaubt, aber nicht, dass es ein solcher Erfolg wird. Alle Zahlen haben uns ja gesagt, die Menschen kommen aus einem Umkreis von 50 Kilometern und auch die Holländer kommen nach Oberhausen. Aber dass die Busse Stoßstange an Stoßstange kommen, das selbst im Urlaub in Wilhelmshaven mir gesagt wurde, ja wissen sie was, einmal war ich ja schon im CentrO, aber wir fahren da noch einmal hin, das ist einmalig. Daran habe ich nicht geglaubt.
Welchen Beitrag hat die Neue Mitte leisten können nachdem, wie wir so schön sagen, das montanindustrielle Herz der Stadt im geographischen Mittelpunkt der Stadt nicht mehr schlug und eine Neuausrichtung auf die Zukunft erforderlich war?
Wir wollen uns nichts vormachen. Das CentrO und der Gasometer sind für die Oberhausener neue Wahrzeichen der Stadt. Früher waren es die Hochöfen und Fördertürme. Aber das ließ sich ja nach außen nicht vermitteln. Diese Wahrzeichen sind inzwischen für die Oberhausener das CentrO und der Gasometer. Und das lässt sich nach außen vermitteln.
„Das Stadtteilprojekt Knappenviertel gibt Mut zu neuen Lebensperspektiven und ist Vorbild für ganz Oberhausen“
Interview mit Klaus Wehling (Teil 2)
1996 wurde das Knappenviertel in das Landesprogramm Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf aufgenommen. Die Umsetzung erfolgte im Rahmen eines integrierten Handlungsansatzes, in den eine Vielzahl stadtteilrelevanter Akteure einbezogen wurde. Welche Voraussetzungen waren für Sie als Vorsitzender des Projektbeirates entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung des Stadtteilprojektes?
Ganz zu Beginn nenne ich die breit angelegte Bürgerbeteiligung, die wesentlicher Bestandteil des integrierten Handlungskonzeptes war. Da waren nicht nur die Hauptakteure, wie z. B. Ladenbesitzer oder Vorsitzende von Vereinen und Verbänden Ansprechpartner, sondern auch die normale Bevölkerung. Und dann natürlich im Nachhinein muss ich sagen, gab es hinsichtlich der finanziellen Möglichkeiten ja nahezu paradiesische Verhältnisse im Vergleich zum Jahr 2011/2012. Und jetzt kann ich noch ergänzen, durch die beiden Grundvoraussetzungen für den Erfolg – Bürgerbeteiligung und finanzielle Mittel – hat sich die breite Resonanz ergeben, als man sah, es wird hier etwas umgesetzt. Und von daher wuchs die Lust zum Mitmachen ständig an.
Die Neugestaltung der Obdachlosensiedlung Stickersweg/Uhlandstraße mit der Modernisierung von erhaltenswerten Gebäuden und dem Abriss der restlichen Gebäude an der Uhlandstraße sowie der Vermarktung dieser Grundstücke war ein nachhaltiger Eingriff in die Struktur des Stadtteils. Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf den Stadtteil und die Sozialpolitik in Oberhausen?
Zunächst mal per Augenschein hat sich aus einem ehemaligen Schmuddelgebiet eine schicke Wohnsiedlung entwickelt. Das war für das Selbstwertgefühl der Menschen ganz, ganz wichtig. Man muss allerdings sagen, die im Knappen- und Brücktorviertel groß gewordenen Menschen sind weitestgehend im Viertel geblieben. Ähnlich wie dies auch zutrifft auf die Alstadener, die Liricher oder die Osterfelder, um nur wenige Beispiele für Oberhausener Stadtviertel mit festen Strukturen zu nennen. Viele Oberhausenerinnen und Oberhausener sind so stark in ihrem Viertel verwurzelt, dass sie aus ihrem Umfeld nicht weg ziehen. Gerade deshalb bemühen wir uns verstärkt am Angebote von Dienstleistungen, die es Senioren erleichtern, in ihren Wohnungen zu verbleiben, anstatt frühzeitig in Seniorenwohneinrichtungen zu ziehen.
Das Image des Uhlandviertels im engeren Sinne hat sich total gewandelt mit dem Abriss der ehemaligen Obdachlosenwohnungen. Den ehemaligen sozialen Brennpunkt Uhlandstraße und Strickersweg gibt es nicht mehr.
Hatte diese Maßnahme auch Auswirkungen auf die Sozialpolitik der Stadt?
Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als in den 1960er Jahren die Wohnungen umgebaut wurden zu größeren Einheiten. Damals wurde über einer Haustür ein Schild angebracht, das sinngemäß lautete: Hier baut die Stadt familiengerechte Wohnungen. Da hat sich also durchaus ein Wandel von der reinen Unterbringung ergeben hin zu Wohnungen, von der Wohnungsgröße und der Ausstattung her, die sich stetig dem normalen Wohnungsbau angeglichen haben.
Mit der Umwandlung des Bunkers Alte Heid in ein Bürgerzentrum von 1998 bis 2001 wurde eine Einrichtung geschaffen, die heute mehr ist als ein Ort der Begegnung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Knappenviertels. S. hat das Bunkermuseum heute seinen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt. Das Image und die Lebensqualität im Knappenviertel haben sich durch vielfältige Maßnahmen und Aktionen deutlich verbessert. Welche Erkenntnisse können Sie für ein integriertes Stadtentwicklungskonzept aus dem Stadtteilprojekt Knappenviertel gewinnen?
Ganz eindeutig, dass man Veränderungen nur mit den Bürgerinnen und Bürgern machen kann und nur so etwas erreichen kann. Die breite Bürgerbeteiligung ist wesentliche Voraussetzung für sinnvolle Umsetzungen. Und dann müssen natürlich auch entsprechende Ressourcen vorhanden sein, die sich nicht nur auf Finanzmittel beziehen, sondern auch auf Ideen, die nicht nur im Rathaus entstehen, sondern konkret vor Ort.
Das Bürgerzentrum im ehemaligen Bunker an der Alten Heid ist das Aushängeschild, das Highlight der Umgestaltung des Knappenviertels. Nach wie vor ein Vorzeigeprojekt für auswärtige Besucher. Jetzt war ja der Oberbürgermeister von Saporishja da, der hoch interessiert war, sich den Bunker anzusehen.
Ausgangspunkt für die Umgestaltung des Bunkers war der Schützenverein im Oberhausener Osten, der mit der Schließung der Gaststätte Töpp keine Möglichkeit mehr hatte, den Schießsport auszuüben. Die Schützen haben dem Beispiel anderer Städte folgend vorgeschlagen, den Bunker entsprechend umzubauen. Und das war der Anstoß für die diversen Nutzungen, die sich dann ergeben haben. Ein weiterer Höhepunkt ist die große Veranstaltungshalle, ist das Bistro, das sehr gute Essensangebote für die Bevölkerung anbietet, sind die auf dem Bunker befindlichen Räume des Jugend- und Sozialbereichs der Stadtverwaltung. Auch der Second-Hand-Shop „Stöber“ von Flickwerk erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Dann kommen noch die vielen Kurse hinzu, die hier stattfinden mit sehr unterschiedlichen Angeboten, die ja abgestimmt sind auf das, was die Bürger insbesondere auch im Knappenviertel nachfragen. Da kann man nur sagen, das Bürgerzentrum Alte Heid ist eine Einrichtung, die ihresgleichen sucht. Einmal wegen der Breite des Angebotes, aber auch wegen der architektonischen Umgestaltung, die soweit ich weiß beispiellos geblieben ist.
Noch eine Zwischenfrage. Wer in der Weihnachtszeit 2011 in die Tageszeitung schaute, musste mit einiger Verwunderung feststellen, zumindestens für diejenigen vielleicht, die nicht im Knappenviertel selber wohnen, dass für das Knappenviertel unwahrscheinlich geworben wurde. Ist das auf ein neues Selbstbewusstsein zurückzuführen oder ist es tatsächlich der Wunsch, nach außen hin präsenter zu werden?
Ich würde beides anführen. Also zunächst einmal ist sehr viel Aktivität angestoßen worden und wird aktuell weiter angestoßen von „K.In. O“, der Knappeninitiative Oberhausen, die ganz zu Beginn sehr deutlich betont hat, dass sie nicht nur ein Zusammenschluss der Gewerbetreibenden sein will, sondern die insbesondere die Jugendlichen im Knappenviertel im Visier hat. „K.In. O“ bemüht sich sehr, dass die ortsansässigen Unternehmen den Jugendlichen Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Das ist eine der für meine Begriffe sehr bemerkenswerten Aufgaben, die ansonsten von Interessengemeinschaften nicht übernommen werden. Und auch sonst tragen die in „K.In. O“ zusammen geschlossenen Unternehmen sehr viel zum gesellschaftlichen Leben, zum Zusammenhalt innerhalb des Knappenviertels bei, durch die jährlich stattfindenden Stadtteilfeste, durch Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 1. Mai, aber auch durch diverse Veranstaltungen im Bürgerbegegnungszentrum. Inzwischen ist die Zahl von 40 Mitgliedern bei „K.In. O“ weit überschritten worden und der Zulauf ist ungebremst. Das hat nicht nur mit besseren Verkaufschancen zu tun, sondern auch mit der Mitverantwortung für die Menschen im Knappenviertel.
Aus Ihren Schilderungen geht deutlich hervor, dass das Knappenviertel eine positive Entwicklung durchlaufen hat in den letzten 20 Jahren. Gab es trotz der im Verlaufe der in letzter Zeit deutlich schlechteren Förderbedingungen für ähnlich gelagerte Projekte positive Ausstrahlungen in andere Stadtviertel der Stadt Oberhausen? Sind möglicherweise Anregungen aufgegriffen worden, die sich auch für die Stadtteilentwicklung in anderen Teilen der Stadt positiv ausgewirkt haben?
Ganz zweifellos. Wir sind ja ausgezeichnet worden mit dem Projekt im Knappenviertel und haben einen bundesweiten Preis errungen. Ausstrahlung hatte dies auf den zweiten Stadtteil in Oberhausen mit besonderem Entwicklungsbedarf.
Der Stadtteil Lirich hat sehr davon profitiert. Die Erfahrungen, die wir im Knappenviertel gemacht haben, sowohl positive als auch negative, konnten intern genutzt werden. Und die Entwicklung in Lirich ist durchaus mit der Entwicklung im Knappenviertel vergleichbar. Ebenso ein ehemals, zumindest von außen betrachtet, nicht sehr beliebter Wohnstandort, der sich inzwischen beachtlich gemausert hat. Auch was die Initiative der Gewerbetreibenden, aber auch ansonsten der im Stadtteil tätigen Vereinsvorsitzenden anbelangt, findet man durchaus Parallelen sehr zum Wohl der Bevölkerung.
Über die von Ihnen benannten positiven Ausstrahlungen des Projektes Knappenviertel auf weitere Stadtteile hinaus: Hat das Projekt Impulse gegeben oder gar die praktische Arbeit beeinflusst zu einer gesamtstädtischen Planungsperspektive, wie sie in den letzten Jahren mit dem Begriff der integrierten Stadtentwicklungsplanung in der Fachdiskussion immer wichtiger geworden ist?
Das Projekt Knappenviertel ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie Erneuerungsprozesse im Stadtteil oder auch gesamtstädtisch organisiert werden können. Im Knappenviertel ist es gelungen, alle Bereiche des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens am Veränderungsprozess zu beteiligen. Hier wurde keine Politik „von Oben“ gemacht, sondern sehr konkret mit den Betroffenen vor Ort die Situation analysiert und die Interessen Aller beim Veränderungsprozess berücksichtigt. Vereine, Gewerbetreibende, Handel, soziale Organisationen – alle haben mit dem Willen und dem Ziel, die Situation für alle zu verbessern, mitgewirkt. Diese Vorgehensweise hat in der Folge die gesamtstädtische Planungsperspektive positiv beeinflusst. Der Prozess im Knappenviertel hat gezeigt, dass und wie eine integrierte Stadtentwicklungspolitik funktionieren kann. Sie verbessert die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Bürgerinnen und Bürger.
Oberhausen steht im Jahr 2012 vor der großen Herausforderun die Finanzen der Stadt für die kommenden Jahre neu zu ordnen. Sie erläuterten die Vorzüge einer integrierten Arbeitsweise in Planungsaufgaben als ein Querschnittsthema. Hat dieses Vorgehen auch Bedeutung für die Erreichung der Sparziele Oberhausens und für die weitere Steigerung von Effizienz im Verwaltungshandeln?
Eine integrierte Arbeitsweise unter Einbeziehung vieler gesellschaftlicher Akteure ist auch bei der Erreichung der Sparziele Oberhausens von großer Bedeutung. Das hat schon die Sparrunde 2008 gezeigt. 2008 haben wir alle wichtigen gesellschaftlichen Akteure und die Bürgerinnen und Bürger in einem breit angelegten Prozess beteiligt. Dies werden wir auch im Jahr 2012 wiederholen.
Fortsetzung auf S. 139
6. Die Jahre 2000 bis 2011: Oberhausens Wirtschaft im frühen 21. Jahrhundert 34
Konnten viele Oberhausener im Jahr 2000 noch den Eindruck gewinnen, die Bäume ihrer Stadt wüchsen sprichwörtlich in den Himmel, so ist diese Stimmung zehn Jahre später einer abgeklärten Zuversicht gewichen. Doch zugleich mögen viele WAZ-Chefredakteur Peter Szymaniak zustimmen, der am 10. September 2011 kommentierte, früher sei wohl mehr Lametta gewesen; heute indes sei eben mehr Tanne.35 Daran kann man ersehen: Oberhausen ging seinen Weg des Wandels konsequent weiter und erzielte auch manche Erfolge. Oberhausen ist 2012 ohne Frage im Prozess des Wandels weiter voran gekommen als 2000. Doch der Unterschied zu den 1990er Jahren in Bezug auf das Lebensgefühl besteht ohne Zweifel darin, dass solch spektakuläre und große Projekte, wie sie die Startphase der Neuen Mitte Oberhausen prägten, nicht noch einmal umgesetzt werden konnten.
Hinzu trat ein Schock, der Oberhausen 2002 unvermutet und hart traf, als die Deutsche Babcock AG, der letzte Konzern der Stadt mit zuletzt 22.000 Mitarbeitern, davon 3.000 in Oberhausen, im Juli Insolvenz anmeldete. Nach äußerst riskanten und letztlich unverantwortlichen Finanzierungsgeschäften innerhalb des Unternehmens zwischen der Mutter und der Kieler Werft HDW hatte der Vorstandsvorsitzende Klaus Lederer einen Schwenk der Unternehmensstrategie vollzogen und die 50-prozentige Babcock-Beteiligung an der HDW im März 2002 veräußert. Dadurch geriet jedoch die labile Finanzierungsarchitektur zwischen der ertragsstarken Tochter und ihrer schwächeren Mutter in eine schließlich verhängnisvolle Schieflage. Dem Einsatz von Insolvenzverwalter Helmut Schmitz, Übergangsvorstand Horst Piepenburg, Betriebsratsvorsitzendem Heinz Westfeld und Politikern von Michael Groschek sowie Burkhard Drescher vor Ort über NRW-Ministerpräsident Wolfgang Clement bis zu Bundeskanzler Gerhard Schröder war zu verdanken, dass gut die Hälfte der Oberhausener Arbeitsplätze erhalten wurde. Die meisten davon sind fortan bei den Anlagenbauern und Full-Service-Kraftwerks-Wartungsunternehmen Babcock-Borsig und Babcock Hitachi tätig.36 2007 wechselte zwar ein Teil der Babcock-Hitachi AG mit etwa 180 Mitarbeitern nach Duisburg, doch 2011 fiel die Entscheidung für die regionale Konzentration der Energie-Aktivitäten der Bilfinger & Berger Power Service, zuvor Babcock Borsig, in der neuen Europa-Zentrale mit fortan 500 Mitarbeitern am Standort Neue Mitte Oberhausen.
Oberhausen startete mit großen Zielen in das neue Jahrtausend. Stellvertretend und herausragend stehen dafür das ambitionierte städtische Wirtschafts- und Stadtentwicklungsprojekt des O.VISION Zukunftsparks, und weiter das kleinere, ebenfalls städtisch geprägte Projekt der Marina Oberhausen. Im Spannungsbogen beider Entwicklungen wird überaus deutlich, an welche Grenzen der Oberhausener Strukturwandel stieß, welche davon mit lokalen Mitteln zu überwinden waren, gegen welch andere jedoch kein Kraut gewachsen war.
Im Dezember 1997 wurde im Elektrostahlwerk der Thyssen Stahl AG an der Osterfelder Straße der letzte Stahl geschmolzen. Dadurch eröffnete sich der Stadt die Möglichkeit zur Überplanung einer 63 Hektar großen Industriebrache in hervorragender städtebaulicher Lage, unmittelbar neben dem CentrO im Osten der Neuen Mitte Oberhausen. Rat und Verwaltungsführung der Stadt ergriffen die Initiative zur Projektentwicklung. Aus Gründen des Planungsrechtes wie aus regionalpolitischer Überzeugung strebte man keine Ergänzung der Neuen Mitte durch weiteren Einzelhandel in größerem Umfang an, sondern Nutzungen in der Freizeitwirtschaft und in Zukunftstechnologien. Anders als im Fall der CentrO-Ansiedlung, so herrschte Einvernehmen, würde man für ein solches Ziel keinen zentralen privaten Partner gewinnen können. Also wurde die Stadt in neuer Dimension als Gestalter und Motor des Wandels tätig: Die PBO als Tochter von Stadt, EVO und Stadtsparkasse erwarben für zehn Millionen DM 1999 das Gelände. Die PBO führte den Abriss zahlreicher Werkshallen, sprich die Baureifmachung, und die Erschließung mit Hilfe einer Landesförderung von 1999 bis 2002 durch. Stadt und PBO bildeten zeitgleich ein Projektteam, entwickelten das Nutzungskonzept für den O.VISION Zukunftspark und beantragten dafür eine Infrastrukturförderung bei der EU und dem Land NRW. Was war der O.VISION Zukunftspark im Modell?
Bis zum Jahr 2000 wurde in enger Partnerschaft mit dem Oberhausener Fraunhofer Institut Umsicht, getragen von Institutsleiter Prof. Weinspach und Oberbürgermeister Drescher, die Idee eines Technologieparks als Schaufenster der Fraunhofer Gesellschaft verfolgt. Das wiesen jedoch das NRW-Wirtschaftsministerium und seine Gutachter zur Beurteilung der angestrebten „regionalökonomischen“ Effekte als nicht förderbar, weil zu unspeziell zurück. Das Land verfolgte ein striktes Konzept der „Clusterförderung“, so dass ein zukunftsfähiger Branchenzusammenhang mit guten Chancen am Ort gefunden werden musste. Diesen arbeiteten Stadt und PBO mit dem O.VISION Zukunftspark als Marktplatz für die Güter und Dienstleistungen der Gesundheitswirtschaft heraus. O.VISION sollte eine zentrale Adresse für das Ruhrgebiet und ganz NRW werden. Die Lage in der Neuen Mitte mit 23 Millionen Besuchen jährlich, ausgeführt von rund sechs Millionen verschiedenen Menschen, versprach die Aussicht auf eine erfolgreiche Ergänzung des CentrO durch einen dynamischen Zukunftsmarkt. Den Kern des O.VISION Zukunftsparks bildete der „Gläserne Mensch“, ein Erlebnismuseum zu Menschenwissenschaften und Medizin, das Ausstellungs- und Kongresszentrum im vormaligen Elektrostahlwerk einschließlich der für das Gelände zentralen Straßenbahnhaltestelle, und dazwischen auf über fünfhundert Meter Länge zwei attraktive Promenaden am Wasser für privatwirtschaftliche Ansiedlungen. Warum scheiterte aber der O.VISION Zukunftspark?
Geschichte der Babcock Borsig Steinmüller GmbH (ehem. Babcock Borsig) ab 1945
▶ 1898: Die Deutsche-Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke AG wird gegründet und eine Fabrik in Oberhausen auf dem Gelände der vormaligen Dampfkesselfabrik Schäfer errichtet.
▶ 1948: Der Sitz der Gesellschaft mit mittlerweile über 3.000 Mitarbeitern wird von Berlin nach Oberhausen übertragen.
▶ 1950er Jahre: Der Umsatz steigt von 80 auf 236 Millionen DM, die Dividende von 7 auf 14 Prozent.
▶ 1960er und 1970er Jahre: Das Geschäftsfelder erweitert sich kontinuierlich durch Neuakquisitionen z. B. im Nuklearbereich.
▶ 1973 : 75-jähriges Firmenjubiläum. Die Gruppe umfasst die Bereiche Kesselbau, verfahrenstechnische Maschinen und Brenner, Industrie-Anlagenbau, Umwelttechnik, Trocknungstechnik, Lüftungs-und Klimatechnik, allgemeinen Maschinenbau, Rohrleitungsbau, Stahl- und Behälterbau, Hoch-und Industriebau sowie weitere Arten von Dienstleistungen und Handel.
▶ 1987: Gründung von fünf operativen Einheiten des Konzerns unter Leitung der Muttergesellschaft Deutsche Babcock AG.
▶ 1997: Vereinfachung und Neuausrichtung der Konzernstruktur. Die Konzerngesellschaften werden gemäß ihrer Befugnisse und Produktlinien in sieben operative Geschäftsfelder neu geordnet.

Abb. 24: Werksanlagen der Deutsche Babcock und Wilcox-Dampfkesselwerke AG, um 1905

Abb. 25: Ansicht (Animation) der neuen Unterneh- menszentrale
▶ 1998: Aufteilung des Konzerns in sieben Geschäftsfelder: Antriebstechnik, Kraftwerkstechnik, Maschinenbau, Gebäudetechnik, Energie- und Prozeßtechnik, Industrieservice; Kauf der L & C Steinmüller GmbH in Gummersbach.
▶ 1999: Umfirmierung in Babcock Borsig Aktiengesellschaft (2001 in AG).
▶ 2002: Insolvenz von 60 der 300 Unternehmen der Babcock-Borsig AG. Fortbestand der Geschäftsbereiche mit Bezug zur Kraftwerkstechnik: Kraftwerksneubau/Energietechnik (Übernahme durch japanischen Hitachi Konzern im Februar 2003), Umwelttechnik (Übernahme durch italienische Fisia Italimpianti).
▶ 2003: Die Deutsche Beteiligungs AG kauft die Babcock Borsig Service Gruppe aus der Insolvenzmasse der Babcock Borsig AG. Hierzu gehörten folgende Hauptgesellschaften: Babcock Borsig Service GmbH (Kraftwerksbau seit 1898), Babcock Noell Nuclear GmbH (Sonderkranbau seit 1824), Steinmüller-Instandsetzung Kraftwerke Gesellschaft für Energie- und Umwelttechnik mbH (Kraftwerksbau seit 1855), Steinmüller Engineering Service (Pty) Ltd. in Südafrika (Kraftwerksservice und -bau in Südafrika seit 1896).
▶ 2006: Umfirmierung der Deutschen Babcock GmbH (vorh. Holdinggesellschaft der Gruppe) in die Bilfinger Berger Power Services GmbH; Erwerb der Essener Hochdruck-Rohrleitung GmbH (Kraftwerksbau seit 1885) und Umbenennung in die BHR Hochdruck-Rohrleitungsbau GmbH.
▶ 2009: Erwerb von 80,5 Prozent der Anteile der Duro Dakovic Montaza d.d. mit Firmensitz in Slavonski Brod, Kroatien und einer Außenstelle in Oberhausen (Maschinenbau seit 1921). Mittlerweile sind alle Anteile an die Bilfinger Berger Power Services übergegangen.

Abb. 26: Stand der Bauarbeiten im Juni 2012
▶ 2010: Übernahme der MCE Berlin, MCE Maschinen- und Apparatebau GmbH & Co. KG und MCE Aschersleben GmbH nach Zukauf der MCE AG durch die Bilfinger Berger AG; Übernahme der Rotring Engineering AG.
▶ 2011: Babcock Borsig Service GmbH fusioniert mit der Schwestergesellschaft Steinmüller-Instandsetzung Kraftwerke zur Babcock Borsig Steinmüller GmbH mit Hauptsitz in Oberhausen; Übernahme der AE&E CZ und Umfirmierung zu Babcock Borsig Steinmüller CZ s.r.o.; Übernahme der Rosink Apparate- und Anlagenbau GmbH.
▶ 2012: Unter dem Dach der Power Services operieren zahlreiche Unternehmen im In- und Ausland. Das Kerngeschäft des Teilkonzerns ist die Kraftwerkstechnik in den Bereichen Dampferzeuger, Energie- & Umwelttechnik, Rohrleitungstechnik sowie Maschinen- & Apparatebau. Ein dichtes Niederlassungsnetz verknüpft die Aktivitäten in den wichtigsten Märkten der Gruppe: Deutschland, Europa sowie der Nahe Osten und Südafrika. Die Bilfinger Berger Power Services Gruppe beschäftigt über 7.400 Mitarbeiter und hatte im Geschäftsjahr 2011 eine Leistung von 1.157 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von acht Prozent. Im Jahre 2013 zieht die Bilfinger Berger Power Services in den neuen Hauptsitz am CentrO in die Europa Allee 1, wo 2012 ein entsprechender Neubau erstellt wird.

Abb. 27: Fraunhofer-Institut UMSICHT
2002 war das Konzept ausgebildet, bis 2004 wurde es stetig ergänzt und verfeinert. In enger Kommunikation mit dem Land NRW bemühten sich die Oberhausener Projektentwickler um Zustimmung zur Förderbarkeit. Das angestrebte Fördervolumen von anfangs 168 Millionen Euro, über 116 Millionen bis schließlich noch 108 Millionen Euro in 2004 erforderte einen „Großprojektantrag“ bei der EU-Kommission. Das gilt für alle Maßnahmen mit einem Finanzierungsvolumen von mehr als 50 Millionen Euro, in die Mittel aus der europäischen Strukturförderung fließen. Um mit einer solchen Antragstellung Erfolg zu erzielen, ist jedoch der Nachweis einer positiven Wirkung auf die Wirtschaft der Region nötig, und das in mehrfacher Höhe der verwandten Fördersumme. Nachgewiesen werden muss jene Wirkung über Gutachten volkswirtschaftlicher Experten. Diese aber und das NRW-Wirtschaftsministerium meldeten Zweifel an. O.VISION wurde zum Verhängnis, dass es damals europaweit kein vergleichbares Projekt eines Marktplatzes für Gesundheit gab. Statt belastbarer Vergleichsdaten lagen nur regionalökonomische Lehrmeinungen vor. Doch die Projektentwicklung wurde hartnäckig und zielstrebig betrieben, so dass die Landesregierung in 2004 schließlich die Antragstellung in Brüssel zusagte. Nach mehrmonatiger intensiver Arbeit war der Großprojektantrag Ende 2004 gestellt. In 2005 prüfte die EU-Kommission. Im Mai 2005 allerdings wechselte die NRW-Landesregierung hin zu einer Koalition aus CDU und FDP unter Leitung von Ministerpräsident Jürgen Rüttgers. Von nun an erreichten die vom Land vorgetragenen Bedenken gegenüber O.VISION eine neue Qualität: Insbesondere die schlechte Haushaltslage der Stadt Oberhausen lasse keinen zehn- oder zwanzigprozentigen Eigenanteil zu. Ferner wurden grundsätzliche Zweifel an der Zukunftsfähigkeit eines Marktplatzes für Gesundheit formuliert. Oberhausen reagierte konsequent: In nur dreimonatiger Arbeit erfolgte eine radikale Senkung des Fördervolumens von 108 auf nur noch 49 Millionen Euro. Auf ein multifunktionales Ausstellungs- und Tagungszentrum im Kerngebäude des ehemaligen Elektrostahlwerkes sollte vollständig verzichtet werden. Es blieb die Idee vom Gläsernen Menschen als dem Anziehungspunkt für Menschen und für Firmen aus den facettenreichen Branchen der Gesundheitswirtschaft. Was passierte dann?
Die Sektion für Regionalpolitik der EU-Kommission zeigte sich beeindruckt von der durchgreifenden Verkleinerung und dem damit abgesenkten Fördermittelbedarf. Das NRW-Wirtschaftsministerium zeigte keine Reaktion, da Ministerin Christa Thoben sich noch nicht positioniert hatte. Das Innenministerium, wichtig für die Genehmigung der Kommunalaufsicht zum Eigenanteil, begrüßte auf Arbeitsebene dessen Halbierung und deutete Zustimmung an. In dieser Konstellation wurde im Dezember 2005 eine Entscheidungsvorlage für das Landeskabinett vorbereitet. Um den Jahreswechsel meldeten Gerüchte aus Düsseldorf die Ablehnung von Finanzminister Helmut Linsen. Noch am 9. Januar 2006, einen Tag vor der Kabinettssitzung, reisten Oberbürgermeister Wehling und Projektleiter Dellwig zum Sechs-Augen-Gespräch zu Herrn Linsen, um ihn zu überzeugen. Doch die Ablehnungsfront stand. Am 10. Januar lehnte die Landesregierung eine Förderung von O.VISION per Kabinettsbeschluss mit dem Argument ab, dem Projekt fehle die Überzeugungskraft für Brüssel. (Ironie der Geschichte: Am gleichen Tag sendet die EU ein Telefax, mit dem sie die Förderbarkeit des verkleinerten Projektes bejaht.) Nicht wenige in Oberhausen vermuteten, dass auch parteipolitische Interessen-Konstellationen die Haltung des Landes bei der Entscheidung geprägt hatten. Am 10. Januar 2006 herrschte in Oberhausen nicht nur der große Katzenjammer; es mussten zugleich recht schnell Entscheidungen über die Zukunft des Geländes getroffen werden, denn mit dem Wegfall der Förderperspektive drohte der PBO sehr schnell das wirtschaftliche Aus!
Die PBO hatte von 1998 bis 2005, über acht Jahre nicht förderfähige Teile der Baureifmachung und Erschließung sowie die Projektentwicklung finanziert, zudem den Grundstückspreis von gut fünf Millionen Euro entrichtet. S. entstanden Verbindlichkeiten von über 25 Millionen Euro, denen sehr wohl ein Gegenwert in Gestalt des wertvollen Grundstücks gegenüberstand, solange das Ziel O.VISION verfolgt wurde. Mit dem Ende des Projektes drohte jedoch der Absturz des Grundstückswertes der 630.000 Quadratmeter großen Fläche von etwa 250 bis 300 Euro pro Quadratmeter auf noch 70 bis 80 Euro. Das bedeutete Insolvenzgefahr wegen bilanzieller Überschuldung. Den Verbindlichkeiten der PBO standen plötzlich keine vergleichbar hohen Sachwerte mehr gegenüber. Bei Insolvenz hätten die Gesellschafter für die Schulden, die vielfältig von ihnen verbürgt waren, gehaftet. Nur aus dieser Notlage heraus ist bis heute verständlich, sogar alternativlos, sehr schnell einen Käufer für das Gelände finden zu müssen. Schon im Februar bestanden erste Kontakte zu EAI, Euro Auctions Immobilen. Die PBO gab am 20. Februar 2006 ein notarielles Kaufangebot ab, für das sich auch der Rat der Stadt am gleichen Tag ausgesprochen hatte. Im Mai tätigte EAI, international erfolgreicher Händler und Auktionator von Baumaschinen aus Nordirland, den Kauf. Der Preis, in mehreren Raten zu entrichten, betrug 37,1 Millionen Euro und deckte sämtliche Verbindlichkeiten der PBO. Dennoch waren die Verhandlungen hart und intensiv. Stadt und PBO strebten eine enge Projektentwicklung mit EAI an, um auch unter veränderten Bedingungen eine hochwertige Nutzung auf einer Fläche zu erreichen, die zu Recht als verbliebenes Filetstück in der Neuen Mitte Oberhausen für den weiteren Strukturwandel galt. Es gelang, diese Gemeinsamkeit, die Beschränkung der Nutzungen auf zwei bis drei Themen, darunter die Fortführung der Projektentwicklungen in der Gesundheitswirtschaft, in der Präambel des Kaufvertrages zu verankern. Weitere Nutzungen konnten die Bereiche Mobilität oder Wohnungseinrichtungen bilden. Musste man voraussehen, dass EAI den Ansprüchen an eine hochwertige Projektentwicklung nicht nachkommen würde?