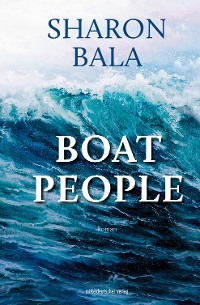Kitabı oku: «Boat People», sayfa 2
FROH, HIER ZU SEIN
Die Einwanderungsbeamten verteilten Bananen und Wasser und sammelten Ausweispapiere ein. Mahindan hatte alles in seinem Koffer, in einer versiegelten Plastiktüte – Geburtsurkunden, Personalausweise, Sellians Impfbescheinigung. Er stand im Menschengewirr, hielt Sellian an der Hand und wartete, bis man ihn aufrief. Plötzlich gab es ein wildes Gedränge, Ranga humpelte mit Höchstgeschwindigkeit heran, winkte ihm zu, als wären sie alte Freunde. Als einer der Aufsichtsbeamten seine Papiere anforderte, blickte Ranga hilfesuchend zu Mahindan hinüber, zog dann aber einen zerfledderten Ausweis aus seiner Tasche. Mahindan wandte sich irritiert ab.
Als er an der Reihe war, übergab Mahindan stolz seine Papiere, wohl wissend, wie sorgfältig er sich auf diesen Moment vorbereitet hatte. Dieses eine hatte er jedenfalls richtig gemacht. Sie nahmen ihm auch den Koffer ab. Als aber Sellian anfing zu weinen, erlaubte ihm der Beamte mit den blauen Augen, die kleine Ganescha-Figur herauszunehmen, und er klopfte Sellian mit der Hand im lila Handschuh freundlich auf die Schulter. Mahindan starrte traurig auf seinen zerbeulten alten Hartschalenkoffer mit den stabilen Schnappverschlüssen aus Messing und den ärmlichen Schätzen darin – ein Hochzeitsalbum, Chithras Sterbeurkunde, seine Haus- und Garagenschlüssel. Das war alles, was von seinem Hab und Gut übrig geblieben war. Aber er sagte sich, dass er etwas besaß, das viel kostbarer war. Sicherheit. Hier. Hier konnte man atmen.
Männer und Frauen wurden getrennt und angewiesen, sich in geordneten Reihen aufzustellen. Den Erwachsenen wurden Handschellen und Fußfesseln angelegt. An der Sorgfalt, mit welcher der Sicherheitsbeamte die beiden Enden der Schellen und Fesseln zusammenfügte, um ja nicht in die Haut zu kneifen, erkannte Mahindan, dass der Mann dies ungern tat.
Nur auf kurze Zeit, versicherte Mahindan seinem Jungen, zu unserer eigenen Sicherheit.
Es gab nicht genügend Tamil-Dolmetscher, und die Schutzmasken, die die Kanadier trugen, machten es schwer, ihren Gesichtsausdruck zu lesen. Mahindan konzentrierte sich auf die Augen und war überrascht von all den Farben, den Schattierungen von Blau, den grünen Flecken, den unterschiedlich tiefen Brauntönen. Die einzigen weißen Menschen, die er bisher gesehen hatte, waren Arbeitskräfte der Vereinten Nationen, und an die wollte er jetzt nicht denken.
Mahindan hatte sich Kanada immer als ein Land der Weißen vorgestellt, aber jetzt bekam er auch dunkle Augen zu sehen, Chinesen und Japaner und Schwarze und andere, die vielleicht aus Indien oder Bangladesch stammten. Es war ein Ort für alle.
Ranga machte sich an ihn heran. Endlich sind wir in Sicherheit, sagte er und kratzte gedankenlos an einer langen Narbe, die ihm quer über eine Wange lief.
Mahindan sah ihn finster an und wich ihm aus. Jedes Mal, wenn er und Sellian sich auf dem Schiff umdrehten, stand er da mit seinem gelähmten Bein. Direkt hinter ihnen, wenn sie bei der Essensausgabe standen und ihre Ration holten; direkt neben ihnen, wenn er zur Nacht seine Schlafmatte ausrollte.
Ein Polizist bellte irgendetwas in sein Funkgerät. Ein Rot-Kreuz-Helfer redete nachdrücklich mit den Händen. Mahindan hörte unvertraute Laute, harte, gutturale Konsonanten, die flach, einer nach dem andern, aufklatschten. Irgendwann würde das auch seine Sprache sein. Englisch. Eine neue Sprache für ein neues Zuhause.
Sein Großvater hatte Englisch gesprochen. Er war zum Studium nach London gegangen und hatte als Beamter in Colombo gearbeitet, bis Singhalesisch zur alleinigen Amtssprache erklärt wurde und damit seine Beamtenlaufbahn endete. Es war der alte Koffer seines Großvaters, den sie ihm jetzt weggenommen hatten.
Beamte und Freiwillige in Gummistiefeln und Uniformen verständigten sich laut rufend mit angegriffenen Stimmen und überanstrengten Gesten. Möwen kreisten kreischend über ihren Köpfen. Dieser Wirrwarr erinnerte Mahindan an ihre Gefangennahme in Sri Lanka. Das war am Ende des Krieges, als die sri-lankische Armee die Tamilen zusammengetrieben hatte. Es gab allerdings einen Unterschied: Hier hatten sie nichts zu befürchten, und selbst Sellian sah sich die fremde Landschaft und die Reihen von Bussen eher neugierig als verängstigt an.
Mahindan glaubte, dass sie bald einsteigen würden. Er stand bei den Männern und versuchte vergeblich, von Ranga wegzukommen. Die Schlangen wurden immer länger. Mahindan nickte einer Familie zu, die er aus dem Gefangenenlager kannte. Diese Leute aber bemerkten ihn nicht, oder sie vermieden den Augenkontakt absichtlich. Als sie in Sri Lanka an Bord gingen, hatte es ihn überrascht, so wenige seiner Kunden auf dem Schiff anzutreffen. All die endlosen Tage auf dem Meer, und sie hatten kein einziges anderes Schiff gesehen. Vielleicht war es das Beste für ihn, dass sie nicht hier waren; es war gut, sich von allem zu lösen. Trotzdem fragte er sich: Sind sie an Land zurückgelassen worden? Ist ihr Schiff gekentert? Sind sie im Meer ertrunken? Er merkte, wie seine Zähne anfingen zu klappern. Um sich wieder zu fangen, fokussierte er seine Gedanken auf Sellian. Wir sind in Sicherheit.
Seit einigen Stunden schon waren sie an Land, aber immer noch schwankte in seinen Beinen das Meer. Bei dem Gedanken an die ersten schlimmen Tage auf dem Schiff, an die sturmgepeitschten Wellen, an die penetrante Übelkeit tagein, tagaus, schwor er sich: Nie wieder.
Er hätte sich gern hingehockt, um die schmerzenden Fußsohlen zu entlasten, aber die Fesseln machten es unmöglich. Alle schwiegen, selbst die Kinder schafften es, dank Essen und Trinken, sich still zu verhalten. Hoffnung lag in der Luft.
Sellian reichte ihm ein Saftpäckchen. Möchtest du, Appa?
Nein, Baba, sagte Mahindan. Trink du es aus.
Lila Saft schoss durch den Strohhalm. Sellian sog in kurzen, hastigen Zügen, seine Augen schossen nach links und rechts. Mahindan betrachtete ihn liebevoll und erleichtert. Er schlurfte seitwärts nach rechts, legte seine gefesselten Hände auf die Schulter seines Sohnes, beugte sich zu ihm und küsste ihn auf den Kopf. Sellian schmiegte sich an den Vater. Der konnte vor Erregung und Freude kaum die Tränen zurückhalten. Sie hatten alle und alles verloren, aber Sellian lebte, er war unverletzt, und jetzt waren sie hier. Sellian war hier.
Am ersten Bus wurden die Türen geöffnet. Ein Ordnungsbeamter winkte die Frauen heran, und sie tappten mühsam mit gefesselten Füßen und Händen nach vorn. Die Kinder hielten sich an den Blusen und Hosen ihrer Mütter fest. Die Männer sahen schneidig aus, richteten in Bereitschaft ihre Reihe präzise aus, konnten den nächsten Schritt in die Freiheit kaum erwarten.
Der Aufseher überblickte die Menschenmasse, und als er Sellian sah, winkte er ihm.
Appa, was sagt der?
Ich weiß nicht, Baba.
Der Aufseher gab beiden ein Zeichen: halt für Mahindan, komm her für Sellian. Mahindan konnte den Gesichtsausdruck des Mannes nicht deuten. Immer wieder sagte er dasselbe kurze Wort, dann kam er ungeduldig auf sie zu und schnappte Sellian am Oberarm.
Appa!
Nein! Das ist mein Sohn! Die Kette zwischen seinen Füßen rasselte, Mahindan verlor das Gleichgewicht und fiel nach vorn. Die Männer vor und hinter ihm brüllten auf, und Ranga versuchte, ihn mit gefesselten Händen aufzufangen. Als Mahindan wieder auf den Beinen war, sah er, wie der Aufseher Sellian über die Schulter geworfen hatte und wegschleppte. Einige Frauen, die noch nicht im Bus waren, wandten sich um und schrien ihn auf Tamil an, er solle den Jungen loslassen. Sellian wehrte sich aus Leibeskräften und trommelte mit den Fäusten auf den Rücken des Mannes. Das Saftpäckchen fiel zu Boden und die Flüssigkeit bildete eine lilafarbene Lache auf dem Asphalt.
Eine laute Stimme durchschnitt den Aufruhr. Mahindan sah, wie die Krankenschwester, die seinen Blutdruck gemessen hatte, auf den Entführer zueilte. Sie sprach Englisch mit der Stimme einer Tamil-Mutter, die rügt und keinen Widerspruch duldet. Ihr Kinn schoss nach vorn, der Zeigefinger stieß zu. Der Mann fuhr mit der flachen Hand über den Hinterkopf und setzte Sellian schließlich wieder ab.
Sellian rannte zu seinem Vater zurück, und Mahindan hockte sich im Klammergriff seiner Fesseln mühsam zu ihm hinunter. Heftig keuchend und mit aufgerissenen, verweinten Augen klammerte Sellian sich mit beiden Händen an seinen Arm, presste das Gesicht an den Vater. Mahindan spürte Sellians festen Griff, wie leicht er aufgebrochen werden konnte.
Wo werden wir hingebracht?, fragte er die Krankenschwester auf Tamil.
Er wusste, dass ein großes, weites Land vor ihnen lag, aber wenn er versuchte sich vorzustellen, wie das aussehen mochte, kamen ihm nur vage Erinnerungen an Geschichten, die der Großvater über England erzählt hatte. Schafe und hohe Gebäude, Polizisten, die anstelle von Gewehren Schlagstöcke trugen.
Die Krankenschwester trug keine Schutzmaske. Auf Mahindans Frage wichen ihre Augen seitlich aus und die Mundwinkel gingen nach unten. Aber als sie antwortete, sprach sie laut, so dass alle Männer in der Schlange es hören konnten: Normalerweise gibt es in der Nähe ein paar Unterkunftsräume. Aber wenn so viele auf einmal kommen … gibt es nur einen Ort mit genügend Betten.
Mahindan fühlte sich zum Narren gehalten. Freien Menschen legt man keine Handschellen und Fußfesseln an.
Die Schwester wandte sich mit weicherer Stimme wieder an Mahindan. Wo die Frauen hinkommen, gibt es Einrichtungen für Kinder.
Chithra war bei der Geburt ihres Kindes gestorben. Sellian kannte nur Mahindan, der von Anfang an Vater und Mutter für ihn gewesen war. Kein Tag war vergangen, an dem Mahindan nicht für seinen Sohn gesorgt hatte. Bei dem Gedanken, ihn weggehen zu lassen, ihn allein in einen Bus einsteigen und zu einem unbekannten Ort fahren zu lassen, drehte sich ihm das Herz um.
Sellian fing an zu weinen. Appa! Lass mich nicht allein! Lass mich nicht allein!
Das schnürte Mahindan die Kehle zu. Hatte er eine Wahl? Er musste stark sein, um seines Sohnes willen.
Alles ist gut, Baba, sagte er. Willst du nicht mit den andern Kindern spielen? Und sieh mal, alle diese netten Tanten hier werden sich um dich kümmern. Es ist nur auf kurze Zeit.
Die Schwester nahm Sellian bei der Hand. Siehst du den kleinen Jungen dort? Kennst du ihn?
Sellian schluckte und nickte und wischte sich mit dem Handrücken die verschmierte Nase ab. Mahindan sank das Herz, als er sah, wer das war – Kumurans Sohn. Er sagte zu Sellian: Du kennst doch den Jungen, nicht?
Ich werde seine Mutter bitten, nach dir zu schauen, sagte die Schwester. Es tut mir leid, sagte sie zu Mahindan, als sie sah, wie Sellian die Arme um den Hals seines Vaters schlang. Das kommt nicht oft vor, ein Schiff mit so vielen Leuten … Jeder tut sein Bestes.
Wir sind ja so froh, hier zu sein, sagte Mahindan und hielt seinen Sohn noch fester im Arm. Ganeschas Elefantenrüssel bohrte sich in seinen Hinterkopf.
Der Aufseher gab eine Anweisung.
Komm her, Kindchen, sagte die Schwester zu Sellian.
Sei schön lieb, sagte Mahindan, zeig Appa, wie tapfer du sein kannst.
Sellian bemühte sich, das Schluchzen zu unterdrücken, da kam der Schluckauf. Er wurde weggeführt und konnte nur noch den Kopf umdrehen und über die Schulter zurückschauen. Mahindan Brust zog sich zusammen. Die meisten Frauen waren jetzt im Bus und starrten aus den Fenstern. Die Männer starrten auf ihre Füße. Mahindan spürte, wie Kumurans Frau ihn mit ihrem harten, unversöhnlichen Blick fixierte. Er bemühte sich mit aller Kraft, ein ruhiges und zuversichtliches Gesicht zu zeigen. Als er Sellian noch einmal ansah, sah er Chithras Augen, ihre großen Vorderzähne.
Sellian verschwand im Bus und die Türen schlossen sich zischend. Angst und Entsetzen überfluteten Mahindan wie ein Tsunami das Land. Die Welle kam unaufhaltsam anschwellend auf ihn zu. Mit zusammengekniffenen Augen verfolgte er das Heck des davonfahrenden Busses, aber alles, was er sah, war Dunkelheit.
TERORISTEN RAUS!
Priya war bei einem Besuch des Marinemuseums schon einmal auf der Basis der kanadischen Streitkräfte in Esquimalt gewesen. Sie konnte sich daran erinnern, wie ihr Bruder sie an den Zöpfen gezogen hatte, um sie zu ärgern. Ob ihre Eltern dabei gewesen waren, wusste sie nicht mehr. Es war durchaus möglich, dass die Erinnerung sie trog.
Gigovaz’ Auto wurde von einem Sicherheitsoffizier durch den Checkpoint gewinkt, und sie fuhren auf das Gebäude zu, wo die Flüchtlinge verhört werden sollten. Das war ein grauer Klotz auf einer schmalen Landzunge, begrenzt von Wald und Meer. Die Sonne war voll aufgegangen, der Himmel komplett wolkenlos, die Erde trocken.
Auf dem Parkplatz standen die Kleintransporter von Radio und Fernsehen, Kameraleute liefen mit geschulterten Geräten herum, Reporter blätterten in ihren Notizblöcken. Gegenüber vom Gebäude wurde ein Podium errichtet, und ein junger Mann hantierte an einem Schild, das vor einem Rednerpult hing.
Wer gibt hier eine Pressekonferenz?, fragte Gigovaz.
Minister Blair, antwortete der Mann.
Öffentliche Sicherheit, erklärte Gigovaz seiner Assistentin. Nicht Einwanderung. Interessant, meinen Sie nicht auch?
Der Weg zum Eingang war beiderseitig mit Planen abgeschirmt. Ein halbes Dutzend Leute standen in einer Reihe da, schwenkten selbstgefertigte Plakate und skandierten Sprüche. Ein Mann mit Jacke und Logo eines Fernsehsenders schwenkte seine Kamera von rechts nach links. Gigovaz ging an ihm vorbei, sah und hörte nichts. Priya las, was auf den Plakaten stand. Schickt das illegale Pack zurück! Teroristen raus! Sie hätte die Leute gern auf den Rechtschreibefehler hingewiesen.
Sie kamen ins Gebäude, aber das war menschenleer. Allein am Empfangstresen saß eine Frau mit Haarknoten und Bowler-Hut. Sie gab ihnen ihr Namensschild und Priya hängte es sich gleich um den Hals. Auf einer Seite stand ein blaues V, auf der anderen Seite sah sie ihren Namen und ihr Gesicht. Es war ihr ID-Foto aus der Kanzlei. Vor einem Monat war es aufgenommen worden. Sie hatte auf einem Hocker im Postraum gesessen, und ein Typ mit Nackenmatte hatte sie angewiesen, nicht zu blinzeln. Auf dem Foto sah sie verängstigt und gekünstelt aus.
Wo sind sie denn alle?, fragte Priya.
Nach Ihnen, sagte Gigovaz mit übertriebener Geste seiner linken Hand und zog mit der rechten eine schwere Tür auf.
Menschen- und Motorenlärm schlug ihnen entgegen, Hubschrauber dröhnten über ihren Köpfen und Krankenwagen warteten mit leerlaufendem Motor. Sie waren jetzt hinter dem Gebäude und blickten auf einen weiteren Parkplatz, der mit weißen Zelten übersät war. Dahinter konnte man das Meer sehen, den Hafen, die gelben Kräne, die hölzernen Docks. Priya musterte die Schiffe und sah den Frachter. Er war riesig – an die siebzig Meter lang – mit weißem Rumpf, einer blauen Kabine am Heck und an den Seitenwänden abwärtslaufenden Roststreifen.
Die Zahl der Flüchtlinge war überwältigend. Die Schlangen, die von jedem Zelt, jedem Tisch ausgingen, die sich umeinanderwanden und gegenseitig überkreuzten, machten es unmöglich zu erkennen, wo eine Schlange aufhörte und eine andere anfing. Männer, Frauen, Kinder, Menschen jeden Alters, heruntergekommen und abgezehrt, frierend in Decken gehüllt, obwohl es Sommer war.
In dieser Menschenmenge bemerkte Priya eine Frau mit einem verbundenen Auge, ein Kind, das gestützt auf einen kleinen Stock daher humpelte. Sie war verwundert, wie wenige Verletzte es gab, aber dann ging ihr auf, dass hier ja die Überlebenden waren. Ankunft der Stärksten.
Menschen strömten nach allen Seiten. Ein uniformierter Beamter hielt Gigovaz und Priya an, um zwei Frauen in Krankenhausbekleidung vorbei zu lassen. Freiwillige Helfer in roten Hemden transportierten Kisten mit der Aufschrift H2O. Fast alle trugen Mund- und Nasenschutz. Über dem Gewimmel hing eine Aura von Chaos und Bürokratie. Priya entzifferte die Akronyme: Canada Border Services Agency, Canadian Forces, Victoria General Hospital, Royal Canadian Mounted Police – Grenzschutz, Militär, Krankenhaus, Polizei.
Gigovaz bearbeitete im Gehen sein BlackBerry mit beiden Daumen. Halten Sie Ausschau nach Sam, sagte er.
Mensch, Ort oder Sache?, hätte sie gern gefragt.
Sie kamen vorbei an einem Zelt mit einem seitlich aufgedruckten Roten Kreuz. Ein handgeschriebenes Schild verkündete: Zutritt nur mit Schutzmaske. Die Eingangsklappe war hochgeschlagen und Priya sah braune Glieder, Blutdruckmanschetten und Turnschuhe. Eine Krankenschwester kam mit vorgebeugtem Kopf herausgerannt, so als suchte sie einen verlorenen Ohrring. Sie war von Kopf bis Fuß in einen durchsichtigen gelben Plastikumhang gehüllt. Ein Mann in kurzärmeliger Arztbekleidung folgte ihr. Er trug eine Chirurgenkappe, Latexhandschuhe und Schutzbrille. Über die Schultern baumelte ein Stethoskop. Tief durchatmen, sagte er und legte der Schwester eine Hand auf den Rücken.
Priya versuchte, aus dem Stimmengewirr Tamil herauszuhören, hier und da vielleicht ein Wort aufzufangen. Aber die Akzente waren durchdringend spitz, und sie hatte bei ihren Eltern nur die weichere Version der Sprache gehört.
Ein Mann im Rollstuhl hielt einen Plastikbeutel fest im Schoß, ein Bein war nur noch ein Stumpf. Hinter ihm eine Frau mit zwei Mädchen an der Hand. Die eine hatte lange Zöpfe, die andere kurzgeschnittenes struppiges Haar, als hätte sie selber Messer angelegt. In der Wolke von Chili-Pulver, Körpergeruch und Urin, die die drei vor sich her schoben, musste Priya den Atem anhalten. Das geschorene Mädchen starrte sie im Vorbeigehen über die Schulter an. Getroffen von der Anklage in ihrem Blick, wäre Priya beinahe nach hinten umgekippt. Da fiel ihr Gigovaz ein, und dem wollte sie nicht in die Arme fallen; sie drehte sich um, aber er war schon weg. Als sie ihn am Eingang eines der größeren Zelte erblickte, drängte sie sich, erleichtert wegzukommen, so schnell es ging durch die Menge.
Wir können fünf Erwachsene mit minderjährigem Anhang übernehmen, sagte Gigovaz zu einem dunkelhäutigen Mann mit schwungvollem Schnurrbart.
Der Schnurrbärtige hielt ein Klemmheft und einen dicken gelben Ordner in den Händen.
Sam Nadarajah, stellte er sich Priya vor. Ich komme vom Tamilischen Bund.
Gigovaz sagte, auf Priya weisend: Meine Jurastudentin.
Priya Rajasekaran, warf sie schnell ein, damit Gigovaz ihren Namen nicht wieder verstümmelte. Der Ton, mit dem er meine Jurastudentin gesagt hatte, gefiel ihr gar nicht.
Ein Beamter kam mit einer Gruppe sri-lankischer Männer aus dem Zelt und trieb sie vor sich her. Gigovaz, Sam und Priya traten schnell beiseite.
Das können doch nicht nur dreihundert Leute sein, sagte Gigovaz.
Sam klemmte das Schreibbrett zwischen die Beine und versuchte, den Ordner aufzumachen. Sein Schreibstift fiel zu Boden. Er sagte: Es sind mehr, als wir erwartet hatten.
Priya hob den Stift auf.
Romba nandri, dankte Sam ihr auf Tamil, und Priya hörte seinen weichen Akzent.
Gerne, sagte sie auf Englisch.
Wie es im Augenblick aussieht, sind es fast vierhundert, erklärte er Gigovaz. Vielleicht fünfhundert. Wir wussten, wie groß das Schiff ist, aber wir dachten, es wären höchstens dreihundert. Keiner hatte mit so vielen gerechnet.
Haben Sie meine Klienten ausgewählt?, sagte Gigovaz. Hat die Einwanderungsbehörde ihre Aussagen schon entgegengenommen?
Ärztliche Untersuchungen, Auswertung und Verfahren, Aussagen und Berichte, alles ist in Gang. Wir wissen aber nicht … das kann eine Weile dauern. Sam sah Priya an und fügte hinzu: Wir haben nicht genug Dolmetscher, und das macht alles so langsam. Können Sie, vielleicht …
Gigovaz scrollte schon durch seine Texte. Das ist in Ordnung, sagte er. In der Zwischenzeit kann ich noch einiges erledigen. Wo brauchen Sie sie?
Im großen Krankenzelt, sagte Sam. Da ist nur eine Schwester, die Tamil spricht.
Priya wollte etwas sagen.
Es wird Stunden dauern, bis wir unsere Klienten sehen, sagte Gigovaz und blickte nicht von seinem BlackBerry auf. Sie können sich schon noch nützlich machen.
Das Blut schoss Priya ins Gesicht. Aber ich …
Kommen Sie, sagte Sam, ich werde Sie vorstellen. Das wird eine große Erleichterung für die Leute sein.
Moment mal! Priyas Stimme kam schrill und wie abgewürgt heraus. Ich kann nicht, sagte sie. Ich spreche kein Tamil.
Gigovaz sah auf: Was?
Tut mir leid.
Ich dachte, Sie wären Tamilin.
Ich verstehe hier und da ein paar Sätze. Aber ich kann nicht übersetzen. Ich kann kein Gespräch führen.
Beide Männer starrten sie an.
Sie haben nie danach gefragt, sagte sie und erschrak über ihre weinerliche Stimme.
Gigovaz schnaubte frustriert. Wie sollen wir uns mit unseren Klienten verständigen?
Ich bin davon ausgegangen, dass wir einen Dolmetscher bekommen, sagte Priya. Das ist nicht meine Schuld, dachte sie.
Sam sagte: Okay. Kein Problem. Wir holen gerade ein paar Leute vom Tamilischen Bund. Ich werde Ihnen jemanden zuteilen.
Sam wurde gerufen, und er verabschiedete sich mit hastigem Händedruck. Ich schreibe Ihnen dann, sagte er zu Gigovaz. Schön, Sie kennengelernt zu haben, Priya.
Ich freue mich, dass wir zusammenarbeiten, sagte sie auf Tamil. Die ungewohnten Laute verhedderten sich auf ihrer Zunge, das war ihr peinlich. Sie hätte einfach auf Englisch goodbye sagen sollen.
Während Priya noch mit Sam sprach, war Gigovaz schon gegangen, und sie musste ihm wieder mal nachlaufen.