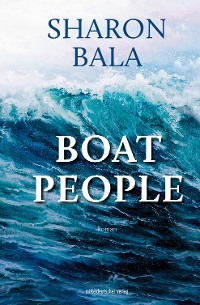Kitabı oku: «Boat People», sayfa 3
EIN GUTES LAND
Sie kamen an einen hohen, oben mit Stacheldraht verstärkten Maschendrahtzaun. Zwei Wachtposten schoben das Tor auf und gaben den Blick frei auf ein weitläufiges Gefängnisgelände, das von einem achtstöckigen Gebäude mit blaugetönten Fenstern beherrscht wurde. Mahindan war erleichtert, als sie zurückfuhren und vor einem kleineren, freundlicher aussehenden Haus anhielten.
Er stieg mit den anderen mühsam aus dem Bus und wartete, bis ihnen die Fesseln von Händen und Füßen abgenommen wurden. Der Mann mit den Schlüsseln vermied jeden Augenkontakt. Das Gebäude, in das man sie führte, sah aus wie aufgeblasen, ein Riesenballon, der der Erde entstiegen war. Im Innern herrschten rechteckige, präzise Geometrie und blendend weiße Helligkeit. Alles war auf Hochglanz poliert, auch der Fußboden.
Das erinnerte ihn an eine Raumstation in einem alten Stanley-Kubrick-Film, den er zusammen mit Chithra im Kino gesehen hatte, als sie noch nicht verheiratet waren. Voller Spannung hatten sie in der Dunkelheit verfolgt, wie der teuflische Computer auf dem Raumschiff lebendig wurde. Im entscheidenden Augenblick, als er einen der Astronauten in den Raum stieß, schlug ein Mann, der hinter ihnen saß, mit den Beinen aus, so dass Chithra in ihrem Sitz nach vorn flog und vor Schreck laut aufschrie. Mit Schaum vor dem Mund schlug der Mann um sich, der Film musste unterbrochen werden, bis man ihm ein Schlüsselbund zwischen die Zähne gestopft hatte. Mahindan und Chithra waren mit dem Bus nach Hause gefahren, ohne das Ende gesehen zu haben.
Ist das wirklich ein Gefängnis?, fragte Ranga. Mahindan gab keine Antwort. Er trat etwas näher an den Zeitungsmenschen heran, der vor ihm stand.
Dann ging es in Einzelreihe, einer hinter dem andern, unter langen, über ihren Köpfen hängenden Leuchtröhren in einen endlosen Korridor, vorbei an Türen rechts und links, durch deren viereckige Sichtfenster Mahindan Doppelstockbetten und Waschbecken sehen konnte.
Er fragte sich, wie es wohl im Frauengefängnis aussah, und er machte sich Sorgen, wie Sellian ohne ihn zurechtkam. Neun Monate lang, seit dem Tag, als sie auf den Lastwagen der Vereinten Nationen aus Kilinochchi fliehen konnten, waren sie unzertrennlich gewesen. Jetzt fühlte sich Mahindans Hand, die Sellian immer gehalten hatte, entsetzlich leer an.
Die Männer wurden in einen Waschraum geführt, wo sie sich gruppenweise waschen konnten. Als Mahindan an der Reihe war, knöpfte er das Hemd auf und zog so heftig am Gürtel, dass Hose und Unterhose sich mit einem Zug lösten. Seit Monaten hatte er die Sachen nicht wechseln können. Sie abzustreifen war, als schälte er sich aus einer schmutzigen Hautschicht heraus. Feuchter, modriger Gestank stieg ihm in die Nase.
Splitternackt stand er da, fühlte sich entblößt und erleichtert zugleich. Jetzt, wo es ans Waschen ging, merke er erst richtig, wie viel Dreck sich überall an seinem Körper festgesetzt hatte – in den Ohren, unter den Fingernägeln, in der Gesäßspalte. Kräftig rieb er sich die Arme ab und hatte kleine Dreckklümpchen an den Fingern, den Schweiß und den Staub von Monaten.
Der Aufseher zeigte auf einen Abfalleimer, und Mahindan warf alles hinein: Hemden, Hosen, Schuhwerk alles. Die Sandalen versanken darin und er hoffte, man würde alles verbrennen.
Er bekam ein Handtuch und ein Stück Seife und trottete, zusammen mit elf anderen Männern, in einen gefliesten offenen Raum. Der Fußboden war nass. An der Wand waren auf Brusthöhe große runde Drehscheiben und Haken für die Handtücher angebracht. Mahindan hockte sich hin, aber es gab keinen Eimer und keinen Wasserhahn.
Das Wasser kommt aus der Decke, rief der Zeitungsmensch von der anderen Seite des Waschraums. Alle standen sie mit dem Gesicht zur Wand und dem nackten Rücken den anderen zugekehrt. Ganz oben über seinem Kopf entdeckte Mahindan den Wasserhahn. Mit dieser kanadischen Waschvorrichtung konnte er überhaupt nichts anfangen.
Ihr müsst an der Scheibe drehen, rief der Zeitungsmensch. Mahindan hörte es regnen, drehte sich um und sah den Zeitungsmenschen unter einem Wasserfall stehen, sah, wie er sich mit der Seife kräftig die Achselhöhlen rieb, so als hätte er das schon oft getan.
Mahindan trat zur Seite und drehte vorsichtig an der Scheibe. Das Wasser schoss aus dem Hahn. Er streckte die Hand aus und fühlte, wie warm es war.
Ihr müsst euch drunterstellen, rief der Zeitungsmensch.
Mahindan sah, wie die anderen der Anweisung folgten, und tat es auch. Er hielt die Luft an und trat unter das herabströmende Wasser. Es schlug hart auf ihn ein und er musste schlucken, um nicht aufzuschreien. Alles, was er jetzt hörte, war der Wasserstrahl – laut, unangenehm, feindselig.
Er seifte sich ein, bis es schäumte – Monate von Blut und Krieg rannen schlammig schwarz in den Abfluss in der Mitte des Raumes. Die Schrecken von Sri Lanka wurden weggewaschen mit kanadischen Wassern, verschwanden in kanadischen Abflussrohren.
Er seifte sich die Haare kräftig ein, Schaum triefte ihm vom Bart. Der Aufseher rief irgendetwas, dann kam von weit her und von Wasser überströmt die Stimme des Zeitungsmenschen: Beeilt euch mal, draußen warten noch mehr.
Mahindan stand auf einem Fuß und säuberte sich die Zehen. Er rubbelte die Seife von den Fingernägeln. Es war anstrengend, das alles unter dem peitschenden Wasser und mit geschlossenen Augen zu bewerkstelligen. Er dachte an die Eimer auf dem Schiff – und den Luxus des einfach aus der Wand strömenden sauberen Wassers hier. Wie viel besser es doch in diesem neuen Land war, trotz der unangenehmen Wäsche im Stehen.
Notdürftig mit ihren Handtüchern bedeckt, wurden sie in einen Ankleideraum geführt. Mahindan fühlte sich wohl wie nie in seiner eigenen, glatt geschrubbten, um einige Töne helleren Haut. Einer nach dem andern mussten sie sich an eine Messleiste an der Wand stellen und dann die Füße in eine Metallvorrichtung setzen. An einem Schalter reichte ein Mann in Uniform jedem ein Bündel durch die Fensteröffnung: graue Hose, grüner Pullover, Turnschuhe.
Mahindan bewunderte die langen weißen Schnürsenkel mit ihren durchsichtigen Plastikröhrchen an beiden Enden. Er zog die Schuhzunge hoch und schlüpfte mit dem Fuß in den bequemen, warmen Schuh. Er fädelte die Schnürsenkel ein, betrachtete das Etikett an der Ferse und war überrascht, dass es keine Schuhe von Bata waren.
Noch nie hatte er solche Schuhe getragen und fragte sich, ob Sellian so etwas Ähnliches bekommen hatte, ob er auch diese komische Körperwäsche im Stehen über sich hatte ergehen lassen müssen, ob sie ihm Angst eingejagt hatte, ober er geweint hatte. Der Gedanke an Kumurans Frau löste ungute Gefühle in ihm aus, er wusste nicht, wie diese Frau mit seinem Jungen umgehen würde. Die Erinnerung daran, wie Sellian unter Schluckauf die Tränen zurückgekämpft hatte, schnürte ihm die Brust zu. Aber Sellian und der Sohn dieser Frau sind ja befreundet, sagte er sich. Und außerdem war es auf kurze Zeit. So als hätte er den Jungen in ein Internat geschickt.
Internat, sagte er sich noch einmal. Machten die Eltern sich den ganzen Tag Sorgen, wenn ihre Kinder in so einem Internat waren? Nein, das taten sie nicht.
Der Aufseher gab ihnen ein Zeichen, alle drehten sich wie auf Kommando um und sahen: zwölf Männer in derselben Uniform, mit tropfenden Bärten und nass auf der Stirn klebenden Haaren.
Sie brachen in ein ohrenbetäubendes Gelächter aus. Mahindan bog sich vor Lachen, krümmte sich in rasenden Zuckungen. Nach allem, was er durchgemacht hatte – dem schreienden Baby an der Brust der toten Mutter, dem zerfetzten Zelt, den Monaten auf dem Meer –, nach all dem waren sie nun hier. In einem Land, wo es Regen im Haus gibt und für jeden den gleichen grünen Pullover. Mahindan stützte sich auf einer Seite ab, richtete sich auf und sah, wie der Aufseher sie ratlos anstarrte.
Dann ging es zurück in den langen Korridor. Ihre Gummisohlen quietschten auf dem Linoleum. Sie hielten vor jeder Tür an, und je drei wurden hineingewiesen. Einige der Männer lachten noch vor sich hin. Mahindan strich mit der Hand über seinen Pullover, spürte den Arm im Ärmel, die weiche Baumwolle auf der Haut. Ich bin kein Tier, dachte er. Und zum ersten Mal seit langem fühlte es sich an wie die Wahrheit.
Er kam in eine Zelle zusammen mit Ranga und dem Zeitungsmann. Drei schmale Betten aus Metall, eins doppelstöckig, eins einzeln, mit grauen Decken und weißen Kopfkissen. Die Wände waren aus Beton.
Ohne auch nur ein Wort zu verlieren, nahmen sie ihre Betten ein. Mahindan kletterte auf das obere Bett und rollte sich seitlich darauf. Seine Beine brummten vor Erleichterung und Erschöpfung. Jetzt merkte er, wie weh sie ihm taten. Der ganze Körper gab nach, überließ sich hemmungslos und total dem Bett. Die Tür schlug zu.
Die Zelle war, wie bei einer öffentlichen Toilette, oben offen. Mahindan starrte auf die Belüftungsrohre über seinem Bett, bis sie in seinen Augen verschwammen. Er hörte die gedämpften Schritte der Männer draußen im Korridor, er hörte, wie seine Zimmergenossen sich in ihren Betten umdrehten, er hörte das Rascheln des Bettzeugs, das Knarren des Bettgestells. Es war das Knirschen des Schiffes, das Rauschen der Palmenwedel über ihm. Eine Kokosnuss fiel zu Boden, und Mahindan war eingeschlafen.

Das Zelt schwankte. Mahindan fuhr zusammen. Er schlug die Augen auf und spürte eine Hand an seinem Schultergelenk.
Ein paar Rechtsanwälte sind gekommen, sagte Ranga.
Mahindan setzte sich schnell auf. Sellian! Jetzt würden sie erfahren, wie es weitergeht. Er und seine Zimmergenossen folgten dem Wärter. Sie liefen hintereinander, Mahindan bildete den Schluss, vor ihm der hinkende Ranga.
Mahindan versuchte, seine Träume ins Gedächtnis zurückzurufen. Es kamen vage Bilder, eher gefühlt als gesehen, und es überraschte ihn, dass er einige als angenehm empfand. Es waren Erscheinungen von blauer Seidenstickerei, von purpurnen Fäden, vom weiblichen Duft von Sandelholz.
Über ihnen hing ein schwarzes Schild mit roten Lettern. Mahindan betrachtete die exotischen Buchstaben, geradlinig und eckig. Das war Kanada – sauber und ordentlich. Ein gutes Land für einen Neuanfang.
Er bedauerte, seine Zelle mit Ranga teilen zu müssen, mit dieser Klette von einem Menschen, die sich ihm gleich am Anfang angeheftet hatte und einfach nicht abzuschütteln war. Aber das würde bald vorüber sein. Es war nur auf kurze Zeit, hatte die Schwester ja gesagt. Gut war hingegen, dass der Zeitungsmensch Englisch sprach. Mahindan konnte ein paar Worte von ihm aufgreifen, später würde er Englisch lernen, Arbeit bekommen, eine kleine Wohnung finden.
Sellian war ein heller Kopf. In der Schule würden sie ihm Englisch beibringen und abends könnten sie zusammen üben. Mahindan griff instinktiv nach Sellians Hand, aber die war nicht da.
Sie gingen auf drei Leute zu – einen großen weißen Mann und zwei dunkelhäutige Frauen. Die Rechtsanwälte. Eine Hoffnung leuchtete in ihm auf. Die konnten ihm bestimmt etwas über Sellian sagen.
Eine der Frauen führte das Wort. Ihr Tamil war fließend und akzentfrei. Sie war die Dolmetscherin vom Tamilischen Bund. In Kanada leben tausende von Tamilen, erklärte sie ihnen. Hunderttausende. So viele Tamilen, dass sie ihre eigene Organisation gegründet haben, die sie offiziell vertritt. Was für ein Glück, dachte Mahindan. Er hätte einen Fahrschein ohne Rückfahrt irgendwohin gekauft, nur um aus diesem gottverlassenen Land herauszukommen, aber jetzt zu sehen, dass er an einen Ort gekommen war, wo so viele Landsleute von ihm lebten, das war der reinste Glücksfall.
Die Dolmetscherin erklärte ihnen, dass Kanada von ihrem Schiff gewusst und es seit Wochen erwartet hatte. Die Ankunft war vorausgesagt worden. Mahindan sah darin ein günstiges Omen. Eine Gottheit hatte ihnen den Weg bereitet, hatte diese Tamilen in einem fremden Land dazu bewegt, ihnen zu helfen.
Der Zeitungsmensch stellte sich ihnen vor als Prasad. Das war alles geplant?, fragte er, mit den Leuten in Sri Lanka, die unsere Schiffsreise arrangiert haben?
Nein, sagte sie. Die Regierung hat das Schiff über ihr Satellitensystem entdeckt.
Wozu brauchen wir Rechtsanwälte?, wollte Ranga wissen. Er saß etwas abseits von der Gruppe, schräg der Tür zugewandt, so als wollte er jeden Moment aufspringen und weglaufen.
Das ist so, sagte die Dolmetscherin: Nach kanadischem Recht haben Sie keinerlei Status. Um hier bleiben zu dürfen, brauchen Sie zuallererst die Anerkennung als Flüchtlinge. Und das ist ein bisschen kompliziert.
Aber wir sind doch Flüchtlinge, oder?, fragte Ranga. Was sollten wir sonst sein?
Was denken sich diese Leute eigentlich?, ging es Mahindan durch den Kopf. Haben wir uns denn auf das klapprige Schiff gewagt und unser Leben aufs Spiel gesetzt, um irgendwo Ferien zu machen?
Die Dolmetscherin sagte, dass das alles sehr kompliziert sei, weil es ja juristische Definitionen und bürokratische Vorschriften gebe. Aber sie sollten sich keine Sorgen machen, der Tamilische Bund hatte Rechtsanwälte angeheuert, die alles klarstellen würden. Mahindan sah, wie Prasad nickte, und das beruhigte ihn ein wenig. Natürlich würden sie Formulare ausfüllen müssen. Die Kanadier mussten ihre eigenen, speziellen Verfahren befolgen. Gott sei Dank hatten sie Rechtsanwälte, die sie durch die Formalitäten schleusen würden.
Der große Mann hatte offensichtlich die Leitung. Mahindan konnte es an der Art und Weise erkennen, wie er lässig und breitbeinig dasaß, mit seinem ungekämmten grauen dünnen Haar, das nach allen Seiten abstand, und seinem Zweitagebart.
Die andere Rechtsperson war eine jüngere Frau von Ende zwanzig, schätzte er. Sie saß kerzengerade und hochkonzentriert auf ihrem Stuhl, so als erwartete sie, jeden Moment aufspringen und etwas äußerst Kompliziertes ausführen zu müssen. Sie hatte gleich am Anfang oben auf ihrem Block etwas notiert und dann den Stift weiter bereitgehalten, so dass etwas Tinte aufs Papier auslief. Mahindan war enttäuscht, nicht seine vertraute Tamil-Schrift zu sehen.
Er fragte nach Sellian und sah, wie die beiden Frauen etwas besprachen; er sah, wie ihre Gesten denen des großen Mannes glichen; er hörte, wie ihre Stimmen denen der Offiziere ähnelten, die ihr Schiff geentert hatten. Die Dolmetscherin trug ein goldenes Piercing im rechten Nasenflügel. Die Anwältin trug einen eng am Hals anliegenden Thali-Anhänger. Die beiden Frauen sahen aus wie Tamilen, gaben sich aber wie Kanadierinnen.
So wird das mit Sellian sein, dachte Mahindan: ein Tamile und gleichzeitig ein Kanadier. Er wird sich kleiden wie sie, er wird sich bewegen wie sie, und Kanada wird sein Land sein.
Das Frauengefängnis ist nicht weit entfernt von hier, sagte die Dolmetscherin. Ich werde einen Besuch für Sie arrangieren.
Er braucht mich in seiner Nähe, sagte Mahindan. Er ist sehr ängstlich.
Er dachte an Kumurans Frau, an den Hass in ihren Augen. Die ganzen Wochen auf dem Schiff hatten sie kein einziges Mal miteinander gesprochen, obwohl die Jungen hin und wieder zusammen gespielt hatten. Würde die sich an seinem Jungen rächen? Würde sie ihn misshandeln?
Die Frau, die sich um meinen Sohn kümmern soll, sagte Mahindan, ist ihm völlig fremd.
Er wird von Frau Savitri Kumuran beaufsichtigt?, fragte die Dolmetscherin.
Mahindan zuckte zusammen und lehnte sich zurück. Nein, ihr Name …
Die Dolmetscherin besprach sich mit den Anwälten, und Mahindan versuchte bestürzt, das, was er wusste, mit dem, was gesagt worden war, in Einklang zu bringen.
Ja, sagte die Dolmetscherin. Es ist Mrs. Kumuran. Das Gute ist, dass Sie dieselben Anwälte haben. Wir werden demnächst mit ihr sprechen. Hören Sie. Wir sind nicht in Sri Lanka. Sie haben mein Wort, dass der Junge in sicheren Händen ist. Er hat inzwischen Essen bekommen und ist gewaschen worden. Über Ihren Sohn, sagte sie mit seitlicher Kopfbewegung, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.
Irgendetwas an der Art, wie sie das sagte, und an der Bestimmtheit, die aus ihrem Gesicht sprach, flößte ihm Vertrauen ein, er glaubte ihr. Wir sind in Kanada, dachte er. Vergiss die Frau. Auf dieses Land kann ich bauen.
Wie lange sollen wir im Gefängnis bleiben?, fragte Ranga und streifte mit einer Hand flüchtig über die Narbe auf seiner Wange.
Mr. Gigovaz antwortete auf Englisch. Er richtete sich emphatisch gestikulierend an alle.
Der erste Schritt sei, ihre Identität nachzuweisen. Die Regierung würde ihre Papiere prüfen. Es gäbe viele Formulare, die sie ausfüllen müssten. Man würde sorgfältig überprüfen, wer das Gefängnis verlassen dürfe. Darauf folge eine Anhörung, um festzustellen, ob sie Flüchtlingsstatus beantragen dürften. Und dann käme eine weitere Anhörung, ob der Flüchtlingsstatus ihnen gewährt werden könne. Das war das Prozedere, und es würde eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Niemand könne voraussagen, wie lange es dauern wird.
Kann mein Sohn nicht hier unterkommen?, fragte Mahindan. Er ist noch klein … gerade mal sechs Jahre.
Sie müssen schon Geduld haben, sagte Mr. Gigovaz. Frauen und Kinder werden vorrangig behandelt.
Das alles klang kompliziert und ermüdend. Mahindan konnte den Unterschied zwischen der einen Anhörung und der nächsten nicht begreifen. Die ganze Zeit waren sie in Sri Lanka auf der Flucht gewesen, dann kamen sie ins Gefangenenlager, und immer ging es nur darum, am Leben zu bleiben und rauszukommen. Er hatte sich kaum Gedanken darüber gemacht, was passieren wird, wenn das Schiff in einen Hafen einläuft. Nur diese vage Vorstellung hatte er gehabt: Sie würden das Schiff verlassen und frei ihrer Wege gehen. Jetzt aber schien ihre Ankunft wieder nur ein Anfang zu sein. Sein Optimismus trübte sich angesichts der Aussicht auf einen erneuten langen Weg.
Die Dolmetscherin musste die Enttäuschung im Raum gespürt haben. Machen Sie sich doch bitte keine Sorgen, sagte sie. Sie sind in ein gutes Land gekommen. Hier sind Sie gut aufgehoben.
VERHANDLUNGEN
April 2002
Los!, rief Chithra. Sie sprangen von ihren Sitzen und rannten den staubigen Weg entlang. Als Mahindan einem Hund ausweichen musste, überholte Chithra ihn mit ihren bimmelnden Fesselglöckchen.
Der Aprilhimmel leuchtete tiefblau, die Reisfelder waren saftig grün. In weiter Ferne trotteten Elefanten daher.
Mahindan holte sie am Staubecken ein. Eine Herde Wasserbüffel kühlte sich am flachen Rand ab, die Kolosse warfen sich ins Schilfdickicht und spritzten wild um sich.
Aiyo!, rief sie und prustete und lachte. Hättest beinah jemandes Ammachi über den Haufen gelaufen!
Poodi visari, scherzte er zurück. Nichts als Ärger.
Mahindan liebte ihr gemächliches Samstagsritual. Morgentee mit Milch in einem schattigen Eckchen. Idli, wenn die Mischung von Reis und Linsen über Nacht ausgegoren war. Dann der wöchentliche Gang auf den Markt. Später zu seinen Eltern, wo es ein großes Mittagsmahl für die ganze Familie gab, wo die Frauen kochten und die Männer über Politik sprachen und Zoten rissen. Mit gefüllten Mägen ging es zurück nach Hause, um dort den heißesten Teil des Tages zu verschlafen. Sein Leben lang würde Mahindan diese schläfrigen Nachmittage, das Surren des Deckenventilators, das gedämpfte Licht durch das Moskitonetz, als Bilder von Glück, von erfüllter Zufriedenheit im Gedächtnis tragen.
Sie überquerten den Spielplatz hinter dem hinduistischen Mädchen-College, wo zwei Frauen ein Transparent mit der Aufschrift Willkommen Zurück aufhingen. In der Nähe des Eingangs zog ein Mann ein erschreckendes rotes Schild mit Totenkopf und zwei darunter gekreuzten Knochen aus der Erde. Es war vier Jahre her, dass die Tamil Tigers die Garnison der sri-lankischen Armee aus Kilinochchi vertrieben hatten, aber ihre Abschiedsgeschenke – Landminen und Minenfallen – wurden immer noch gefunden und beseitigt.
Mahindan und Chithra parkten ihre Fahrräder in einer Seitenstraße und gingen zu Fuß auf den Markt. Fahrradrikschas warteten auf Fahrgäste, geparkte Motorräder auf ihre Besitzer. Menschen liefen geschäftig mit ihren Einkaufssachen und Kindern vorbei, alle grüßten freundlich und winkten in entspannter Wochenendheiterkeit einander zu.
How machan?
Komm doch heute Abend zu uns. Die Jungs spielen wieder Cricket.
Meenakshi! Wie oft muss ich dir sagen, dass du nicht auf das Ding klettern sollst!
Die Betreiberin des Internet-Cafés stand angelehnt an die Hintertür ihres Ladens. Sie war uralt, ihr Gesicht übersät mit Pockennarben und zerfurcht von zu viel Betelgenuss. Die in ein Betelblatt gewickelte Arecanuss, an der sie mit energischem Unterkiefer kaute, wölbte ihre rechte Wange. Als sie den Mund aufmachte, konnte Mahindan ihre geröteten Zähne und die Lücken dazwischen sehen.
Wie läuft’s mit dem Internet?, sagte er.
Sie drückte einen Finger in Chithras Bauch. Noch keine Babas? Dann mit anzüglichem Grinsen zu Mahindan: Zwei Jahre verheiratet. Weißt du eigentlich, was man da machen muss?
Je älter die Jungfer, desto länger die Nase, zischte Chithra, als die Alte sie nicht mehr hören konnte.
In ihrem Freundeskreis waren Mahindan und Chithra die Ersten gewesen, die geheiratet und einen Hausstand gegründet hatten. Ein Kind wollten sie vorerst noch nicht haben, die politische Lage war zu unsicher. Aber seit den Feuerpausen im Dezember und jetzt dem endgültigen Waffenstillstand im Februar wurde dieses Thema wieder aktuell.
Die Frauen wollten ihre Babys zur gleichen Zeit haben, und er konnte sich nichts Besseres vorstellen, als die Kinder in einem Schwarm von Cousins und Kusinen aufwachsen zu sehen, wo jede Tante auch eine Mutter und jeder Onkel auch ein Vater war. Chithra wollte mindestens vier Kinder haben, drei Jungen und ein Mädchen. Man muss schon eine gute Anzahl haben, sagte sie. Um jeden Verstorbenen zu ersetzen.
Der Markt war ein heruntergekommenes Gelände. Die Läden und Verkaufsstände waren dicht zusammengedrängt, die Käufer mussten schreien, um gehört zu werden, die Verkäufer taten ihr Bestes, sie alle zufriedenzustellen. Kinder und Hunde krochen ihnen zwischen den Beinen herum. Über dem ganzen Trubel dröhnte das rhythmische Klack-Klack der Hackmesser, mit denen die Männer Kothu zubereiteten. Um die Hüften hatten sie ihre Sarongs gebunden und stellten ihre Bäuche zur Schau. So standen sie da und zerschnitten Roti über heißen Platten, Rauchwolken vermischten sich mit Schweiß und Fliegen, mit den Gerüchen von gebratenem Gemüse und Chili-Pfeffer.
Mahindan konnte sich gut daran erinnern, wie der Markt während der Militärbesatzung ausgesehen hatte. Noch unverheiratet, hatte er bei seinen Eltern gewohnt und seine Mutter auf den Markt begleitet, vorgeblich um ihr die Taschen zu tragen. Die meisten Stände waren in diesen Tagen leer gewesen. Die wenigen Einwohner, die nicht geflohen waren, eilten mit gesenktem Blick ein und aus, möglichst schnell an den bewaffneten Patrouillen vorbei. Jedes Mal, wenn Mahindan und seine Mutter einem dieser Soldaten näher kamen, krallte sie sich ein wenig fester in seinen Arm.
Jetzt aber platzte der Markt förmlich aus den Nähten, und das Geschäftsgewimmel schwappte in die Seitenstraßen über. Hühner in engen Käfigen erwarteten ihr Schicksal. Girlanden hingen von den Dachbalken der Läden herab. Chithra ging schnurstracks auf einen Fischstand zu und Mahindan blieb hinter einem Lieferjungen stecken, der sein Fahrrad mit einem Büschel aus hunderten von reifen Bananen beladen hatte und es mühsam durch die Menschenmasse schob.
Chithra sah sich die Makrelen an, prüfte mit zwei Fingern ihre Festigkeit. Die Fische lagen wie ein glänzendes Band aus schillernden Schuppen und schwarz glänzenden Augen aufgereiht auf einem stabilen Holztisch. Anchovis und Sardinen wurden in Plastikeimern feilgeboten.
Der Fischer trug einen Sarong, seine wohlbeleibte Frau einen blauen Polyester-Sari. Sie nahmen die Fische in ihre bloßen Hände, hielten ihren Kunden zur Begutachtung eine gelbe Flosse oder ein riesiges Auge unter die Nase. Die Frau hatte sich einen Behälter mit Garnelen wie ein Wickelkind um den Bauch gebunden. Mit der freien Hand zählte sie dem Kunden das Wechselgeld ab.
Jetzt bin ich dran, sagte Chithra und schubste einen Mann zurück, der sich vordrängeln wollte.
Der Mann gab Mahindan einen vorwurfsvollen Blick. Der verbiss sich das Grinsen und zuckte nur mit den Achseln, was so viel heißen sollte wie: Was kann ich da schon machen?
Der Fischer legte Chithras Makrele auf die Waage. Dreihundert Rupien.
Nein?!, rief sie halb fragend laut aus. So viel?
Aber sehen Sie doch, wie frisch die ist. Der Fischer steckte einen Daumen in die rosa Kiemen und wies mit der anderen, halb geballten Hand beschwörend gen Himmel: Dieser Bursche ist vor ein paar Stunden noch lustig herumgeschwommen.
Chithra hob den Kopf und stemmte eine Hand in die Hüfte. Ah, aber das ist ja ein Winzling von einem Fisch, sagte sie. Wie wär’s mit zweihundert?
Packpapier kam auf den Tisch. Der Fisch wurde eingewickelt.
Zweihundert, sagte der Fischer. Wie kann ich denn für so wenig verkaufen?
Ich bin eine arme Frau, ich muss mein Geld zusammenhalten, sagte Chithra.
Alle müssen ihr Geld zusammenhalten, sagte er. Zweihundertfünfzig.
Sie gab ihm das Geld, ehe er es sich noch anders überlegen konnte, und der Fischer schüttelte grinsend den Kopf. Ihr Frauchen ist ganz schön clever, versicherte er Mahindan.
Als sie zum Gemüsestand kamen, sagte Chithra, dass sie Kool machen wollte, eine Fischsuppe. Sie kauften grüne Bohnen, Spinat, Maniok, Karotten, Kürbis und eine weiße Aubergine. Die Paprikaschoten gefielen ihr nicht.
Die sind nicht frisch genug, erklärte sie der Frau.
Zwei für den Preis von einer, gab die Frau zurück. Haben Sie meine Eier gesehen?
Mahindan wollte sie gerade daran erinnern, dass sie keine Eier mehr hatten, aber Chithra warf schnell ein: Wir brauchen keine Eier.
Nur zwanzig Rupien, sagte die Frau.
Beladen mit ihren Einkäufen gingen sie weiter. Chithra musste über die Eier lachen.
Wie schön, alles billiger zu bekommen, frotzelte er.
Wieso billiger? Die Aubergine war viel zu teuer.
Alle betrieben das gleiche Spielchen. Sie warfen den Preis wie einen Ball hin und her, haderten über angebliche Makel, nur, um Druck auszuüben.
Wie können Sie so viel verlangen?
Können Sie nicht ein bisschen runter gehen?
Weiter runter geht’s nicht, Sir. Absolut nicht.
Sie schlenderten durch die Süßwarengeschäfte, wo es nach Rosenwasser und zuckersüßem Sirup duftete. An den Fleischerläden gingen sie vorbei. Der Mann, der kleine Statuen und Öllampen verkaufte, war gut im Geschäft. Alle heiraten, sagte Chithra.
Im Trockenwarenladen schaufelte Mahindan roten Reis aus einem zwei Fuß hohen Fass. Chithra wog Palmyra-Wurzelmehl ab. Am Ladentisch bekamen sie Cashewnüsse und Rosinen.
Können Sie da nicht was machen?, fragte Chithra, und eine extra Handvoll wurde ihr stillschweigend dazugegeben.
Mahindan fand diese Verhandlungen immer etwas peinlich. Wenn Chithra richtig loslegte – bei einer größeren Summe war sie ganz in ihrem Element –, ging er nach draußen und drehte ein paar Runden. Chithra ihrerseits konnte seine Empfindlichkeit nicht verstehen.
Als sie noch nicht lange verheiratet waren und Mahindan einmal allein auf den Markt gehen musste, weil Chithra krank und mit Bauchschmerzen darniederlag, war sie entsetzt, als er zurückkam. Achtzig Rupien für ein Kilo Reis! Dreihundert für ein Kilo Orangen? Wie viel dann für die Eier? Sie fasste sich an die Stirn und jammerte: Aiyo! Die werden dich dein Leben lang über den Tisch ziehen. Diese Gauner lachen sich ins Fäustchen, wenn sie dich sehen: Hier kommt der Dumme, der gestern aus dem Ei gekrochen ist.
Wie wäre es wohl, wenn es feste Preise gäbe? Das wollte Mahindan in seiner Autowerkstatt ausprobieren. Als er das Geschäft von seinem Vater übernommen hatte, stellte er unverzüglich eine Preisliste mit der Erklärung auf, dass diese Preise unverhandelbar seien. Sein Vater hielt das für hellen Wahnsinn, aber schon nach einem Jahr hatten seine Kunden sich an seine Festpreise gewöhnt.
Ihr letzter Stopp war bei dem Töpferladen, der sich hinter dem Markt befand.
Wie findest du diesen hier? Chithra hielt ihm einen Wasserkrug mit dickem Bauch und langer dünner Tülle hin: orangefarbene Terrakotta mit rotem geometrischem Muster. Sie könnten ihn zu Hause gründlich mit kochendem Wasser ausspülen, drei Mal, und dann für ihr Trinkwasser benutzen.
Wie du willst, sagte Mahindan.
Chithra war durchaus wählerisch bei der Anschaffung kleinerer Haushaltsgegenstände. Was sie an Hausrat besaß, sollte zusammenpassen, aber nicht gleichförmig sein. Noch schwebte sie in dem jungen Glück, Herrin ihres Hauses zu sein.
Sie standen hinter einer jungen Frau, die einen ähnlichen Krug kaufte. Der Ladeninhaber nannte einen Preis und sie bezahlte ihn anstandslos. Er wickelte den Krug in Zeitungspapier, und sie machte ihm dafür ein Kompliment. Sie sprach mit einem unbestimmbaren Akzent. Sie trug kurze Jeans und ein rotes T-Shirt. Ihr Haar war glatt zurückgekämmt und zu einem Pferdeschwanz gebunden. Australien, schätzte Mahindan. Obwohl er wusste, dass Leute aus England und Amerika zurückgekehrt waren. Auch aus Kanada.
Das ganze Land hatte so lange den Atem angehalten, und jetzt endlich, seit dem von Norwegen vermittelten Waffenstillstand, schien es, als ob sie alle wieder ausgeatmet hätten. Bauern gingen auf ihre Reisfelder zurück, Familien nahmen die Vorhängeschlösser von ihren verlassenen Häusern ab. Menschen, die vor Jahrzehnten ausgewandert waren, schickten ihre erwachsenen Kinder zurück und überfluteten den tamilischen Norden mit westlichem Geld.
An der Hauptverkehrsstraße entstand ein neues Stadtzentrum. Das Krankenhaus war neu gebaut worden, Postamt und Busbahnhof waren voll betriebsfähig. Wiederaufbau und Instandsetzungen – all die Bauarbeiten, die begonnen hatten, als die Tigers vor vier Jahren die Armee vertrieben, wurden jetzt mit neuem Optimismus wieder in Angriff genommen.