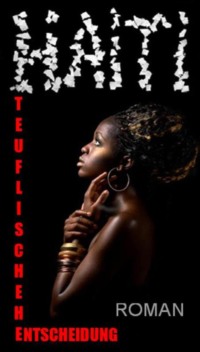Kitabı oku: «Haiti – Teuflische Entscheidung», sayfa 4
Raoul, Wilton hat sich verletzt!
Mehr Worte gebrauchte sie für diesen Widerling nicht, stattdessen machte sie sich innerlich triumphierend und vollkommen unbeirrt an die Arbeit.
Außer sich vor Sorge eilte das Familienoberhaupt aus der Hütte und kniete neben seinem verletzten Sohn auf dem staubigen Boden nieder. Loransya genoss den lädierten Anblick Wiltons und war sich jetzt ganz sicher, dass es die Art von höherer Gerechtigkeit gab, an die sie immer geglaubt hatte. Unbeteiligt trug sie von den Wehlauten des Sohnes begleitet weiter Plastikstühle und Kerosinlampen in das Haus.
Petit Nčgre!
Das Gebrüll des Vaters zerstörte die Magie dieses triumphalen Moments. Dennoch blieb Loransya nichts anderes übrig, als zu gehorchen und zu ihm zu gehen. Wilton lag noch immer auf dem Rücken. Die Schmerzschreie des jungen Mannes hallten durch das Armenviertel und hatten bereits erste neugierige Nachbarn auf den Plan gerufen. Umrandet von einer kleinen Gruppe Schaulustigen kniete Raoul vor seinem Sohn und betete lauthals um Gnade.
Ja? Loransya zog fragend die Augenbrauen nach oben, als es ihr endlich gelungen war, sich durch die kleine Menschenmenge zu kämpfen.
Los, geh zum Markt und sage Sealon, was passiert ist. Sie soll den Voodoo-Priester mitbringen!
Obwohl sie schon wie mechanisch nickte, sobald ihr eine Anweisung gegeben wurde, fehlten ihr dennoch die Ortskenntnisse um zu wissen, wo sich der Markt überhaupt befand.
Hau ab! Raouls Augen starrten sie derart hasserfüllt an, dass sie es nicht wagte danach zu fragen. An der Wasserstelle waren einige Marktfrauen, daran erinnerte sie sich, doch sicherlich gab es in dieser Millionenstadt unzählige Marktplätze. Dennoch wollte sie zunächst versuchen, die Mutter der Familie dort aufzutreiben. Das sonst so lebendige Armenviertel wirkte jetzt wie ausgestorben. Alle Bewohner hatten sich aus Angst vor einem Hurrikan in ihren Hütten verschanzt, sogar die pechschwarzen Schweine wühlten sich nicht mehr durch den Müllberg, sondern waren verschwunden. Die dunkle Wetterfront stand jetzt direkt über Loransya am Himmel. Seltsamerweise verspürte sie keinerlei Angst, sondern war fasziniert von der tiefschwarzen Färbung des Himmels und der fast schon mystischen Stille. Der Staub tänzelte über den Weg und die Luft war beinahe so klar wie zuhause. Der Gestank nach Müll, Fäkalien und Abgasen, der stetig über der Hauptstadt schwebte, war gewichen.
Die schmale Gasse und das Zuhause vieler Straßenkinder lag jetzt unmittelbar vor Loransya. Die Kinder waren gerade dabei, sich mit Hilfe unzähliger Plastikplanen einen Schutz vor dem bald nahenden Regenschauer zu bauen. Gegen einen Hurrikane freilich konnten diese einfachen Mittel wohl nichts ausrichten. Verzweifelt hielt Loransya Ausschau nach Bernard, doch sie konnte den Jungen nirgendwo entdecken. Natürlich wollte sie ihm nicht erzählen, welch beschämendes Unrecht ihr heute widerfahren war, aber seine angenehme Nähe, auf die sie insgeheim gehofft hatte, fehlte ihr im Augenblick unsagbar. Gemütlich und ohne Hektik ließ sie jetzt die Gasse hinter sich und stieg die unzähligen Treppenstufen hinunter auf den Marktplatz. Auch hier war das hektische Treiben beinahe zum Erliegen gekommen, und nur vereinzelt standen noch ein paar Marktfrauen herum, die sich beeilten, ihr Hab und Gut zusammenzupacken. Loransya steuerte direkt auf eine der Frauen zu.
Entschuldigung, ich suche Sealon. Sealon Fille!
Die junge Frau blickte kurz auf, deutete auf einen heruntergekommenen Verschlag und machte sich dann wieder an die Arbeit.
Danke!, gab Loransya höflich zurück und überquerte den Platz. Schon von außen konnte sie das laute Stimmengewirr der vielen Marktfrauen hören, die sich in dem kleinen Verschlag drängten und sich um die besten Regen geschützten Lagerplätze für ihre Waren stritten. Ohne zu zögern öffnete sie die Türe und presste sich in den engen, miefigen Raum hinein. Hier war kein Durchkommen, das sah sie auf den ersten Blick. Keiner schien von ihr Notiz nehmen zu wollen, sodass ihr nichts anderes übrig blieb, als mit lauter fester Stimme nach Sealon zu rufen. Einen kleinen Moment dauerte es, ehe sich die untersetzte Frau durch die Menschenmasse schob und Loransya verwundert musterte.
Was willst du? Hast du keine Arbeit?, herrschte sie das Mädchen zur Begrüßung an.
Doch natürlich!, gab Loransya unterwürfig zurück. Ich bin geschickt worden, um Ihnen zu sagen, dass Wilton vom Dach gestürzt ist. Ihr Mann sagt, Sie sollen nach Hause kommen und den Voodoo-Priester mitbringen.
Die Mutter der Familie brach in ein lautes Gejammer und Geheule aus, in das die anderen Marktfrauen augenblicklich einstimmten. Erst dann setzte sie sich schwerfällig in Bewegung und verließ in Begleitung von Loransya den Verschlag. Wenn das Mädchen erwartet hatte, dass sie Sealon nun Rede und Antwort stehen musste, wie es zu dem Unfall gekommen war, so hatte sie sich gründlich getäuscht. Laut jammernd und klagend schleppte sich Sealon eine Treppenstufe nach der anderen hoch und sprach dabei kein einziges Wort mit Loransya.
***
Marina Courtons ließ ihren sorgenvollen Blick Richtung Küste streifen. Die dunkle Wetterfront durfte jetzt ziemlich genau über der Hauptstadt stehen. Es war in Haiti nichts ungewöhnliches, dass sich der Beginn der Regenzeit mit einem tropischen Wirbelsturm ankündigte. Hier in den hoch gelegenen Bergen der Insel bekam man zwar höchstens noch kleine Ausläufer der Stürme ab, die sich weit über dem Meer zusammenbrauten, aber wie es in den küstennahen Slums von Port-au-Prince aussah, das wollte sich Marina Courtons gar nicht erst ausmalen. Die Ängste, die sie um ihr kleines Mädchen quälten, waren von Tag zu Tag schlimmer geworden und tief in ihrem Herzen wusste sie ganz genau, dass es der kleinen Loransya nicht gut ging. Natürlich konnte die gebrochene Frau nicht ahnen, wie schlimm es ihrer Tochter seither wirklich ergangen war. Trotzdem hatte sie ihren Plan, Loransya nach Hause zu holen, noch nicht aus den Augen verloren. Dieser Entschluss forderte Opfer von ihr, das war ihr spätestens seit dem gestrigen Familienrat klar. Weder Loransyas Vater noch ihr älterer Bruder Jean waren bereit dazu, ihre eigenen Nahrungsmittel einzuschränken oder im schlimmsten Fall sogar einen Hungertod zu sterben, nur um die jüngste Tochter vor den Gefahren der Hauptstadt, wie Marina Courtons die stetig an ihr nagende Angst um Loransya vorsichtig bezeichnete, zu retten.
Wenn du nicht hören willst, wird dir die Tür zu meinem Haus auf ewig verschlossen bleiben!
Die erpresserische Drohung ihres Mannes hatte Marina Courtons die letzten Tage schon viel zu oft gehört, als dass sie darauf noch einen Deut geben würde. Der Einzige, von dem sie sich in dieser ausweglosen Situation Rückhalt und vielleicht sogar Hilfe versprechen konnte, war Loransyas Bruder Gerárd. Auch ihm ging das ungeklärte Schicksal seiner kleinen Schwester an die Nieren, und er konnte die Mutter nur zu gut in ihrem Vorhaben das Mädchen zurückzuholen verstehen. Obwohl sie schon einige Gourdes zur Seite gelegt hatte, so reichte das Geld bei weitem noch nicht für eine Hin-und Rückfahrt in die Hauptstadt aus. Marina Courtons war auf die Hilfe ihres Mannes so dringend angewiesen. Sie wollte nicht aufgeben, auch wenn ihre Chancen schlecht standen und sie immer wieder auf Granit biss. Er war und blieb einfach davon überzeugt, dass seine Tochter in der Hauptstadt ein besseres Leben führte. Die mütterliche Intuition seiner Frau scherte ihn einen Teufel, aber Marina Courtons wusste ganz genau, dass auf ihre Gefühle schon immer Verlass war.
Sie warf einen letzten Blick in Richtung Küste, drückte die Puppe fest an sich und gab ihr einen liebevollen Kuss.
Ich vergesse dich nicht, mein Mädchen! Niemals!, flüsterte sie, steckte die Puppe weg und ging zurück zur Hütte.
***
Der Regen kam, aber der befürchtete Hurrikan blieb den Bewohnern Haitis an diesem Junitag wenigstens erspart. Der Niederschlag prasselte unbarmherzig auf das löchrige Dach der Wellblechhütte und sammelte sich in riesigen Pfützen mitten im Wohnraum. Die kraftraubende Aufgabe des Mädchens, mit der sie die meiste Zeit des Tages beschäftigt war, bestand darin das Wasser aus der Hütte zu schöpfen. Dass ihr eigener erbarmungswürdiger Verschlag ebenso wenig wasserdicht war, schien niemanden zu interessieren, genauso wenig wie sich jemand darum scherte, dass Loransya jede einzelne Nacht frierend im Nassen verbringen musste.
Viel schlimmer als der Regen und die andauernde Feuchtigkeit war jedoch der Umstand, dass sich Wilton bei seinem Sturz vom Dach mehrere Rippen und Wirbel gebrochen hatte und seine Frakturen mehrere Wochen liegend ausheilen mussten. Natürlich war kein geringerer als Loransya für die Pflege ihres schlimmsten Peinigers zuständig. Die anderen Familienmitglieder verbrachten den Tag schließlich in der Schule oder auf dem Markt. Die ersten Tage war Wilton von den Schmerzen noch ziemlich mitgenommen, sodass er beinahe den ganzen Tag schlief und erst am Abend wieder erwachte, als die restliche Familie schon wieder anwesend war. Doch mit der Zeit wurde sein Schlafbedürfnis weniger und Loransya spürte seine lüsternen Blick auf sich ruhen, wann immer sie das Wasser auf allen Vieren kniend aus der Hütte schöpfte.
La-pou-sa-a, raunte Wilton ihr eines Nachmittags zu.
Das Mädchen spürte wie die beschämende Erinnerung an die Vergewaltigung ihr Herz ergriff und überhörte die quälende Bemerkung. Stattdessen griff sie zu dem abgenutzten Holzbesen und kehrte laut pfeifend die Hütte.
Ich habe Durst!, forderte der Patient daraufhin lautstark.
Loransya ging in die Küche, goss ihm etwas Trinkwasser in einen roten Plastikbecher und reichte ihm das Getränk, ohne aber den Besen aus der Hand zu legen.
Sicher ist sicher, dachte sie sich, obwohl sie ihm rein körperlich in seiner angeschlagenen Lage deutlich überlegen sein musste.
Setz dich!
Wilton klopfte neben sich auf den Rand des Bettes, wo sich Loransya äußerst widerwillig niederließ, und den Besen fest umklammert.
Du musst mich waschen, befahl er und unterstrich sein Verlangen mit einem obszönen Griff in den Schritt.
Ich werde dir später Wasser bringen!, gab Loransya zurück, stand auf und kehrte äußerlich unbeeindruckt an ihre Arbeit zurück.
Aber Wilton war ein autoritärer Mensch mit stark ausgeprägter diktatorischer Neigung, der es absolut nicht dulden konnte, wenn es jemand wagte, sich ihm zu widersetzen. Schon gar kein kleines, nichtsnutziges Réstavek!
Wutschäumend setzte er sich im Bett auf und verfluchte, dass seine Brüche ihn daran hinderten, sich wie gewohnt das zu nehmen, was er wollte.
Du wirst mich waschen! Sofort!, brüllte er ihr hasserfüllt nach, doch Loransya stand bereits an der Tür zum Gehen bereit.
Ich gehe jetzt zum Markt und werde dir später Wasser bringen!, stammelte sie noch einmal und beeilte sich, die Hütte schnell zu verlassen. Draußen sog sie erleichtert die feuchtwarme Luft in die Lungen ein, die der Regenschauer hinterlassen hatte.
Bepackt mit Süßkartoffeln, Reis und Bohnen beeilte sich Loransya schnell wieder zurückzukehren, ehe Raoul und Sealon mit den anderen Kindern, Bill und Teanne, nach Hause kamen. Viel Zeit für die Zubereitung des Abendessens blieb ihr jetzt nicht mehr! Die tiefstehende Sonne, die langsam blutrot hinter dem Horizont verschwand, verriet Loransya, dass sich der Tag langsam dem Ende neigte.
Statt abendlicher Harmonie allerdings erwartete sie Raoul und Sealon.
Du willst meinen Sohn nicht waschen?
Der Vater warf ihr einen verachtenden Blick zu, und Loransya wusste sofort, was geschehen war. Wilton inszenierte gerade den armen Patienten, der von ihr schlecht gepflegt wurde und sein Vater glaubte ihm.
Sie senkte ihren Blick zu Boden und schwieg.
Wieder stellte Raoul die gleiche Frage, diesmal allerdings in einem noch schärferen Ton. Er war von dem einzigen weißen Plastikstuhl, der zum Mobiliar der Hütte gehörte, aufgestanden und klopfte nun drohend mit einem dicken Bambusstab in der rechten Hand auf den Boden. Bereits seinen durchdringenden, bohrenden Blick empfand Loransya als unangenehm quälend.
Doch, beeilte sie sich zu sagen und schob noch ganz leise und kaum hörbar hinterher: Aber er tut mir doch so weh!
Mit einem Satz sprang Raoul auf sie zu. Seine Lippen zitterten vor Erregung und die weit aufgerissenen Augen ließen seinen Ärger erahnen. Eingeschüchtert trat Loransya einen Schritt zurück.
Du gehörst uns, wir haben für dich jede Menge Geld ausgegeben!
Schon jetzt bereute Loransya bitter was sie gesagt hatte und sank zitternd auf dem Boden nieder. Der Patient Wilton lag derweil selbstgefällig im Bett und genoss es sichtlich, den Vater von seiner Darstellung überzeugt zu haben und ihn auf seiner Seite zu wissen.
Du wirst ihn jetzt waschen!
Das kleine Mädchen erhob sich angstbebend und war gerade im Begriff Wasser zu holen, als Raoul sie hart an der Schulter packte und zurückriss.
Du brauchst kein Wasser! Jetzt wirst du deine Spucke dafür verwenden!
Sie verstand nicht, was er meinte und blieb verängstigt stehen. Doch da prasselten schon die ersten Schläge auf ihren Rücken. Eingeschüchtert trat sie an Wiltons Bett und setzte sich auf den Bettrand. Sie wollte weglaufen, aber der Weg nach draußen war versperrt. Sie schloss einen kurzen Augenblick die Augen und dachte an ihre Mutter.
Mach schon, du sollst mich sauber waschen!, hörte sie da Wilton fauchen und als sie die Augen wieder öffnete, hatte er bereits sein erigiertes Glied freigelegt. Das Mädchen schluckte und empfand einen derartigen Ekel, dass sie seinem Befehl nicht gehorchen konnte. Nie im Leben wollte sie seinen Penis in den Mund nehmen, lieber würde sie sich grün und blau schlagen lassen oder noch besser ihren Tod in Kauf nehmen, den sie manchmal so bitterlich herbeisehnte.
Plötzlich legte sich etwas von hinten um ihren Hals und es dauerte eine Weile, ehe sie begriff, dass Raoul ihr einen kalten Ledergürtel um die Kehle gelegt hatte.
Du bist nichts wert!, zischte das Familienoberhaupt dem Mädchen ins Ohr. Du bist unser Besitz!
Zitternd nickte Loransya. Ihr Mund war ganz trocken.
Raoul zog den Gürtel um ihre Kehle fester. Das kleine Mädchen überfiel eine derartige Todesangst, gleich ersticken zu müssen, dass sie sich widerwillig beugte und tat, was von ihr verlangt wurde. Der Ekel ließ sie aufwürgen.
Es reicht!, damit zog sie das Familienoberhaupt am Gürtel zurück. Der kranke Wilton teilte die Meinung seines Vaters ganz und gar nicht, deckte aber dennoch sein unbefriedigtes Geschlechtsteil wieder zu.
Zitternd stand das kleine Mädchen vor Raoul. Der Gesichtsausdruck des Mannes zeigte nicht die geringste Spur von Mitleid, eher spiegelte er wider, dass ihm daran gelegen war, Loransya die Besitzverhältnisse deutlich vor Augen zu führen und das Mädchen zu erniedrigen.
Knie dich auf den Boden! Du sollst wissen, wessen Eigentum du bist!
Die Schläge prasselten auf den Rücken des kleinen Mädchens nur so nieder. Hart und unbarmherzig knallte der Lederriemen einer Peitsche wieder und wieder auf den Rücken des Réstaveks. Loransya konzentrierte sich auf das warme Blut, das an ihr hinunter lief, und blendete die Schmerzen aus. Sie spürte sich nicht mehr, was ihr ein wenig Angst bereitete - ihren Körper gar nicht und ihre Seele auch fast nicht mehr. Nach einer Weile hielt Raoul inne und nahm den Gürtel von ihrem Hals ab.
Das sollte genügen, raunte er mit einem gönnerischen Unterton, du hast verstanden, was du bist?
Das Mädchen beeilte sich zu nicken.
Unser Besitz! Er lachte hämisch auf und deutete auf die Blutlache, in der das kleine Mädchen kniete. Aufputzen! Danach wirst du dich daran machen, unser Essen zuzubereiten!
Die Stille der Nacht wurde nur ab und zu durch den auffrischenden Wind durchbrochen, der um die wenigen Habseeligkeiten der Bewohner des Armenviertels pfiff. Loransya saß auf dem Boden ihres Verschlags und blickte hinaus in die dunkle, düstere Nacht. An Schlaf war nicht zu denken. Die blutigen, frischen Wunden auf ihrem Rücken schmerzten viel zu sehr, als dass sie sich auf den harten Pappkarton hätte legen können und ihre Seele wurde von der unendlichen Sehnsucht nach ihrer Mutter gequält. Endlich war sie allein und konnte ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Die Nase fest an die Puppe gedrückt, schluchzte Loransya hemmungslos. Sie konnte einfach nicht verstehen, warum sich ihr Leben von einem auf den anderen Tag so drastisch hatte verändern können. Eben war sie noch das arme, aber glückliche Bauernkind gewesen, das trotz einem gelegentlichen Nahrungsmittelengpass eine schöne Kindheit erleben und die Geborgenheit im Schosse der Familie genießen durfte. Jetzt war sie ganz allein auf sich gestellt in dieser fürchterlichen Großstadt und musste erkennen, dass ihr Leben hier in Port-au-Prince offenbar keinerlei Wert hatte und als nutzlos abgestempelt war. Schläge, Vergewaltigungen, Demütigungen und harte Arbeit waren Begriffe, die das kleine Mädchen in dem geschützten Bergdorf nicht kannte. Obwohl Loransya genau wusste, dass es ein fürchterliches Unrecht war, das ihr hier widerfuhr, so gewöhnte sie sich doch überraschend schnell daran, so menschenunwürdig wie ein Stück Vieh gehalten zu werden und all ihrer Rechte entledigt worden zu sein. Wäre die Welt des Mädchens nicht so klein, so würde sie Gefallen daran finden, abzuhauen und sich weit weg von der Familie Filles alleine durch das Leben zu schlagen, um vielleicht sogar irgendwann wieder nach Hause fahren zu können. Ohne Geld war es allerdings ein Ding der Unmöglichkeit zurück nach Virol zu kommen. Da dachte Loransya an den Blick ihres Vaters, als Tante Lucia gekommen war, um sie mitzunehmen. Obwohl er einen kurzen Augenblick ein bisschen traurig gewirkt hatte, so ließ sein entschiedener Gesichtsausdruck keinerlei Zweifel daran, dass er zu seiner Meinung stand und seine einzige Tochter nicht mehr bei sich in Virol wissen wollte. Die einzige Alternative, die es also für das kleine Mädchen zu den Misshandlungen der Filles gab, wäre also ein Leben auf der Straße. Aber konnte sie sich wirklich vorstellen so wie Bernard zu leben und noch nicht einmal den Hauch einer Chance zu haben, jemals eine Schule besuchen zu werden? Einen winzigen Keim der Hoffnung trug sie noch in sich, dass ihr die Filles eines Tages doch erlauben würden, die Schule zu besuchen, wenn sie nur ihre Arbeit gut genug erledigte.
Ach Mama, ich hab dich so lieb!, seufzte Loransya unwillkürlich, nahm die Puppe fest in den Arm und fiel auf der Seite gerollt in einen unruhigen Schlaf.
*****
Die Geschäfte liefen heute Vormittag gut und Marina Courtons war bestens gelaunt, als sie heimlich einige Gourdes von dem Verkaufserlös abzwackte und in ihrem Büstenhalter verschwinden ließ. Wenn sich die Mangos weiterhin so gut verkauften wie an diesem schwülwarmen Junitag, dürfte es nur noch ein paar Wochen dauern, ehe sie das Geld für eine einfache Fahrt in die Hauptstadt zusammen hatte. Realistisch gesehen war ihr aber durchaus klar, dass sie ein Vielfaches mehr an Geld benötigte, um ihre Tochter wieder zu bekommen.
Plötzlich entdeckte Marina in der Unmenge von Menschen, die sich heute wie Ameisen über den Marktplatz drängten, eine alte Freundin aus Kindertagen.
Fabienne, Fabienne!, rief sie begeistert winkend.
Wie lange es her war, als sie Fabienne das letzte Mal gesehen hatte, konnte sie nicht mehr sagen, aber auf alle Fälle war Jean, ihr Ältester, gerade erst geboren worden. In ihrer eigenen, lange zurückliegenden Kindheit waren Marina und Fabienne nicht nur Nachbarinnen gewesen, sondern vor allem allerbeste Freundinnen. Leider wurde der Kontakt immer weniger, als Fabienne mit gerade mal 17 Jahren heiratete und dem Dorf den Rücken kehrte. Einige Jahre später hatten sich die beiden Frauen dann vollkommen aus den Augen verloren.
Marina! Auch Fabienne erkannte in Marina auf den ersten Blick
ihre alte Freundin wieder. Eine Weile lagen sie sich glücklich in den Armen, ehe Marina Fabienne etwas von sich wegschob, um sie besser betrachten zu können. Fabienne sah für ihr Alter wirklich noch sehr frisch und jung geblieben aus, aber was Marina sofort ins Auge stach, war die ungewöhnlich schicke, hochwertige Garderobe, die ihre Freundin am Leib trug.
Du hast wohl gut geheiratet!
Aber nein!
Fabienne lachte bitter auf und schüttelte dann den Kopf entschieden.
Wo denkst du hin? Mein Mann ist vor beinahe drei Jahren gestorben. Da bot mir das Leben leider nicht allzu viele Alternativen.
Marina biss sich auf die Lippen für diesen unbedachten Kommentar und verfluchte innerlich ihre schlechte Eigenschaft in jedes Fettnäpfchen zu treten, das sich ihr nur bot.
Entschuldige, das war dumm von mir!, schob sie versöhnlich hinterher.
Wäre ja auch nahe liegend!, wehrte die alte Freundin schnell ab. Ich hatte nur zwei Alternativen entweder ich verhungere elend oder ich mache mich auf die Suche nach Arbeit!
Gespannt lauschte Marina der Erzählung. In dieser gottverlassenen Gegend Haitis war es noch um ein Vielfaches schwieriger eine halbwegs einträgliche Arbeit zu finden als in der Hauptstadt und selbst dort waren beinahe Dreiviertel der Menschen arbeitslos. Hier auf dem Land war es üblich, dass die Bauern ihre kleinen Felder selbst bestückten und die wenige Ernte, die nach dem Eigenverzehr noch übrig blieb, für ein paar Gourdes auf dem Markt zum Verkauf anboten.
Wo arbeitest du?, wollte Marina neugierig wissen.
Doch Fabienne wollte erst nicht so recht damit herausrücken und zuckte nur mit den Schultern.
Bitte!, hakte Marina nach, Ich muss das wissen!
Etwas leiser schob sie noch die Erklärung nach, dass sie ihre Tochter als Réstavek nach Port-au-Prince schicken mussten und sie selbst vor lauter Kummer zerbrach, wenn sich in nächster Zeit keine Lösung finden ließ, um sie wieder nach Hause zu holen.
Also gut! Aber das bleibt unter uns, gab Fabienne schließlich nach und senkte ihre Stimme. Du hast sicherlich schon von dem All-Inclusive-Club für Touristen gehört, der ziemlich neu im Dorf ist. Du weißt schon, die Neureichen aus Amerika und Europa!
Fragend zuckte Marina mit den Schultern. Obwohl sie sich ziemlich viel mit den anderen Marktfrauen unterhielt, wusste sie dennoch nicht, wovon Fabienne eigentlich genau sprach genauso wenig, wie sich die Mangobäuerin niemals zuvor mit Tourismus beschäftigt hatte.
Ist auch egal!, fuhr Fabienne tuschelnd fort, Auf jeden Fall gibt es ein Hotel mit vielen Urlaubern und vor dem Hotel eine Bar, in die die Touris massenhaft strömen!
Gespannt lauschte Marina Fabiennes Erzählung.
In dieser Bar arbeite ich.
Fabienne macht eine kurze Pause.
Als Nackttänzerin und mehr, wenn du verstehst, was ich meine!
Natürlich verstand Marina sofort, was Fabienne meinte. Prostitution war in Haiti nichts Außergewöhnliches. Im Gegenteil die Straßen der Hauptstadt waren voll mit den unterschiedlichsten schlüpfrigen Angeboten. Aber in der abgelegenen Region der Sierra de Bahorucou hätte Marina Courtons niemals damit gerechnet, dass es Prostitution hier überhaupt gab geschweige denn einen Markt dafür.
Jetzt bist du wohl entsetzt, mein kleiner Moralapostel, neckte Fabienne die alte Freundin und zwinkerte ihr schelmisch zu.
Ganz von der Hand zu weisen, war dieser kleine Einwurf nicht. Marina Courtons war eine Frau, die in der Vergangenheit eine genau definierte Vorstellungen von Moral und Werten pflegte, nach deren Vorgaben sie sich bemühte zu leben.
Allerdings hatte sie damit gebrochen, spätestens in dem Augenblick, als ihr Mann in seiner Funktion als Familienoberhaupt beschloss, Loransya wegzugeben und sie machtlos zusehen musste.
Das war mal! Wie viel verdienst du damit?
Fabienne verstand die Welt nicht mehr. Hätte sie Marina noch vor einigen Jahren in ein derart intimes Geheimnis eingeweiht, wäre sie aus allen Wolken gefallen. Jetzt aber bewertete sie die Arbeit noch nicht einmal nach moralischen Gesichtspunkten, nein, sie erkundigte sich ganz einfach nach dem Verdienst!
Du bist sehr verzweifelt, stimmts? Fabienne legte den Arm verständnisvoll um die Schulter ihrer alten Freundin.
Schweigend nickte Marina und ließ ihren Blick über das bunte Treiben um sich herum schweifen. Noch kämpfte sie erfolgreich gegen die Tränen, da aber floss schon die erste ihre Wange hinunter.
***
Bereits vor Sonnenaufgang hatte sich Loransya auf den Weg zum Brunnen gemacht, um Wasser für die Familie zu holen. Anschließend hatte sie für ihre Herren Maisbrei zubereitet und während des Frühstücks damit begonnen, den Fußboden der Hütte sauber zu fegen.
Du bringst Teanne heute zur Schule!, unterbrach sie Sealon in ihrer Tätigkeit und ahnte dabei vermutlich gar nicht, welche Freude sie dem Mädchen mit diesem Befehl bereitete. Endlich konnte Loransya eine Schule sehen, wenn es auch nur das Gebäude von außen zu bewundern galt, aber immerhin!
Anschließend gehst du zum Fluss Wäsche waschen, allerdings musst du vorher noch etwas Kernseife am Markt besorgen! Hier hast du ein paar Gourdes!
Missgelaunt warf Sealon einige Münzen vor Loransya auf den Boden und wandte sich dann wieder ihrem Frühstück zu. Das Mädchen legte Bürste und Eimer beiseite, sammelte die Groschen auf und machte sich daran, die Wäsche zusammenzupacken.
Wenig später war auch Teanne endlich bereit dazu, sich auf den Weg zu machen.
Nimm meine Tasche!, fauchte die jüngste Tochter Loransya an, kaum dass sie sich auf dem staubigen Weg vor der Hütte befanden. Obwohl sie schon die allergrößte Mühe damit hatte, überhaupt den schweren Wäschesack zu schultern, griff sie widerspruchslos nach der abgenutzten Ledertasche, die ihre Teanne ganz selbstverständlich reichte. Spätestens seit dem gestrigen Tag war ihr bewusst, welche Strafe ihr drohte, sollte sie es wagen, sich dem Befehl eines der Kinder zu widersetzen. Schweigend liefen die Mädchen nebeneinander her. Obwohl es das erste Mal war, dass Loransya mit der etwas jüngeren Teanne alleine war, so wollte es doch kaum gelingen, mit dem Mädchen ins Gespräch zu kommen.
Da vorne ist es!, raunte Teanne ihr nach einem etwa zehnminütigen Fußmarsch zu und deutete auf ein etwas heruntergekommenes Gebäude. Die zweistöckige Schule lag unmittelbar an einer Hauptverkehrsstraße und erinnerte durch einen an der Grundstücksgrenze verlaufenden Stacheldrahtzaun ein wenig an das örtliche Gefängnis. Durch das schmiedeeiserne Tor, über dem ein dunkelblaues Schild mit der weißen Aufschrift School of Haiti angebracht war, strömten jetzt aus allen erdenklichen Himmelsrichtungen der Stadt die Schüler herbei. Allesamt trugen eine Schuluniform, die Mädchen einen dunkelblauen Rock und eine weiße Bluse dazu, die Jungen eine Hose und ein Hemd, ebenfalls in den Schulfarben blau und weiß gehalten. Der Kragen war geziert mit demselben Emblem oberhalb, das sich auch dem Tor wieder fand, und versehen mit dem geschwungenen Namenszug der Schule. Die meisten der Kinder wirkten auf Loransya schlecht gelaunt und ziemlich grimmig, was sie absolut nicht verstehen konnte. Was würde sie nur darum geben, auch nur einen einzigen Tag in der Schule verbringen zu dürfen!
Okay, ich muss rein!, verabschiedete sich Teanne und nahm Loransya die Tasche ab, Du gehst zurück und wirst mich um vier wieder abholen!
Loransya nickte nur. Eine Weile blickte sie ihr noch gedankenverloren hinterher, dann aber beschloss sie, sich auf einem kleinen Mäuerchen gegenüber der Schule niederzulassen und dem bunten Treiben einfach nur zuzusehen. Wenn sie schon nicht den Unterricht besuchen durfte, so hatte sie hier etwas abseits wenigstens ein klein bisschen das Gefühl, dazu zu gehören. Die Fenster des Schulgebäudes waren mit selbst bemalten Buchstaben und Zahlen geschmückt. Loransyas sehnsüchtiger Blick blieb eine ganze Weile daran hängen. Dieser Anblick drückte in den Augen des Mädchens all die Freude und den Spaß aus, den die Schüler wohl am Lernen empfinden mussten. Waren aus dem Schulhaus bis jetzt muntere Gespräche und das helle Lachen der Kinder geklungen, so beendete ein dumpfer Gongschlag sämtliche Unterhaltungen und es wurde sehr ruhig um das Gebäude. Zwischenzeitlich kamen auch keine Kinder mehr. Nur eine alte Nonne erschien auf der Bildfläche, die mit einem riesigen Schlüsselbund das Tor schwerfällig von innen verschloss. Seufzend riss sich Loransya los und packte ihren Sack Wäsche, um zurück über die holprige Sandstraße zu schlendern. Beim nächst besten Straßenhändler, der ihr über den Weg lief, kaufte sie ein kleines Stück Kernseife und war wenig später am Flussufer angelangt. An diesem frühen Vormittag waren nur zwei Mütter mit ihren Kindern hier, die munter plaudernd ihre Wäsche reinigten. Obwohl Loransya natürlich im Hinterkopf hatte, die alte Frau zu besuchen, so wollte sie dieses Mal doch vorher ihre Arbeit erledigt wissen. Schnell machte sie sich an das Werk und schrubbte so lange über die Kleidungsstücke, bis ihre Knöchel feuerrot waren, aber die Wäsche dafür in sauberer Reinheit erstrahlte. Natürlich hing sie während der harten Arbeit ihren Gedanken nach. Der Wunsch Lesen und Schreiben zu lernen ließ sie nicht mehr los, auch wenn sie wusste, dass ihr weder Sealon noch Raoul jemals erlauben würden, eine Schule zu besuchen. Bisher hatte ihr allerdings auch der Mut gefehlt, sie danach zu fragen. Aber Loransya war trotz all ihrer Träume Realistin genug, um zu wissen, dass sie sich diese Frage getrost sparen zu konnte.
Du bist nichts wert!, schoss es ihr durch den Kopf.
Wie oft hatte sie diesen demütigenden, abwertenden Satz in den letzten Tagen gehört? Auf jeden Fall oft genug, um beinahe schon selbst daran zu glauben. Seufzend steckte das Mädchen das letzte Hemd in ihren Wäschebeutel, packte die Kernseife in das Stückchen Papier zurück und ging zögerlich auf das Haus der alten Frau zu. In ihr nagte der Zweifel, womöglich gar nicht willkommen zu sein, und so klopfte sie etwas schüchtern an die Holztüre und lauschte den knarrenden Schritten, die sich wenig später näherten. Die alte Frau schien über den unerwarteten Besuch kein bisschen verblüfft zu sein.