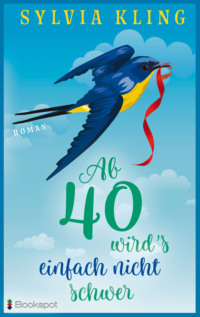Kitabı oku: «Ab 40 wird's einfach nicht schwer», sayfa 4
5. Kapitel
Seltsame Überraschungen
»Ja, wie dir sicher nicht entgangen ist, tu ich das oft;
mich mit Essen trösten.«
Martha
Chef senior hatte Urlaub. Dafür hampelte der Junior wie ein Aufziehmännchen durch das Büro. Ganz so junior sah er zudem nicht mehr aus, wie er vorzugeben versuchte. Die Überproduktion seiner Schweißdrüsen war offenbar ein Gendefekt. Als Silke direkt vor ihm stand und er sie fragte, ob sie den Beschluss des Amtsgerichts zur letzten Klage der Schüsslers für den Versand bereit hätte, stieg ihr ein beißender Geruch in die Nase. Vor ihrem inneren Auge erschien das fatale Versäumnis des vergangenen Sommers, als sie vergessen hatte, einen Rest Gulasch zu entsorgen, bevor sie für zwei Wochen in den Urlaub gefahren war. Bei der Rückkehr war der Gestank in ihrer Küche betäubend gewesen. Und genau solche Partikel wehten ihr nun vom Juniorchef entgegen. Vielleicht erhöhte der Ärger über die Familie Schüssler seine Schweißproduktion. Diese Familie hatte es sich zum Hobby gemacht, vor Gericht zu klagen – und sei es um die abgebrochene Nase eines Gartenzwergs. Der Gedanke: Bei jedem Atemzug, den ich mache, stirbt ein Mensch, traf hier wohl zu. Ob die Stuten-Martha ihn noch küsste? Silke schüttelte sich.
»Ist Ihnen kalt?«, fragte der Junior, fast schon besorgt, und wieder erreichte sie der Müllkippenwind. Indes kam die liebe Martha hereingeeilt. Sie rauschte an ihrem Angetrauten vorbei und beachtete ihn nicht im Geringsten.
»Martha, schön, dass du da bist«, hörte sie in tadelndem Ton den ehemaligen Heißsporn rufen. Nun war sie gespannt.
»Könntest du so nett sein und mir einen Kaffee bringen?«
Gerade wollte sie schnurstracks in Richtung ihres Arbeitsplatzes gehen, da drehte sich Martha abrupt um.
»Natürlich, gern!«
Das sprach sie in dem Tonfall von »Du Arsch!« aus. Ihre Augen funkelten. Als sie an Silke vorbei auf die Küche zusteuerte, hörte sie Martha wütend zischen:
»Zu Hause fragst du nicht so freundlich!«
Aha, da lag der Hase im Pfeffer. Zu gern wollte Silke wissen, wer oder was noch im Pfeffer lag. Sie wartete eine Minute, um dann aufzustehen und gemächlichen Schrittes die Küche aufzusuchen, die sich nur zwei Meter von ihrem Arbeitsplatz entfernt befand. Martha hatte da etwas im Blick, was sie stutzig machte. Das war nicht nur ein kleiner Ehestreit, nicht nur eine kleine Wut. Da war mehr. Oder alles? Unauffällig ging sie auf die Küche zu und lehnte sich an den Türrahmen. Marthas aggressive Stimmung war im Raum beinahe greifbar. Sie faltete hektisch den Kaffeefilter, der Silke beinahe leidtat, und schüttete einen Großteil Wasser nicht in den dafür vorgesehenen Behälter, sondern daneben, fluchte, wischte das vergossene Wasser mit fahrigen Bewegungen weg und – weinte.
»Langsam, warte, ich helfe dir«, sagte Silke leise. Martha drehte sich erschrocken um. Sie war so mit ihrer Wut beschäftigt gewesen, dass sie Silke nicht bemerkt hatte.
»Geht schon!« Martha schniefte.
»Nein, es geht eben nicht. Ich mache den Kaffee für deinen Mann.«
Silke nahm einen Stuhl vom Küchentisch, stellte ihn verkehrt herum in die Küche und schloss die Tür.
»Komm. Setz dich bitte. Mach mal eine Pause und atme tief durch. Das hilft manchmal.«
Martha blinzelte sie erstaunt, aber dankbar an. Zwischen ihren Wimpern glitzerten Tränen. Betont ruhig setzte Silke die Kaffeemaschine in Gang. Dann holte sie zwei ihrer Lieblingsjoghurts aus dem Kühlschrank und reichte Martha einen davon, setzte sich neben sie und gab ihr einen Löffel. Martha lächelte. Ein gutes Zeichen!
»Manchmal muss man einfach etwas essen, oder?« Silke legte der verzweifelten Frau kurz die Hand auf die Schulter.
»Ja, wie dir sicher nicht entgangen ist, tu ich das oft; mich mit Essen trösten.«
Silke dachte: Du wolltest Müllkippen-Junior doch unbedingt haben …, aber sie verkniff es sich, etwas zu sagen. Martha tat ihr leid. Und dann, als hätte die Frau Silkes Gedanken gehört, sprudelte es aus ihr heraus:
»Ich wollte den Sohn vom Stinkerwilli ja unbedingt haben. In den Arsch beißen könnte ich mich dafür, der ja jetzt genug Platz für die Bisse einer ganzen Nation hat!«
Sie lachte ein verzweifeltes Lachen, um gleich danach wieder in Tränen auszubrechen.
»Unser Sohn leidet auch unter ihm.«
Ach stimmt, da war ja noch so ein kleiner Kugelblitz. Silke war immer der Meinung gewesen, hässliche Kinder gäbe es nicht, ebenso wie keine hässlichen Erwachsenen. Es gab Menschen, die besonders aussahen, ungewöhnlich. Hässlich wurden sie nur durch ihre Art, ihren Charakter, ihr Auftreten. So auch diese kleine Hüpfburg. Silke hatte ihn ein einziges Mal erlebt und sich nichts sehnlicher gewünscht, als dieses Kind nie wiedersehen zu müssen. Er schrie nicht; nein, er krähte, rannte durch das Büro, zog alle Schubläden auf, krachte sie wieder zu, riss nacheinander alle Türen auf, knallte sie zu und kreischte dabei ununterbrochen wie ein Zalando-Model. Und die Eltern? Martha war dem Kind hilflos hinterhergerannt und hatte einen puterroten Kopf bekommen. Der Junge machte unbeeindruckt weiter. Er habe ADHS, so lautete die kleinlaute Erklärung der Ex-Büro-Pink-Schönheit. Silke sah Martha nachdenklich an.
»Worunter leidet der Junge bei deinem Mann, Martha? Magst du darüber reden?«
Diese schluchzte immer noch.
»Ich weiß nicht, ob das gut ist, mit dir darüber zu sprechen. Immerhin ist er dein Chef«, gab sie zu bedenken.
»Martha, kennst du mich inzwischen ein bisschen?«
Sie nickte und es flossen neue Tränen.
»Am Anfang war er nett, ungefähr das erste Jahr. Dann ging er in den Puff und sah sich heimlich Pornos an. Okay, dachte ich, damit müssen andere Frauen auch leben.«
Mussten sie das? Silke zweifelte daran. Vielleicht gab es doch noch Männer, die sich mit einer Frau zufriedengaben? Egal, sie wollte alles wissen. Es wurde gerade richtig interessant.
»Dann aber«, Martha stockte kurz, »… begann er, immer mehr von mir zu verlangen. Nicht nur im Bett, auch im Haushalt. Er macht inzwischen gar nichts mehr. Ich rotiere, vor allem, seit unser Sohn geboren ist. Der Herr geht nur noch shoppen oder herumhuren. Er beleidigt mich zu Hause, jagt mich durch die Gegend, erteilt Befehle. Er ist ein Arsch, der größte, den ich kenne.«
Pause.
»Außer meinen.«
Silke wollte nicht lachen, nein, auf keinen Fall! Nicht lachen! Aber als Martha sie durch ihre tränenverschleierten Augen verschmitzt ansah und sie regelrecht aufforderte, genau das zu tun, gab es keinen Halt mehr. Martha stimmte in das befreiende, herzhafte Lachen mit ein. Sie hielt sich dabei an Silkes Arm fest, eine ungewöhnliche Situation. Ihr Lachen schallte durch das Büro, und es kam, wie es kommen musste. Die Tür wurde aufgerissen und der gewichtige Kotzbrocken stand im Rahmen mit weit aufgerissenen Augen – sie erinnerten Silke an den Träumer Hans. Beinahe hätte sie noch weiter und viel lauter gelacht, wenn nicht der erstarrten Martha der Schrecken im Gesicht gestanden hätte.
»Was gibt es hier zu lachen? Haben die Damen keine Arbeit?«, fauchte er die beiden an, sah aber dabei zu Martha.
»Ach, wissen Sie, haben Sie schon mal etwas von einer guten Arbeitsatmosphäre gehört? Sie soll die Leistungsfähigkeit steigern. Ihr Herr Vater hat Sie doch sicher adäquat in die Leitungsebene eingearbeitet?«
Ruhe. Silke saß entspannt und ruhig auf ihrem Stuhl und tastete mit der linken Hand nach Marthas, fand sie und streichelte sie kurz.
»Aha. Na dann, an die Arbeit, nicht wahr? Da kommt ja jetzt Konstruktives!«
Er klatschte in die Hände und zeigte ins Büro. Inzwischen hatte sich Martha die Tränen abgewischt und lief rotwangig an ihren Arbeitsplatz zurück. Zwei Stunden später machte sie Feierabend, um den Sohn aus der Kindertagesstätte abzuholen. Beim Verlassen des Büros reichte sie Silke einen Zettel, auf dem stand:
Ich weiß nicht, wie ich das verdient habe, dass du so nett zu mir bist. Du hast mir den Tag gerettet, auch den meines Sohnes. Denn heute werde ich nur noch lachen. Ich sage einfach nur DANKE.
6. Kapitel
Schröders Geschichten
»Wer nie gegen tobenden Sturm läuft,
wird auch von der Windstille nichts erfahren.«
Lydia Schröder
Schröders zu besuchen bedeutete immer etwas Besonderes. Als Silke aus dem Haus trat, fiel ihr im düsteren Licht der Straßenbeleuchtung auf, dass der Sommer sich langsam zu verabschieden begann. Drei Monate flossen dahin, ohne eine Änderung in ihrem Leben, sei es zum Guten oder Schlechten. Silke fühlte die Magie, wenn die Bäume mit jedem Tag etwas mehr ihre nackte Haut preisgaben und sich die Luft nach und nach immer frischer anfühlte. Sie atmete tief ein und klingelte beim Nachbarhaus. Frau Schröder öffnete und trocknete ihre Hände an der umgebundenen Schürze ab. Die Frauen von damals trugen noch Schürzen. Silke fand das beruhigend; es erinnerte sie an ihre Großmutter väterlicherseits. Das Gesicht, ihre weiche, blasse Haut mit den tiefen Falten und den lebendigen, dunkelgrauen Augen, erschien vor ihrem inneren Auge. Es war die Zeit, da anständige Ehefrauen Schürzen getragen, Wäsche gebleicht und gern gekocht hatten. Auf ein besonderes Essen hatte man sich noch gefreut, denn es war nicht selbstverständlich gewesen. Frau Schröder ähnelte Silkes Großmutter. Nur ihre Augen waren anders besonders. Die jadegrüne Farbe von Frau Schröders Augen war Silke gleich aufgefallen, als sie die Nachbarin Jahre zuvor kennen gelernt hatte. Etwas Mystisches strahlte aus ihnen. Wahrscheinlich waren deshalb im Mittelalter Menschen mit grünen Augen oft als Hexen oder Hexer bezichtigt worden. Frau Schröder unterbrach Silkes Gedanken:
»Hereinspaziert, hereinspaziert, Sie werden sehnsüchtig erwartet, meine Liebe!«
Sie zwinkerte und die Mystik war verschwunden. Eine moderne Dame, die ihre alte Zeit nicht vergessen hatte und trotzdem mit der neuen ging.
»Mein Mann ist immer ganz aufgeregt, wenn Sie uns besuchen«, flüsterte sie Silke zu und führte sie ins Wohnzimmer, in dem sich nie etwas veränderte – außer den Blumensträußen.
»Da kommt sie ja, die schöne Silke!«, rief Herr Schröder begeistert aus und führte sie zu »ihrem« Stuhl, wo sie immer saß, wenn sie zu Besuch kam, dort, wo sie sich auch wie zu Hause fühlte, wo sie »andocken« konnte. Frau Schröder verschwand in der Küche und kehrte mit einer dampfenden Schüssel zurück.
»Ich wollte Ihnen doch schon immer mal eine original Omas schlesische Leberkloss-Suppe kochen und hoffe, Sie haben ein wenig Appetit mitgebracht.«
Silke staunte und roch an der Suppe.
»Lecker!«
Tatsächlich hatte sie Hunger. Wenn sie allein war, vergaß sie oft zu essen. Es machte keinen Spaß, sich an den Tisch zu setzen und vor sich hin zu starren. Als die Teller auf dem Tisch standen und sie zu essen begannen, schlürfte Silke genüsslich die köstliche Suppe und wollte gar nicht mehr aufhören.
»Das ist ja eine süffige Hitparade der Aromen«, schwärmte sie und nahm sich einen zweiten Teller.
»Wie war Ihr Tag heute?«, fragte Frau Schröder.
»Ganz gut.«
Sie erzählte von Martha, die sie nie gemocht hatte, die ihr heute aber leidgetan und der sie den Tag hatte retten können. Frau Schröder lachte, als sie zu Marthas Selbstironie gelangte.
»Vielleicht ist sie gar nicht so schlecht, wie Sie immer dachten. Manche Menschen sind nur geprägt von ihrem Leben, setzen die falschen Prioritäten«, meinte Frau Schröder. Ihr Mann funkelte sie an.
»Gerade du, du sagst so etwas? Wo du mir immer predigst, es gibt kein Richtig oder Falsch? Wer bestimmt denn – so deine Worte –, was richtig oder falsch und was verrückt ist? Wer setzt denn die Normen, hm?«
Silke lachte.
»Frau Schröder, Sie sind ja eine richtige Psychologin! Das hätte ich nicht gedacht!«
Die alte Frau schenkte ihr einen Bordeaux nach, wollte bei ihrem Mann fortfahren, der aber mit der Hand das Glas abdeckte.
»Ja, genau. Das ist sie.«
»Siggi, weißt du, das muss nicht sein«, grummelte Frau Schröder. Jetzt erst begriff Silke.
»Was? Sie sind, Sie waren wirklich Psychologin?«
Ein Schulterzucken und Nicken der alten Dame folgten, als müsse sie sich dafür entschuldigen.
»Es kamen sehr spannende Menschen in meine Praxis. Menschen, die mit dem, was um uns geschah, nicht umgehen konnten, die sich nicht ›richtig‹, nicht gut platziert fühlten.«
Jetzt war Silke auch klar, warum sie sich immer so beobachtet gefühlt hatte und es ihr trotzdem nie unangenehm war.
»Das ist wirklich eine Überraschung für mich. Meine Freundin Birgit ist auch Psychotherapeutin, in einer Suchtklinik. Bei ihr habe ich oft das Gefühl, sie fragt mich bei jedem Problem in meinem Leben: ›Und wie fühlst du dich jetzt?‹ – Schrecklich.«
»Eine Berufskrankheit«, stimmte Frau Schröder zu und lachte laut. Fröhlich räumten die Frauen gemeinsam den Tisch ab.
»Wollen wir noch das Geschirr spülen?«, fragte Silke.
»Um Himmels willen! Ich habe einen Geschirrspüler, die Zeiten des Spülens sind längst vorbei!«
»Sie sind eben modern.«
Frau Schröder sah auf.
»›Man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit‹. So sagt man doch.«
Mit geübten Griffen räumte sie das von Silke gereichte Geschirr in die Spülmaschine und pfiff dabei. Warum konnte ihre Mutter nicht so liebenswert sein? Nein, sie hatte eine Furie »erwischt«. Als sie zum Tisch zurückkehrten, fragte Frau Schröder unvermittelt:
»Silke, da war doch vor einiger Zeit so ein seltsamer …, ich meine, außergewöhnlicher Mann bei Ihnen. Glauben Sie mir bitte, ich bin nicht neugierig. Siggi und ich haben uns für Sie gefreut. Aber er war nicht lange da und er kam auch nicht wieder. Danach wirkten Sie etwas verstört.«
Verstört? Das war Silke gar nicht bewusst gewesen. Sie glaubte eher, sie hätte sich erleichtert gefühlt. Nun war sie an der Reihe.
»Das war ein Irrer. So was, was bei Ihnen früher sicher auch in die Praxis kam. Der hatte irgendeine psychische Störung, den Namen habe ich schon wieder vergessen.«
Frau Schröder atmete schwer auf.
»Das ist gar nicht gut. Ich sage es nicht gern, aber das ist furchtbar. Leider weiß ich, wovon ich spreche. Sie müssen mir also gar nichts weiter erzählen.«
Sie reichte Silke ein hübsches Kristallglas mit Salzstangen und forderte sie auf zuzugreifen. Silke nahm einige Salzstangen und knabberte gedankenverloren. »Wer nie gegen tobenden Sturm läuft, wird auch von der Windstille nichts erfahren.« Die Nachbarin sah Silke in die Augen, die in diesem Moment aufhörte zu kauen.
»Und nun? Möchten Sie sich weiter nach einem Partner umsehen oder lieber alleine bleiben?«
Herr Schröder grinste.
»Also wirklich, Lydia. Das muss doch nicht sein. Am Ende verscheuchst du unsere Nachbarin, wenn du sie so ungehörig aushorchst!«
Er tätschelte Silkes Arm.
»Nein, nein, es ist in Ordnung, wirklich. Meine Mutter interessiert sich nicht für mich, da bin ich froh, wenn jemand an meinem Leben teilnimmt.«
Frau Schröder nickte, als wisse sie das bereits.
»Ich weiß nicht, ich muss mich wohl entscheiden. Ich will nichts mehr auf Krampf, aber manchmal scheint mir, ich würde unter Torschlusspanik leiden. Überhaupt finde ich Entscheidungen immer sehr schwierig.«
Die Lider gesenkt und die Hand an ihrem Glas, sagte die alte Dame:
»Unser ganzer Lebensweg ist mit Entscheidungen gepflastert. Oft haben wir Angst, die falsche zu treffen und dann mit den Konsequenzen leben zu müssen. Wir haben so viele Gedanken, was alles schiefgehen könnte, dass wir uns davor fürchten. Und je älter man wird, desto schwerer wird es, sich zu entscheiden. Ich möchte Ihnen etwas erzählen, Silke, eine kleine Geschichte. Es war an einem Sonntagmorgen, ich war erst fünfzig Jahre alt und hatte meinen zweiten Sohn verloren. Wussten Sie das?«
Silke schluckte schwer. Das wusste sie nicht. Frau Schröder hatte ihren Sohn verloren? Das war schlimmer, als den Ehemann zu verlieren. Ein Kind sollte niemals vor den Eltern gehen. Ihre Augen wurden feucht. Doch sie wollte die Geschichte hören und schüttelte nur den Kopf. Frau Schröder lächelte wieder ihr weises Lächeln, dieses besondere.
»Unser Sohn litt an einem Aneurysma, einer gefährlichen Gefäßerkrankung, die vorher nicht erkannt worden war. Ich befand mich lange in einer Art Schockstarre, funktionierte wie eine Maschine, ging weiter arbeiten in die Praxis, hörte mir das Leid fremder Menschen an und fühlte mich leer. Das Begreifen setzte erst nach und nach ein. Aber unser Leben änderte sich viel schneller. Manche Freunde wandten sich von uns ab. Einst gute Bekannte wechselten die Straßenseite, wenn sie uns sahen. Es war schlimm. In dieser Zeit habe ich viel über Menschen gelernt. Ich war nur noch ein Schatten meiner Selbst und musste mich entscheiden. Wollte ich mich im Schmerz vergraben oder weiterleben?
An einem Morgen, als alles im Dorf noch schlief, umgab mich eine wunderbare Ruhe. Ich atmete die kühle Morgenluft tief ein und streckte mich. Endlich konnte ich mich langsam in Bewegung setzen und wieder einmal spazieren gehen. Ich entschloss mich, einen anderen Weg als den mir gewohnten zu nehmen. Es verging eine Stunde, ehe ich einen verlassenen Bauernhof entdeckte. Ich liebte diese verlassenen Häuser, die mir Geschichten erzählen konnten, die meine Fantasie lebendig werden ließen. Aber diesmal war es nicht das alte Gemäuer oder die ziemlich graue, melancholisch wirkende Umgebung.
Irgendetwas schimmerte in meinen Augenwinkeln, zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Und da sah ich sie, eine gelbe Rose. Sie stand einsam zwischen vertrocknetem Gestrüpp, alten verdorrten Apfelbäumen. Es sah so aus, als könne sie sich nicht entscheiden, ob sie leben oder sterben wollte. Ihre Blüten glänzten beinahe schüchtern, doch ihre Blätter hingen trostlos welk an ihr herab. Ich bückte mich, nahm ein Häufchen Erde in meine Hand und rieb sie zwischen meinen Fingern. Sie war vertrocknet. Der Mutterboden bot der gelben Rose keinen Nährstoff mehr. Vor dieser Rose blieb ich lange stehen, betrachtete das vergängliche Leben in ihr. Wie sah sie einst aus? Wer pflegte und hegte sie früher? Wer erfreute sich einst ihrer Schönheit? Vorsichtig sah ich mich um. Pflückte ich die Rose, erginge es ihr dann besser als hier auf diesem elenden Boden, auf verwahrlostem Grund? Oder raubte ich ihr damit die Freiheit, die Luft zum Atmen? Wie würde sie sich fühlen, abgebrochen in einem Wasserglas? Wie lange könnte sie noch bewundert werden, bevor ihr Leben für immer verginge? Oder würde sie lieber allein verwelken an einem ihr vertrauten Ort?
Eilig drehte ich mich um und lief weiter, ohne zurückzublicken. Es fiel mir schwer, mich zu entscheiden. Nach einer ruhelosen Nacht erwachte ich sehr früh. Der Tau schien die Gräser wie einen Mantel zu bedecken. Die Katze des Nachbarn saß aufmerksam auf dem Mauersims vor unserem Haus und bewegte sich nicht. So stand ich am Fenster, knabberte an einem trockenen Brötchen und bewunderte das Morgenbild. An anderen Tagen hätte mich dieses Bild so fasziniert, dass ich mich nicht freiwillig davon losgerissen hätte wollen. Doch mich erfasste eine seltsame, aufwühlende Unruhe. Immer wieder sah ich die Rose vor meinem geistigen Auge, die in meinem Traum als einsame, traurige Fee weinend im Schmutz kniete. ›Alle sind gegangen‹, hauchte sie mir zu. Mit diesen Worten der Fee schreckte ich aus dem Schlaf auf. Was sie wohl meinte?
Hastig kleidete ich mich an und lief zu dem alten Bauernhof. Ich suchte die gelbe Rose, wusste ich doch genau, wo sie stand. Einen Augenblick lang zweifelte ich an meiner Vernunft. War denn alles nur ein Traum gewesen? Doch als ich genauer hinsah, erinnerte ich mich; hier hatte sie gestanden, die gelbe Rose. Zwei zartgelb schimmernde Blütenblätter hingen zwischen den Grashalmen, die ein Hauch des Windes umschmeichelte. Jemand hatte die gelbe Rose gepflückt. Jemand, der sich entscheiden konnte.«
Tränen. Sie waren das Einzige, was Silke an diesem Abend blieb. Sie stand auf, hockte sich zwischen die Stühle der zwei alten Leute und legte ihre Arme um sie. Herr Schröder weinte bitterlich und lächelte dazu.
An diesem Abend konnte Silke kaum Ruhe finden. Frau Schröder war eine überaus faszinierende Frau; weise, freundlich, mütterlich, liebevoll. Sie hatte in manchen Minuten die Ausstrahlung eines jungen Mädchens, im nächsten Moment konnte man die Lebensspuren und den Charme alter Menschen an ihr erkennen.
»Ich will auch mal so sein wie sie.«
Mit diesem Gedanken kuschelte sie sich in ihre Decke und schlief ein.