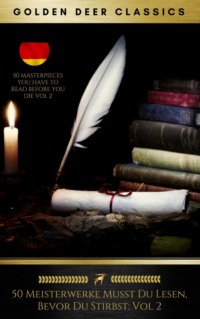Kitabı oku: «50 Meisterwerke Musst Du Lesen, Bevor Du Stirbst: Vol. 2 (Golden Deer Classics)», sayfa 6
»Kehn Se selbst«, sagte der Baron zu seinem Sekretär, »ßu Gondanzon, dem Spion Licharts, des Exegutors; aber nähmen Se ainen Wagen und bringen Se'n her auf der Stell. Ich warte! … Sie werden kehn durch die Gartentier; hier haben Se d'n Schlüssel; denn niemand soll sehn den Menschen bei mir. Sie werden ihn fiehren in den glainen Kartenpavillon. Sehn Se ßu, daß Se mainen Auftrag ausfiehren mit Verstand.«
Es kam Besuch, um mit Nucingen von Geschäften zu reden; aber er wartete auf Contenson, er träumte von Esther, er sagte sich, daß er in kurzer Zeit die Frau wiedersehen würde, der er unerhoffte Erregungen verdankte, und er schickte alle Welt mit unbestimmten Worten und doppelsinnigen Versprechungen davon. Contenson schien ihm das wichtigste Wesen in Paris zu sein; er spähte fortwährend in den Garten hinunter. Und schließlich ließ er sich, nachdem er Befehl gegeben hatte, seine Tür zu schließen, sein Frühstück in dem Pavillon servieren, der in einer der Ecken des Gartens lag. In den Bureaus erschien das Verhalten und Zögern des schlauesten, klarblickendsten, politischsten aller Pariser Bankiers unerklärlich.
»Was hat denn der Chef?« fragte ein Wechselagent einen der ersten Kommis. »Man weiß nicht; es scheint, seine Gesundheit gibt zu Besorgnissen Anlaß; gestern hat die Frau Baronin die Doktoren Desplein und Bianchon berufen … «
Eines Tages wollten Fremde Newton sehen, und zwar in dem Augenblick, als er einem seiner Hunde namens Beauty Arznei eingab; Beauty – es war eine Hündin – brachte ihn, wie man weiß, um eine ungeheure Arbeit, und er sagte zu ihr nichts als: ›Ach, Beauty, du weißt nicht, was du eben vernichtet hast … ‹ Die Fremden gingen voller Achtung vor den Arbeiten des großen Mannes davon. In allen großartigen Existenzen findet man eine kleine Hündin Beauty. Als der Marschall von Richelieu nach der Einnahme von Mahon, einer der größten Waffentaten des achtzehnten Jahrhunderts, Ludwig XV. beglückwünschte, sagte der König zu ihm: ›Wissen Sie schon die große Nachricht? … Der arme Lansmatt ist tot!‹ Lansmatt war ein Pförtner, der in die Intrigen des Königs eingeweiht war. Nie erfuhren die Pariser Bankiers, wie sehr sie Contenson verpflichtet waren. Dieser Spion war der Anlaß, daß Nucingen ein ungeheures Geschäft zum Abschluß kommen ließ, an dem er beteiligt war und das er ihnen ganz überließ. Sonst konnte der Luchs mit der Artillerie der Spekulation ein Vermögen aufs Korn nehmen, während der Mensch der Sklave des Glücks war.
Der berühmte Bankier nahm seinen Tee und nagte als ein Mensch, dessen Zähne seit langem nicht mehr vom Appetit geschärft wurden, an ein paar Butterbroten, als er an der kleinen Pforte seines Gartens einen Wagen halten hörte. Bald führte Nucingens Sekretär ihm Contenson vor, den er erst in einem Café in der Nähe von Sainte-Pélagie hatte finden können, wo der Agent von dem Trinkgeld frühstückte, das ihm ein Schuldner gegeben hatte, weil er ihn unter gewissen Rücksichten, wie man sie bezahlt, ins Gefängnis brachte. Nun muß man wissen, blassen Lippen, das Zwinkern seiner grünlichen Augen, die kleine Grimasse seiner Stumpfnase verrieten, daß es ihm nicht an Geist fehlte. Er hatte ein Gesicht aus Weißblech, und die Seele mußte dem Gesicht gleich sein. Daher waren die Bewegungen seiner Züge eher Grimassen, die der Höflichkeit abgerungen waren, als der Ausdruck seiner inneren Regungen. Er hätte beängstigt, wenn er nicht zum Lachen gereizt hätte. Contenson, eins der seltsamsten Produkte des Schaums, der über dem Sieden der Pariser Kufe schwimmt, in der alles Gärung ist, tat sich vor allem etwas darauf zugute, daß er Philosoph war. Er sagte ohne Bitterkeit: ›Ich habe große Talente; aber ich gebe sie umsonst, es ist, als wäre ich ein Kretin.‹ Und er verurteilte sich selbst, statt die Menschen anzuklagen. Man suche Spione, die nicht mehr Galle haben, als Contenson hatte. ›Die Umstände sind gegen uns,‹ sagte er immer von neuem zu seinen Chefs; ›wir könnten Kristall sein, aber wir bleiben Sandkörner, das ist alles.‹
Sein Zynismus in Dingen der Kleidung hatte einen Sinn; er legte auf seinen Straßenanzug ebensowenig Wert, wie es die Schauspieler tun: er glänzte in Verkleidungen, im Schminken. Er hätte Frédéric Lemaître unterrichten können, denn er konnte sich im Notfall zum Dandy machen. Er mußte in seiner Jugend zu der verfallenen Gesellschaft der Leute mit Häusern für geheime Vergnügungen gehört haben. Er legte die tiefste Antipathie gegen die Kriminalpolizei an den Tag, denn er hatte unter dem Kaiserreich der Polizei Fouchés angehört, den er als einen großen Mann ansah. Seit der Aufhebung des Polizeiministeriums hatte er als Ausweg die Verhaftung von Schuldnern erwählt; aber seine bekannten Fähigkeiten, seine Schlauheit machten ihn zu einem kostbaren Werkzeug, und die unbekannten Leiter der politischen Polizei hatten seinen Namen in ihren Listen behalten. Contenson war ebenso wie seine Kameraden nur einer der Statisten des Dramas, dessen erste Rollen ihren Vorgesetzten zufielen, sobald es sich um eine politische Arbeit handelte.
»Kehn Se,« sagte Nucingen, indem er durch eine Geste seinen Sekretär fortschickte.
›Weshalb wohnt dieser Mensch in einem Hotel und ich in einem möblierten Zimmer? … ‹ fragte Contenson sich selber. ›Er hat seine Gläubiger dreimal an der Nase herumgeführt, und er hat gestohlen; ich habe nie einen Heller genommen … Ich habe mehr Talent als er … ‹
»Gondanzon, main Glainer,« sagte der Baron, »Sie haben mir abgeluchst ainen Tausendfrankenschain … « »Meine Geliebte war Gott und dem Teufel schuldig … « »Du hast aine Keliepte?« rief Nucingen aus, indem er Contenson mit einer Bewunderung ansah, in die sich Neid mischte. »Ich bin erst siebzig Jahre alt,« erwiderte Contenson als ein Mensch, den wie ein verhängnisvolles Beispiel das Laster jung erhalten hatte. »Und was macht se?« »Sie hilft mir,« sagte Contenson. »Wenn man Dieb ist, und eine anständige Frau liebt einen, so wird sie entweder Diebin, oder man wird ein ehrlicher Mensch. Ich bin Spitzel geblieben.« »Du prauchst immer Keld?« fragte Nucingen. »Immer,« sagte Contenson lächelnd; »es ist mein Stand, daß ich mir welches wünsche, wie es der Ihre ist, welches zu verdienen; wir können uns verständigen: raffen Sie es zusammen, ich mache mich anheischig, es auszugeben. Sie sollen der Brunnen sein, ich der Eimer.« »Willste verdienen finfhündert Franken? … « »Schöne Frage! … Aber bin ich dumm! … Sie bieten sie mir nicht, um die Ungerechtigkeit des Schicksals mir gegenüber wieder gutzumachen.« »Was haißt! Ich lege sie ßu dem Tausender, den du mir stipitzt hast; das macht finfzehnhündert Franken, die ich dir keb.« »Gut, Sie geben mir die tausend Franken, die ich schon habe, und Sie legen fünfhundert Franken hinzu … « »Kanß recht,« sagte Nucingen mit einem Kopfnicken. »Das macht immer erst fünfhundert Franken,« sagte Contenson unerschütterlich. »Die ich kebe! … « erwiderte der Baron. »Die ich bekomme. Nun, gegen welche Werte will der Herr Baron sie eintauschen?« »Man hat mir kesagt, daß in Baris ain Mensch lebt, der kann finden die Frau, die ich liebe, und daß du seine Atreß hast … Kurz, ain Maister der Schbionasche!« »Allerdings … « »Kut, kieb mir die Atreß, und du hast die finfhündert Franken.« »Wo sind sie?« erwiderte Contenson lebhaft. »Hier,« sagte der Baron, indem er einen Schein aus der Tasche zog. »Schön, geben Sie her,« sagte Contenson, indem er die Hand ausstreckte. »Keben, keben! Laß uns kehen ßu suchen den Mann, und du hast das Keld, denn du könntest verkaufen viele Atressen um diesen Preis.«
Contenson brach in Lachen aus. »Wahrhaftig, Sie haben das Recht, so von mir zu denken,« sagte er, während es schien, als hielte er sich zurück. »Je hundsgemeiner unser Stand ist, um so mehr bedarf er der Ehrlichkeit. Aber lassen Sie sehen, Herr Baron, sagen Sie sechshundert Franken, und ich werde Ihnen einen guten Rat geben.« »Kieb und verlaß dich auf maine Kroßmut … « »Ich will es wagen,« sagte Contenson; »aber ich spiele gewagtes Spiel. In Dingen der Polizei, sehen Sie, muß man unterirdisch vorgehen. Sie sagen: Los, auf! … Sie sind reich; Sie glauben, alles weiche vor dem Geld. Das Geld ist ja auch etwas. Aber mit Geld hat man nach den zwei oder drei tüchtigen Leuten unseres Metiers immer erst die Menschen. Und es gibt Dinge, an die man nicht denkt, die sich nicht kaufen lassen! … Den Zufall nimmt man nicht in Sold. Daher macht man die Dinge im guten Polizeidienst auch nicht so. Wollen Sie sich mit mir im Wagen zeigen? Man wird uns begegnen. Man hat den Zufall ebensosehr für sich wie gegen sich.« »Wahr,« sagte der Baron. »Wahrhaftig, ja, Herr Baron. Ein Hufeisen, das der Polizeipräfekt in der Straße auflas, führte ihn zur Entdeckung der Höllenmaschine. Nun, wenn wir heute abend im Dunkeln zu Herrn von Saint-Germain führen, so würde ihm nicht mehr daran liegen, Sie bei sich zu sehen, als Ihnen, gesehen zu werden, wenn Sie zu ihm fahren.« »Das ist richtig,« sagte der Baron. »Ah, er ist der Stärkste der Starken, die Stütze des berühmten Corentin, des rechten Arms Fouchés, den manche für seinen natürlichen Sohn ausgeben; er soll ihn als Priester gezeugt haben; aber das sind Dummheiten: Fouché verstand es, Priester zu sein, wie er es verstanden hat, Minister zu sein. Nun, sehen Sie, diesen Mann werden Sie nicht unter zehn Tausendfrankenscheinen an die Arbeit bringen … Überlegen Sie sich's … Aber Ihre Angelegenheit wird erledigt, und gut erledigt. Nicht gesehen noch erkannt, wie man sagt. Ich werde den Herrn von Saint-Germain benachrichtigen müssen, und er wird Ihnen ein Stelldichein geben irgendwo, wo niemand etwas hören oder sehen kann; denn er setzt sich Gefahren aus, wenn er auf Rechnung Privater Polizeidienste leistet. Aber was wollen Sie! … Er ist ein braver Mensch, der König der Menschen, und ein Mensch, der große Verfolgungen durchgemacht hat, und obendrein, weil er Frankreich gerettet hatte! … Wie übrigens auch ich, wie alle, die es gerettet haben!«
»Kut; du kannst mir schraiben die Schäferstunde,« sagte der Baron, indem er über diesen vulgären Scherz lächelte. »Der Herr Baron schmiert mir nicht einmal die Pfote? … « sagte Contenson mit zugleich demütiger und drohender Miene.
»Schan,« rief der Baron seinem Gärtner zu, »keh, laß dir von Schorsch ßwanßig Franken keben und bring se her … «
»Wenn freilich der Herr Baron keine andern Angaben machen kann, als er mir gegeben hat, so zweifle ich, ob ihm der Meister von Nutzen sein kann.« »Hab ich andre!« erwiderte der Baron mit schlauem Gesicht. »Ich habe die Ehre, dem Herrn Baron einen guten Tag zu wünschen,« sagte Contenson, indem er das Zwanzigfrankenstück nahm; »ich werde die Ehre haben, wiederzukommen und Georg zu sagen, wo der Herr Baron sich heute abend einfinden soll, denn man darf im guten Polizeidienst niemals etwas schreiben.«
›Gomisch, wieviel Keist diese Burschen haben!‹ sagte der Baron vor sich hin; ›es ist in der Bolißei kenau wie bei den Keschäften.‹
Als Contenson den Baron verließ, ging er ruhig von der Rue Saint-Lazare in die Rue Saint-Honoré und bis zum Café David; er blickte dort durch die Scheiben und bemerkte einen Greisen, der unter dem Namen Vater Canquoelle bekannt war.
Das Café David, das in der Rue de la Monnaie lag, genoß während der ersten dreißig Jahre dieses Jahrhunderts eine gewisse Berühmtheit, die freilich auf das sogenannte ›Quartier des Bourdonnais‹ beschränkt blieb. Dort versammelten sich die alten Händler, die sich zur Ruhe gesetzt hatten, und die Großkaufleute, die noch im Geschäft standen: die Camusots, die Lebas, die Pilleraults, die Popinots, und ein paar Grundbesitzer wie der kleine Vater Molineux. Man sah dort von Zeit zu Zeit auch den alten Vater Guillaume, der aus der Rue du Colombier dorthin kam. Man sprach dort unter sich von Politik, freilich vorsichtig, denn der Standpunkt des Café David war der Liberalismus. Man erzählte sich die Klatschereien des Quartiers, so stark empfinden die Menschen das Bedürfnis, sich übereinander lustig zu machen! … Dieses Café hatte, wie übrigens alle Cafés, seinen Sonderling, und zwar in eben jenem Vater Canquoelle, der dort seit dem Jahre 1811 verkehrte und der mit den ehrlichen Leuten, die sich dort versammelten, so sehr im Einklang zu stehen schien, daß niemand sich Zwang antat, wenn man in seiner Gegenwart von Politik sprach. Bisweilen war dieser Ehrenmann, dessen Einfalt den Stoff zu vielen Scherzen unter den Stammgästen hergab, auf einen oder zwei Monate verschwunden; aber sein Ausbleiben, das man stets seinen Krankheiten oder seinem Alter zuschrieb, denn er schien schon 1811 sein sechzigstes Jahr überschritten zu haben, erstaunte niemals irgend jemanden.
»Was ist denn aus dem Vater Canquoelle geworden? … « fragte man die Büfettdame. »Ich denke mir,« erwiderte sie, »wir werden eines schönen Tages durch die ›kleinen Anzeigen‹ von seinem Tod erfahren.«
Der Vater Canquoelle lieferte in seiner Aussprache einen beständigen Beweis seiner Herkunft; er sagte: estatue, especialle, le peuble und ture statt turc. Sein Name war der eines kleinen Landsitzes, der Les Canquoelles hieß, ein Wort, das in einigen Provinzen ›Maikäfer‹ bedeutet; dieses Landgut lag im Departement Vaucluse, aus dem er gekommen war. Man nannte ihn schließlich nur noch Canquoelle, ohne daß der Biedermann sich darüber ärgerte; der Adel schien ihm seit 1793 tot zu sein; übrigens gehörte ihm das Lehnsgut Les Canquoelles nicht, er war der jüngere Sohn einer jüngeren Linie. Heute würde der Anzug des Vaters Canquoelle seltsam erscheinen; aber zwischen 1811 und 1820 setzte er niemanden in Erstaunen. Dieser Greis trug Schuhe mit facettierten Stahlschnallen, seidene Strümpfe mit abwechselnd weißen und blauen wagerechten Streifen, eine Hose aus glattem Seidenstoff mit ovalen Schnallen, die der Form nach denen der Schuhe glichen. Eine weiße Weste mit Stickereien, ein alter Rock aus grünlichbraunem Tuch mit Metallknöpfen und ein Hemd mit ein Vitellius; und auch der kaiserliche Bauch war sozusagen durch eine Wiedergeburt bei ihm entwickelt. 1816 betrank sich dort ein junger Handlungsreisender zwischen elf Uhr und Mitternacht mit einem pensionierten Offizier. Er war unvorsichtig genug, von einer ziemlich ernsten Verschwörung gegen die Bourbonen zu sprechen, die eben vor ihrem Ausbruch stand. Im Café sah man nur noch den Vater Canquoelle, der eingeschlafen zu sein schien, zwei schlummernde Kellner und die Büfettdame. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden war Gaudissart verhaftet, und die Verschwörung war entdeckt. Zwei Leute fanden den Tod auf dem Schafott. Weder Gaudissart noch irgend jemand sonst faßte je Verdacht, daß der Vater Canquoelle Lunte gerochen hätte. Man entließ die Kellner, man behielt einander ein Jahr lang im Auge, und man entsetzte sich über die Polizei, die mit dem Vater Canquoelle zusammen arbeitete, obwohl er davon sprach, das Café David zu verlassen; so sehr graue ihm vor der Polizei.
Contenson betrat das Café, verlangte ein kleines Glas Branntwein und sah den Vater Canquoelle, der damit beschäftigt war, die Journale zu lesen, nicht einmal an; nur nahm er, als er sein Glas Branntwein hinuntergegossen hatte, das Goldstück des Barons und rief den Kellner, indem er dreimal kurz auf den Tisch schlug. Die Büfettdame und der Kellner prüften das Goldstück mit einer Sorgfalt, die für Contenson sehr beleidigend war.
›Ist dieses Gold das Ergebnis eines Diebstahls oder eines Mordes? … ‹ das war der Gedanke einiger starker und klarblickender Geister, die Contenson unter der Brille her ansahen, obwohl sie scheinbar ihre Blätter lasen. Contenson, der all das sah und nie über irgend etwas erstaunte, wischte sich mit einem Tuch, das nur dreimal gestopft worden war, geringschätzig den Mund ab, nahm sein Kleingeld in Empfang, schob all die Sous in seine Geldtasche, deren einst weißes Futter ebenso schwarz war wie das Tuch der Hose, und ließ dem Kellner keinen einzigen.
»Was für ein Galgenvogel!« sagte der Vater Canquoelle zu Herrn Pillerault, seinem Nachbar. »Bah!« gab Herr Camusot dem ganzen Café zur Antwort; er allein hatte nicht das geringste Erstaunen verraten; »das ist Contenson, der rechte Arm Louchards, unseres Exekutors am Handelsgericht. Die Schelme haben vielleicht einen im Quartier zu rupfen … «
Eine Viertelstunde darauf erhob sich der Biedermann Canquoelle, nahm seinen Schirm und ging ruhig davon.
Ist es nicht nötig, hier aufzuklären, welcher furchtbare und tiefe Mensch sich unter dem Anzug des Vaters Canquoelle verbarg, genau wie der Abbé Carlos das Versteck Vautrins war? Dieser Südländer, der auf Les Canquoelles, dem einzigen Besitz seiner übrigens recht ehrenwerten Familie, geboren war, hieß Peyrade. Er gehörte in Wirklichkeit der jüngeren Linie des Hauses de la Peyrade an, einer alten, aber armen Familie der Grafschaft, die noch heute das kleine Gut La Peyrade besitzt. Er war als siebentes Kind mit sechs Franken in der Tasche zu Fuß nach Paris gekommen, und zwar im Jahre 1772, als er siebzehn Jahre alt war; ihn trieben die Fehler eines wilden Temperaments und das brutale Verlangen, es zu etwas zu bringen, das so viele Südländer in die Hauptstadt treibt, wenn sie erkannt haben, daß das väterliche Haus ihnen nie die für ihre Leidenschaften nötige Rente geben kann. Wir haben die ganze Jugend Peyrades enthüllt, wenn wir sagen, daß er 1782 der Vertraute, der Heros des Generalpolizeiamts war, wo die Herren Lenoir und d'Albert, die beiden letzten Generalleutnants, ihn sehr hoch schätzten. Die Revolution kannte keine Polizei, sie hatte sie nicht das Napoleon den Feldzug von Boulogne zurückgeben wollte, und sie sahen sich überrumpelt ohne den Meister, der auf der Insel Lobau verschanzt war, wo ganz Europa ihn für verloren hielt; und also wußten sie nicht, welchen Entschluß sie fassen sollten. Die allgemeine Meinung ging dahin, dem Kaiser einen reitenden Boten zu schicken; aber Fouché allein wagte es, den Feldzugsplan zu entwerfen, den er auch ausführte. »Handeln Sie, wie Sie wollen,« sagte Cambacérès zu ihm; »mir aber ist mein Kopf zu lieb, und ich schicke dem Kaiser einen Bericht.«
Man weiß, welchen absurden Vorwand der Kaiser ergriff, als er bei seiner Rückkehr vor versammeltem Staatsrat seinem Minister die Gnade entzog und ihn dafür bestrafte, daß er Frankreich ohne ihn gerettet hatte. Seit jenem Tage stand dem Kaiser außer der Feindschaft des Fürsten von Talleyrand auch die des Herzogs von Otranto im Wege, und sie waren die beiden einzigen großen Politiker, die aus der Revolution hervorgegangen waren und die Napoleon 1813 vielleicht hätten retten können. Um Peyrade zu beseitigen, ergriff man den vulgären Vorwand der Veruntreuung; er hatte den Schmuggel begünstigt, indem er mit dem Großhandel ein paar Gewinste teilte. Diese Behandlung war hart für einen Mann, der den Marschallstab des Generalkommissariats großen Diensten verdankte, die er geleistet hatte. Dieser inmitten der Geschäfte gealterte Mann kannte die Geheimnisse aller Regierungen, die sich seit 1775 gefolgt waren; denn in diesem Jahre war er in das Generalpolizeiamt eingetreten. Der Kaiser, der sich für stark genug hielt, sich Menschen zu seinem Gebrauch zu schaffen, achtete nicht auf die Vorstellungen, die man ihm zugunsten eines Mannes machte, der als eines der verläßlichsten, der geschicktesten und schlauesten jener unbekannten Genies galt, die die Aufgabe haben, über die Sicherheit der Staaten zu wachen. Er glaubte, Peyrade durch Contenson ersetzen zu können; aber Contenson wurde damals von Corentin aufgesogen, und zwar zu dessen Nutzen. Peyrade war um so grausamer getroffen, als er, ein Wüstling und Schlemmer, sich den Frauen gegenüber in der Lage eines Zuckerbäckers befand, der Naschwerk liebt. Seine lasterhaften Gewohnheiten waren ihm zur Natur geworden: er konnte es nicht mehr entbehren, gut zu speisen, zu spielen, kurz jenes Leben eines prunklosen großen Herrn zu führen, dem sich alle Menschen von großen Fähigkeiten ergeben, wenn ihnen übermäßige Zerstreuungen zum Bedürfnis geworden sind. Dann hatte er bisher im großen Stil gelebt, ohne je zur Repräsentation verpflichtet zu sein, aus dem Vollen speisend, denn man rechnete nie mit ihm oder seinem Freund Corentin. Als ein zynisch geistreicher Mensch liebte er seinen Stand, er war Philosoph. Schließlich kann ein Spion, auf welcher Stufe der Leiter der Polizei er auch stehe, ebensowenig wie ein Sträfling in einen sogenannten ehrlichen oder freien Beruf zurückkehren. Spione wie Sträflinge haben, wenn sie einmal auf der Liste stehen, gleich den Kirchendienern einen unauslöschlichen Charakter. Es gibt Wesen, denen ihr sozialer Stand ihr Schicksal unweigerlich aufprägt. Zu seinem Unglück hatte Peyrade sich in ein hübsches kleines Mädchen verliebt, in ein Kind, das er selbst mit einer berühmten Schauspielerin gezeugt hatte, der er einen Dienst erwies und die ihm drei Monate lang dankbar war. Peyrade sah sich also, als er sein Kind aus Antwerpen kommen ließ, in Paris ohne Mittel, abgesehen von einer Unterstützung in Höhe von jährlich zwölfhundert Franken, die die Polizeipräfektur dem alten Schüler Lenoirs zukommen ließ. Er nahm in der Rue des Moineaux in einem vierten Stock eine kleine Wohnung von fünf Zimmern, für die er zweihundertfünfzig Franken zahlte.
Wenn je ein Mensch fühlen muß, wie nützlich, wie angenehm die Freundschaft ist, ist es da nicht der moralisch Aussätzige, den die Masse einen Spion, das Volk einen Spitzel und die Verwaltung einen Agenten nennt? Peyrade und Corentin also waren Freunde, wie Orest und Pylades es waren. Peyrade hatte Corentin zu dem gemacht, was er war; genau wie Vien David zu dem gemacht hat, was er wurde; aber der Schüler übertraf den Meister gar bald. Sie hatten zusammen mehr als einen Feldzug unternommen (siehe ›Eine dunkle Begebenheit‹). Peyrade, der glücklich war, weil er Corentins Begabung erraten hatte, lancierte ihn in seiner Laufbahn, indem er ihm einen Triumph bereitete. Er zwang seinen Schüler, sich einer Geliebten, die ihn verabscheute, als Angel zu bedienen, um einen Menschen zu fangen. Und Corentin war damals kaum fünfundzwanzig Jahre alt! … Corentin war einer der Generäle geblieben, deren Konnetabel der Polizeiminister ist, und er hatte unter dem Herzog von Rovigo die hervorragende Stellung bewahrt, die er unter dem Herzog von Otranto eingenommen hatte. Nun war es damals bei der politischen Polizei genau so wie bei der Kriminalpolizei. Bei jeder ein wenig ausgedehnten Angelegenheit schloß man mit den drei, vier oder fünf tüchtigen Agenten einen Akkord. Wenn der Minister von irgendeiner Verschwörung unterrichtet oder vor irgendeinem Anschlag gewarnt wurde, einerlei, wie es geschah, so sagte er zu einem der Obersten seiner Polizei: ›Was brauchen Sie, um zu dem und dem Ergebnis zu kommen?‹ Corentin, Contenson antworteten dann nach reiflicher Erwägung: ›Zwanzig-, dreißig-, vierzigtausend Franken.‹
War dann einmal der Auftrag zum Vorrücken gegeben, so blieben alle anzuwendenden Mittel und Leute der Wahl und dem Urteil Corentins oder des gewählten Agenten überlassen. Die Kriminalpolizei arbeitete übrigens mit dem berühmten Vidocq in der Entdeckung der Verbrechen ebenso.
Die politische Polizei wählte wie die Kriminalpolizei ihre Leute hauptsächlich unter den bekannten, registrierten, eingewöhnten Agenten, wie sie gleichsam die Soldaten dieser Streitmacht bilden, die für die Regierungen so notwendig ist, was auch die Philanthropen oder die Moralisten mit ihrer kleinen Moral dagegen einwenden mögen. Aber das ungeheure Vertrauen, das den zwei oder drei Generalen von der Art Peyrades und Corentins gebührte, brachte für sie das Recht mit sich, unbekannte Personen zu verwenden, freilich stets unter der Bedingung, daß sie in ernsten Fällen dem Minister Bericht erstatten mußten. Nun waren Peyrades Erfahrung und Schlauheit für Corentin zu kostbar, und sowie der Sturm von 1810 vorüber war, verwandte er seinen alten Freund; er zog ihn stets zu Rate und sorgte reichlich für seine Bedürfnisse. Corentin fand Mittel und Wege, Peyrade etwa tausend Franken im Monat zu geben. Peyrade seinerseits leistete Corentin ungeheure Dienste. 1816 versuchte Corentin anläßlich der bonapartistischen Verschwörung, an der Gaudissart teilnehmen sollte, Peyrade in die politische Polizei wieder einzuführen; aber ein unbekannter Einfluß setzte sich ihm entgegen. Der Grund war dieser. In ihrem Wunsch, sich unentbehrlich zu machen, hatten Peyrade, Corentin und Contenson auf Anstiften des Herzogs von Otranto für Ludwig XVIII. eine Gegenpolizei organisiert, in der die Agenten ersten Ranges ihre Stellung fanden. Ludwig XVIII. starb, unterrichtet von Geheimnissen, die den bestunterrichteten Historikern Geheimnisse bleiben werden. Der Kampf der politischen Polizei des Königreichs mit der Gegenpolizei des Königs erzeugte grauenhafte Verwicklungen, deren Geheimnisse durch einige Hinrichtungen bewahrt worden sind. Es ist hier weder der leisten konnte. Als Ludwig XVIII. starb, verlor Peyrade nicht nur seine ganze Bedeutung, sondern auch die Einkünfte seiner Stellung als regelmäßiger Spion Seiner Majestät. Da er sich für unentbehrlich hielt, so hatte er seine Lebensweise fortgesetzt. Die Frauen, das Wohlleben und der ›Cercle des Etrangers‹ hatten diesen Mann, der, wie alle für das Laster geschaffenen Leute, eine eiserne Konstitution besaß, vor jeder Sparsamkeit bewahrt. Von 1826 bis 1829 freilich, während welcher Zeit er nahezu sein vierundsiebzigstes Jahr erreichte, ließ er nach, wie er es ausdrückte. Von Jahr zu Jahr hatte Peyrade zusehen müssen, wie sein Wohlsein schwand. Er er lebte das Begräbnis der Polizei, er erkannte mit Bedauern, daß die Regierung Karls X. ihre guten Traditionen verließ. In jeder neuen Sitzung beschnitt die Kammer die Bewilligungen ein wenig mehr, die für das Dasein der Polizei notwendig sind, denn man haßte dieses Regierungswerkzeug und wollte die ganze Einrichtung von vornherein demoralisieren. ›Das ist gerade, als wollte man in weißen Handschuhen kochen,‹ sagte Peyrade zu Corentin.
Corentin und Peyrade hatten 1830 schon 1822 vorausgesehen. Sie kannten den heimlichen Haß, den Ludwig XVIII. seinem Nachfolger entgegenbrachte, der auch seine Nachgiebigkeit gegen die ältere Linie erklärte und ohne den seine Regierung und seine Politik ein Rätsel ohne Lösung wären.
Je mehr Peyrade alterte, um so größer war seine Liebe zu seiner natürlichen Tochter geworden. Für sie hatte er seine bürgerliche Gestalt angenommen, denn er wollte seine Lydia mit einem ehrlichen Mann verheiraten. Deshalb wollte er auch, vor allem seit den letzten drei Jahren, entweder in der Polizeipräfektur oder in der Direktion der politischen Polizei des Königreichs unterkommen; und zwar in irgendeiner Stellung, die er zeigen, die er eingestehen konnte. Er hatte schließlich selbst eine Stellung erfunden, deren Notwendigkeit sich, wie er zu Corentin sagte, früher oder später fühlbar machen würde. Es handelte sich darum, in der Polizeipräfektur ein sogenanntes ›Auskunftsbureau‹ zu schaffen, das ein Vermittler zwischen der Pariser Polizei im eigentlichen Sinne, der Kriminalpolizei und der Polizei des Königreichs werden sollte; auf diese Weise wollte er der Generaldirektion all diese zerstreuten Mächte dienstbar machen. Peyrade allein konnte in seinem Alter nach fünfundfünfzig Jahren der Verschwiegenheit das Ringglied bilden, das die drei Zweige der Polizei vereinigte, den Archivar, an den sich die Politik wie die Justiz wenden mußte, um in gewissen Fällen Aufklärung zu erhalten. Peyrade hoffte so mit Hilfe Corentins eine Gelegenheit zu finden, um der kleinen Lydia eine Mitgift und einen Gatten zu verschaffen. Corentin hatte schon mit dem Generaldirektor der Polizei des Königreichs darüber gesprochen, ohne aber Peyrade zu erwähnen; und der Generaldirektor, ein Südländer, hielt es für nötig, ein Gutachten der Präfektur einzuziehen.
In dem Augenblick, als Contenson dreimal mit seinem Goldstück auf den Tisch schlug – ein Signal, das bedeutete: ›ich habe mit euch zu sprechen‹ –, dachte der Älteste der Polizeiagenten eben über folgendes Problem nach: ›Durch welche Persönlichkeit, durch welches Interesse soll ich den gegenwärtigen Polizeipräfekten gewinnen?‹ Und dabei sah er aus wie ein Dummkopf, der seinen ›Französischen Kurier‹ studierte.
›Unser armer Fouché,‹ sagte er bei sich selber, während er die Rue Saint-Honoré dahinschritt, »dieser große Mann, ist tot! Unsere Vermittler mit Ludwig XVIII. sind in Ungnade. Übrigens glaubt man, wie Corentin mir gestern sagte, nicht mehr an die Regsamkeit und Findigkeit eines Siebzigers … Ach, weshalb habe ich mir angewöhnt, bei Véry zu speisen, köstliche Weine zu trinken … lustige Liedchen zu singen und zu spielen, wenn ich Geld habe? Um sich eine Stellung zu sichern, genügt es nicht, daß man Geist hat, wie Corentin sagt, sondern man muß auch noch den Geist des Behaltens besitzen! Dieser teure Herr Lenoir hat mir mein Los ja vorausgesagt, als er bei Gelegenheit der Halsbandaffäre rief: ›Sie werden es nie zu etwas bringen!‹ sobald er erfuhr, daß ich nicht unter dem Bett der Dirne Oliva geblieben war.«
Wenn der ehrwürdige Vater Canquoelle – man nannte ihn auch in seinem Hause Vater Canquoelle – im vierten Stock der Rue des Moineaux geblieben war, so kann man wohl glauben, daß er in der Verteilung der Räume Eigentümlichkeiten gefunden hatte, die die Ausübung seiner furchtbaren Obliegenheiten begünstigten. Sein Haus lag an der Ecke der Rue Saint-Roche und stand auf der einen Seite frei. Da es vermittelst einer Treppe in zwei Teile geteilt war, lagen in jedem Stockwerk zwei Zimmer, die absolut abgeschlossen waren. Diese beiden Zimmer blickten in die Rue Saint-Roche. Oberhalb des vierten Stocks erstreckten sich die Mansarden, deren eine als Küche diente, während die andere von der einzigen Dienerin des Vaters Canquoelle bewohnt wurde; es war eine Flamländerin namens Katt, die Lydia gesäugt hatte. Der Vater Canquoelle hatte das eine der abgetrennten Zimmer zu seinem Schlafzimmer gemacht, das andere zum Arbeitszimmer. Eine dicke Mauer schloß dieses Arbeitszimmer nach hinten ab. Das Fenster, das auf die Rue des Moineaux ging, blickte auf eine einspringende Mauer ohne Fenster. Da nun die ganze Breite des Schlafzimmers die beiden Freunde von der Treppe trennten, so fürchteten sie keinen Blick und kein Ohr, wenn sie in diesem für ihr furchtbares Gewerbe eigens geschaffenen Zimmer von Geschäften sprachen. Aus Vorsicht hatte Peyrade in das Zimmer der Flamländerin ein Strohbett und einen mit Kuhhaargewebe unterlegten sehr dicken Teppich getan, indem er sagte, er wolle die Amme seines Kindes glücklich machen. Ferner hatte er den Kamin vermauert und bediente sich eines Ofens, dessen Rohr durch die Außenmauer auf die Rue Saint-Roche ging. Schließlich hatte er den Boden mit mehreren Teppichen bedeckt, um die Bewohner des untern Stockwerks daran zu hindern, daß sie das geringste Geräusch auffingen. Da er in allen Spionagemitteln bewandert war, so untersuchte er einmal in der Woche die hintere Mauer, die Decke und den Boden und durchforschte sie wie jemand, der lästige Insekten töten will. Die Gewißheit, daß er hier ohne Zeugen und Zuhörer war, hatte auch Corentin veranlaßt, dieses Arbeitszimmer als Beratungssaal zu wählen, wenn er nicht zu Hause beriet. Corentins Wohnung war nur dem Generalpolizeidirektor des Königreichs und Peyrade bekannt; er empfing dort diejenigen Persönlichkeiten, die das Ministerium oder die Krone in ernsten Sachen zu Vermittlern nahmen; aber kein Agent, kein Subalterner kam dorthin, und die Berufsangelegenheiten erledigte er bei Peyrade. In diesem unscheinbaren Zimmer wurden Pläne gesponnen, wurden Entschlüsse gefaßt, die wunderliche Annalen und seltsame Dramen ergeben würden, wenn die Mauern reden könnten. Dort wurden zwischen 1816 und 1826 ungeheure Interessen analysiert. Dort wurden die Keime der Ereignisse entdeckt, die so schwer auf Frankreich lasten sollten. Dort sagten sich Peyrade und Corentin, die ebenso klarblickend, aber besser unterrichtet waren als der Generalprokurator Bellart, schon 1819: ›Wenn Ludwig XVIII. den und den Schlag nicht führen, sich des und des Prinzen nicht entledigen will, so verabscheut er also seinen Bruder? Er will ihm also eine Revolution vermachen?‹