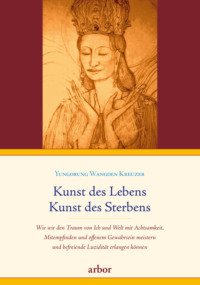Kitabı oku: «Kunst des Lebens, Kunst des Sterbens», sayfa 2
Gelassenheit, Mitgefühl und Luzidität
Und damit kehren wir zurück zu dem, was ein gutes Leben eigentlich ausmacht und ermöglicht: die Kultivierung von Gelassenheit, Mitgefühl und Luzidität.
Das Achten auf persönliche Psychohygiene und die Anwendung von Meditation und Entspannungsübungen zur Stressreduktion sind zu einer lebensnotwendigen Gegenmaßnahme geworden, um dem sich aufbauenden inneren und äußeren Druck überhaupt standhalten zu können. Meditation kann im gedanklichen Chaos Ordnung schaffen, kann psychisches und physisches Leid lindern und heilen, und sie kann als Teil einer umfassenden Geistesschulung, wenn sie kontinuierlich und systematisch geübt wird, schließlich sogar die eigentlichen Ursachen unseres Leids, die tief in unserem Unterbewusstsein liegen und uns konditionieren, beseitigen und damit auch den Zustand eines bleibenden, von äußeren Umständen unabhängigen Glücks verwirklichen.
Wie gesagt: Kein fühlendes Wesen will leiden. Alle Wesen suchen das Glück oder das für sie Angenehme, aber leider meist auf Wegen, die sie von Objekten abhängig machen und Sucht erzeugen und damit notwendigerweise zu neuen Leiden führen und den Zustand des Mangels, der Unfreiheit und geistigen Unruhe damit fortsetzen. So heißt es auch bei Seneca: »Wenn du glücklich sein willst, vermehre nicht deine Besitztümer, sondern verringere deine Wünsche.« Durch die Übung der Meditation erfährt der Geist häufiger Zustände von entspannter Ruhe, von wunschlosem Glücklichsein und eine nichturteilende, verständnisvolle Klarheit, die authentische Selbsterkenntnis ermöglicht. Durch die Einübung einer gelassenen, an nichts haftenden Wachheit und ruhigen Achtsamkeit gegenüber den eigenen Gedanken wird man dieser erst wirklich gewahr, durch Gewahrsein wird man frei von ihnen, und irgendwann steht es uns wirklich frei, ihnen zu folgen oder nicht. Diese Übung des ständigen Loslassens kann schließlich zu einer stabilen, verlässlichen »Gelassenheit« führen, die frei ist vom Denken, frei vom Ich und seinen Wünschen und Ängsten, und sie bringt uns mit dem Leben in Einklang, bedeutet sie doch eigentlich nichts anderes, als ein Leben in Übereinstimmung mit der vergänglichen Natur aller Dinge zu führen.
Luzidität im Sinne des Buddha bedeutet, unser eigenes Denken und all unsere Erfahrungen als von der Natur eines Traums zu erkennen und zu meistern. Gelingt es uns, beides, Gelassenheit und Luzidität, zu kultivieren, so können wir die Ursachen des Leids in uns – also Unwissenheit und Unachtsamkeit, Anhaften und Aversion – beseitigen, und die Ursachen des Glücks heute und in der Zukunft werden dadurch vermehrt. Alle Erscheinungen können uns dann zum Freund und Lehrer und zum willkommenen Anlass eines immer neuen und frischen Erkennens des Wesentlichen werden.
Durch die Betrachtung des Vergänglichen erkennen wir das Unvergängliche. Wenn wir den Tod oder die Auflösung der Formen nicht mehr als Ende des Erlebens, sondern als seine Transformation verstehen, so schwindet alle Angst vor Veränderung, und es wird möglich, jeden Augenblick unseres Lebens und Sterbens mit Achtsamkeit und Wertschätzung zu genießen.
Im frühen Buddhismus des »Theravada« besteht die Hauptübung des Meditierenden darin, Körper, Atmung und Geist, ohne zu urteilen, direkt zu beobachten und so der Vergänglichkeit aller Phänomene gewahr zu werden. Durch diese unmittelbare Beobachtung kann man zur zweifelsfreien persönlichen Erkenntnis kommen, dass weder der »Wahr-Nehmende« noch das »Wahr-Genommene« eine bleibende, selbstständige Existenz besitzen.
Alles Lebendige fließt als ein Strom fortwährender Wandlungen, und keiner dieser Augenblicke ist genau so wiederholbar. Vom Feinsten bis zum Gröbsten können wir ein ständiges Werden und »Entwerden« in uns selbst und unserer Umgebung beobachten, und tatsächlich ist Vergänglichkeit das einzig bleibende und gemeinsame, direkt beobachtbare Charakteristikum all unserer sonst so verschiedenen Erfahrungen. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Weil alles an uns, in uns und um uns herum vergänglich ist, sind wir im Grunde von Anfang an erlöst – aber wir wollen die Vergänglichkeit und damit unser Erlöstsein nicht wahrhaben. Wir wollen nicht vergänglich sein.
Ein Buddha aber ist völlig vergänglich, fließend und selbstlos. Er ist frei vom Größenwahn und frei vom Minderwertigkeitskomplex des Ich-Bewusstseins, denn er verweilt in nichts.
»So wie Eis nur Wasser ist, sind die Menschen in ihrem wahren Wesen Buddha«, lehrte Hakuin in seinem Gesang des Zen.

Nun ist ein ständiges Erfassen, Begreifen und Einordnen die natürliche Funktion unseres Denkbewusstseins, doch das Denken oder der Verstand kann seiner Art nach die ungreifbare Wirklichkeit nicht erfassen, sondern nur seine eigenen Konzepte, Abstraktionen und Deutungen des Erlebten festhalten, obwohl alle unsere Bewusstseinszustände und alle Erscheinungen vergänglich sind und unser Erleben genau besehen ein ständiges Sterben und Geborenwerden ist – denn was auch immer erscheint, es verschwindet quasi im selben Augenblick wieder, nur um neuer Erscheinung Raum zu geben.
Wir erfahren ein kontinuierliches Schwingen zwischen Form und Formlosigkeit, und doch erscheinen Leben und Sterben unserem dichotomischen Denken als unversöhnliche Gegensätze; und an dem einen haftend, fürchten wir das andere. An dem einen festhaltend, entgeht uns das andere. »Sein oder Nichtsein?«, fragt unser Bewusstsein, denn die übergegensätzliche Einheit von Wahrnehmung und Leerheit kann es nicht erfassen. Seine Funktion ist es, die Dinge auseinanderzuhalten und einzuordnen. Das Bewusstsein lebt in seiner eigenen virtuellen Welt von Namen und Vorstellungen und hält an seinen reduktionistischen und einseitigen Überzeugungen und Begriffen als empirische Wirklichkeit fest.
Hier liegt also eine grundlegende Verwechslung vor, die weitreichende negative Folgen hat, denn wenn die Prämisse falsch ist, sind auch die daraus gezogenen Schlüsse falsch. Daraus ergibt sich eine Kette von Fehlwahrnehmungen. Das denkende Bewusstsein lebt in einem Traum von Fassbarkeit und Pseudowissen, der zwar mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt, aber sprachlich und gedanklich von der Mehrheit der Menschen immer wieder formuliert und als gemeinsames Erleben geteilt wird. Die Glaubenssätze oder geistig-seelischen Konstrukte einer Person sind deshalb auch immer kontextuell in der Verbindung mit seiner Familie und Gesellschaft zu untersuchen, um ihre Textur zu verstehen und sie, falls nötig, lösen zu können.
Je mehr wir an Formen und am Körper haften und uns mit diesen identifizieren, umso mehr fliehen und verabscheuen wir deren Auflösung, als ob es unsere eigene wäre. Dasselbe gilt auch für das Selbstbild und für alles, was unser Bewusstsein als Bleibendes fixiert und »verbegrifflicht«.
Unsere Anhaftungen trüben unseren Blick und verhindern die unmittelbare Schau des Gegebenen, und deshalb definierte Sokrates, genauso wie christliche, buddhistische, hinduistische und taoistische Meister, das philosophische Leben, das Leben eines Menschen, der die Wahrheit liebt und ihr gemäß leben möchte als ein ständiges Sterben, ein ständiges Loslassen, das ihn schließlich von aller Bindung und Beschränkung des Körpers und des Geistes befreien wird, wenn er in einem Vergessen alles Geschaffenen sich selbst schließlich ganz der göttliche Weisheit überlässt.
Sokrates antwortete der unfassbaren Natur der Wirklichkeit entsprechend, indem er sagte: »Ich weiß, dass ich nichts weiß.«

Es ist erfreulich und ein gutes Zeichen, dass seit einiger Zeit überall auf der Welt und vor allem in den nun seit Langem von einer positivistischen und materialistischen Sichtweise in Philosophie und Wissenschaft geprägten westlichen Gesellschaften parallel zu den beschriebenen Entwicklungen aber auch eine Fülle von Büchern über Tod, Sterbebegleitung und verwandte Themen erschienen sind und erscheinen. Ein starkes Interesse an Spiritualität und authentischer Selbsterkenntnis ist im Menschheitsbewusstsein entstanden und findet seine Antwort in einer Fülle von Publikationen, die die Weisheitslehren der verschiedensten Traditionen zugänglich machen. Die Bandbreite reicht hier von esoterischen Privatoffenbarungen und Lebensratgebern für »Glückssucher« bis hin zu klassischen Texten der Weisheitsliteratur der Welt und höchsten Belehrungen und Schriften bis heute ungebrochener Übertragungslinien vom Meister auf den Schüler, wie wir sie vor allem im tibetischen Buddhismus finden. Dieser hat mit seiner großen Wertschätzung der schriftlichen und mündlichen Überlieferung die weltweit umfangreichste Literatur über buddhistische Psychologie, ihre Therapien und Meditationstechniken und über Thanatologie (das Wissen vom Sterben und vom Tod) bewahrt und hervorgebracht. Die darin gelehrten Anweisungen werden auch heute noch weitergegeben und präzise in der persönlichen Geistesschulung und in der Sterbebegleitung angewendet.
Selbst seit über vier Jahrzehnten in der Nachfolge von tibetischen Meistern des Mahamudra und des Dzogchen stehend, bin ich voll Dankbarkeit für die unschätzbaren Lehren, die ich von ihnen erhalten habe. Dasselbe gilt natürlich auch für meine Lehrer im Zen-Buddhismus und im Theravada. (In den Literaturhinweisen im Anhang dieses Buches findet sich eine Auswahl von Büchern, die ich zu einem weiteren Studium empfehlen kann.)

Wenn ich in den Kapiteln dieses Buches über Leben und Sterben, über Bindung und Erlösung, über Zeitgeist und Erleuchtungsgeist, über Irrtum und Wahrheit, über Körper, Psyche und Geist, über Luzidität und Unbewusstheit, über heilsame und unheilsame Manifestationen des Denkens, über Leid erzeugendes und von Leiden befreiendes Handeln spreche, so tue ich das im Gewahrsein der buddhistischen Lehre, dass alles Erkennen, Denken und Benennen der Traum des Geistes ist.
Insofern es Traum ist, ist all unser Erleben auch symbolisch, weil das Denken und Sinnen des Geistes sich als Wort, Gestalt und Situation darin zum Ausdruck bringt und sich, ganz seiner Artung und Qualität entsprechend, dabei verortet und versinnbildlicht. So ist ein jeder Seinsbereich, wie zum Beispiel die Menschenwelt, die karmische Vision der dort lebenden Wesen und wird durch ihr kollektives Denken, ihre Emotionen und Wünsche verändert und geformt. Ein jeder Geist erträumt sich seine Welt und ist, falls er mit Verstand begabt ist, mit der Deutung des Erlebten beschäftigt. Nun ist die Deutung mit dem Erlebten natürlich nicht identisch, prägt aber als Annahme, als Vorurteil und mentales Konstrukt wiederum das weitere Erleben.
Es fällt leicht und ist normal, sich auf die eigenen Deutungen zu fixieren und ihren relativen Charakter zu vergessen. Weil aber der erkennende Geist von seinen eigenen Gedanken und Beschreibungen nicht erfasst werden kann, ist es äußerst sinnvoll, zwischen dem Geist an sich als absoluter Wirklichkeit (Natura naturans) und seinen Erfahrungen und Formulierungen als relative Wirklichkeit (Natura naturata) klar zu unterscheiden. Diese provisorische gedankliche Unterscheidung entspricht natürlich nicht der nondualen Wirklichkeit, sie dient im Buddhismus nur dazu, das Spiel der Wahrnehmung erkenntnistheoretisch zu verstehen.
Worte sind Träger des Sinns und haben lediglich eine hinweisende Funktion, denn nichts von dem, was gesagt werden kann – sei es eine Dummheit, eine mathematische Formel, eine Ideologie, Theologie oder Philosophie –, besitzt eine eigene Wirklichkeit unabhängig vom Geist, der es formuliert und wahrnimmt. Selbst die Buddha-Lehre, die mit immer denselben und immer verschiedenen, der Situation der Hörer angepassten Worten darauf hinweist, dass wir gerade träumen, ist insofern ein Traum im Traum.
Wenn wir träumen, erfahren wir die vielfältigsten Erscheinungen und halten sie für wirklich, doch wenn wir erwachen, verfliegt der Traum, und wir erkennen, dass alles nur in unserem eigenen Geist geschah. Und genauso ist es, so lehrte der Buddha, mit jeder Erfahrung im Universum: Sie erscheint, ist erlebbar, und doch ist sie nichts anderes als der eigene Geist, der sich auf diese Art in sich selbst spiegelt und erfährt. Dies deutlich und ohne Unterbrechung zu erkennen ist Erleuchtung oder völlige Luzidität.
Wenn wir einen Albtraum haben und im Traum leiden, so hat dies zwar seine Gründe in unserem Unterbewusstsein, aber trotzdem werden wir von diesem leidvollen Erfahren in dem Augenblick frei sein, wenn wir erwachen oder wenn wir luzide werden und erkennen, dass es nur ein Traum war.
Das Leid in unserem Traum des Lebens, durch Unwissenheit um die wahre Natur der eigenen Erfahrungen begründet, besteht leider weiter, solange diese Unbewusstheit nicht durch das Erlangen einer vollen, alle Schichten durchdringenden Luzidität oder Erleuchtung abgelöst worden ist.
Der Ausdruck »Luzidität« wurde im Bereich der Medizin und Psychologie bisher einerseits für die Klarheit des normalen Bewusstseins, also für die geistige Präsenz, Wachheit, Ansprechbarkeit und Orientierungsfähigkeit einer Person, verwendet und andererseits für den besonderen Zustand einer gesteigerten geistigen Klarheit im Traumerleben, in dem man sich bewusst ist, dass man träumt. »Luzidität« ist also ein Begriff für Geistesgegenwart und Präsenz, welche, wie die Intelligenz oder das »Helle-Sein« des Geistes einer Person, durchaus geringere und höhere Grade ihrer Entwicklung kennt und in den uns erlebbaren Bewusstseinszuständen entweder kontinuierlich präsent ist, sporadisch erlebt wird oder völlig fehlt wie im Tiefschlaf. In all diesen Erlebnisformen und auch im Sterben und im Nachtodzustand ist Vollbewusstheit oder besser völlige Luzidität erreichbar.

Die leuchtende, erkennende Klarheit des Geistes ist Basis sowohl für das Erkennen einfachster Zusammenhänge und koordinierter Wahrnehmung wie auch für das intuitive Verstehen der wahren Natur von Selbst und Welt und für übersinnliche Erfahrungen wie Telepathie und Präkognition (Vorauswissen).
Wie am Beispiel des möglichen Erlangens von Luzidität im Traum ersichtlich wird, kann und soll unsere geistige Klarheit weiterentwickelt werden und nach und nach alle Schichten bewusster und unbewusster Erfahrung durchdringen. Wir nutzen, wie oft zu hören ist, bisher nur einen kleinen Teil unseres Gehirns – und leider nutzen wir auch nur einen kleinen Teil unseres Herzens, unserer Empathiefähigkeit. Nur ein kleiner Teil des unbegrenzten Potenzials unseres Geistes und seiner Erkenntnismöglichkeiten, ein kleiner Teil der Weisheit und der Liebe, die in uns ist, konnte sich bis jetzt offenbaren.
»Lass den Buddha heraus, der in dir steckt«, so sagt man im Zen. Wer seine geistige Klarheit, die in ihm angelegte Fähigkeit zu einer gesteigerten Luzidität und Achtsamkeit entwickelt, kann das Dunkel der Unbewusstheit durchdringen und sich von der Beschränkung durch eingefahrene Denkstrukturen und subliminale Gewohnheitsmuster, von Konditionierungen und imaginierten Zwängen befreien, indem er durch direkte, nichturteilende Beobachtung deren vergängliches und damit unwirkliches Wesen erkennt. Die konstruktivistische Psychologie geht, in diesem Punkt im Einklang mit der 2400 Jahre alten Bewusstseinslehre des Buddhismus, davon aus, dass wir als Menschen eigentlich nie von absoluter oder auch objektiver Wahrheit denken oder sprechen können, sondern nur von der Art unseres Erkennens, von unserer Art, das Gegebene zu erfahren.
Dass die Dinge nicht von selbst erscheinen, sondern ihre Erscheinung erst vom erkennenden Subjekt mit seinen Anschauungsformen Zeit und Raum produziert wird, sagte auch Kant, aber er versteht diesen Satz anders als der Buddha und folgert anderes daraus. Er ist ein Philosoph der Aufklärung. Er hatte zwar den fiktiven Charakter menschlicher Begriffsbildung und sinnlicher Anschauung erkannt, verstand es aber dann in dem Sinn, dass die äußere Welt davon unabhängig existiere. Ähnlich wie Descartes verfestigte er damit denkerisch ein Subjekt und ein Objekt in der Wahrnehmung, trennte sie voneinander und lieferte so die Prämissen für das sogenannte wissenschaftlich-positivistische Denken, in dem in der Folge die fixe Idee einer klinisch sauberen entmenschlichten »Empirie« – nämlich die Idee, man könne das Wesen der Natur erkennen, wenn man möglichst so tue, als gäbe es keinen Erkennenden – größte Bedeutung gewann. Die übliche Definition der wissenschaftlichen »Empirie« ist eine Erkenntnis, die nicht von einer Theorie oder Begriffen beeinflusst ist, sondern auf Fakten beruht, die aus der Erfahrung gewonnen werden.
Nun gibt es natürlich keine Erfahrung ohne ein erfahrendes Bewusstsein; und auch alle Messergebnisse sind nichts ohne jemanden, der sie deutet, aber man kaprizierte sich auf die Vorstellung einer unabhängig vom Betrachter existierenden »objektiven« Wirklichkeit.
Ging das vorher geltende theologische Denken von einem göttlichen Wesen und Geist als Schöpfer aller Dinge aus, so wurden im Paradigmenwechsel der Aufklärung zunehmend »Gott«, das Geistige, Transzendente, Unwägbare und dann auch das Seelische als nur subjektiv und erdacht diskreditiert, und die äußere Welt und ihre Verhältnisse wurden als allein wirklich und das Subjekt prägend gesehen. Man fiel also von einem Extrem in das andere. Vom naiven Glauben, dass ein unabhängig existierender, persönlicher Gott uns geschaffen hat und folglich für alles verantwortlich ist, verfiel man in den ebenso naiven Glauben, dass Bewusstsein aus Materie entstanden ist und eine unabhängig existierende Welt uns hervorgebracht hat und bestimmt. Vielen schien die zweite Hypothese sinnfälliger, war sie doch für eine grob sinnliche Wahrnehmung eher nachvollziehbar.
Begrenzte Vorstellungen über die Natur der Wirklichkeit
Im Dzogchen, dessen Theorie oder Anschauung per definitionem das leere Gewahrsein selbst ist, werden einseitige philosophische Positionen wie Theismus, Dualismus, Eternalismus, Positivismus, Materialismus oder Nihilismus »begrenzte Vorstellungen über die Natur der Wirklichkeit« genannt. Den heute dominierenden, ursprünglich von Philosophen erdachten und formulierten Sichtweisen des Materialismus, Positivismus und Nihilismus sind das Vergessen des Aspekts des erkennenden Gewahrseins und das Sichverlieren an den Aspekt der Erfahrungen oder Anschauungen gemeinsam, insofern sie das von ihnen Erdachte für wirklich halten und daran festhalten. Auch die Idee des Primats der Materie ist nur eine Idee. Das Wesen dessen, der über Gott und die Welt nachdenkt, wurde dabei, wie vorher schon in der christlichen Theologie, zumeist übersehen. Nun entspricht jeder Anschauung und jedem Glauben ein adäquates Verhalten, und dieses bewirkt die daraus folgenden Früchte oder Resultate. Es gab und gibt Sichtweisen wie der Glaube an Karma (die ausgleichende göttliche Gerechtigkeit), die ein heilsames, verantwortliches Verhalten fördern; und es gibt solche, die zum Gegenteil tendieren. Dem naiven reduktionistischen Glauben zufolge existiert nur Messbares und Berührbares; er sagt, dass alles Leben nur aus Materie entstanden ist und dass der Mensch und alle Lebewesen mit ihrem Körper identisch sind. Aus ihm folgt, dass es nur ein Leben gibt und keine Seele, die den Tod des Körpers überlebt und die Früchte ihrer Handlungen ernten könnte.
Sind Beweise für die Richtigkeit dieser Auffassung auch nie erbracht worden, so sind doch ihre unheilsamen Folgen überdeutlich: Die gefühllosen Grausamkeiten, Massenmorde, Kindstötungen und rücksichtslosen Zerstörungen der Natur im 20. Jahrhundert sind von einem in der Menschheitsgeschichte bis heute ungekannten Ausmaß. An ihren Früchten können wir den Geist oder Ungeist hinter einer bestimmten Ideologie erkennen und unterscheiden. Auch das ist Empirie. Wollen wir eine bessere Welt, so müssen wir als Erstes unheilsame, Leiden erzeugende Arten des Denkens als Fehler erkennen, sie durch heilsame Gedanken ersetzen und darauf verzichten, die Urheber solch fataler Denkrichtungen nachträglich noch zu feiern.

Im Lankavatara-Sutra, einer buddhistischen Lehrschrift aus dem 3. Jahrhundert, heißt es, Mahamati, der Bodhisattva-Mahasattva, habe sich an den Buddha mit den Worten gewandt: »Du hast von den irrtümlichen Sichtweisen der Philosophen gesprochen; bitte erläutere uns diese und wie wir sie als solche erkennen können.«
Der Buddha sprach daraufhin, der Irrtum in den Lehren dieser Philosophen liege darin, dass sie nicht erkennen, dass die objektive Welt aus dem Geist entsteht. Sie verstünden auch nicht, dass alle Bewusstseinszustände aus dem Geist entstehen. Ausgehend von der Annahme, dass diese Manifestationen des Geistes wirklich sind, führen sie damit fort, diese zu unterscheiden. Sie kategorisierten sie in dualistische Begriffe wie dieses und jenes, Sein und Nichtsein, und sie ignorierten dabei die Tatsache, dass es nur eine einzige, alles umfassende Essenz gibt. Seine (Buddhas) Lehre hingegen basiere auf der Erkenntnis, dass die objektive Welt wie eine Vision – eine Manifestation des eigenen Geistes – sei, und sie lehre, wie Unwissenheit, Begehren und Aversion beseitigt werden können und wie Ursache und Wirkung und alles Leid, das aus dem dualistischen Denken erwächst, ein Ende finden.

Alle Konzepte, Bedeutungen, Namen und Merkmale sind relativ – sind Abstraktionen. Sie entstehen abhängig von dem, der sie formuliert, und drücken den Stand seiner Erkenntnis oder Nichterkenntnis aus. Werden sie in der Philosophie benutzt, um das Wesen der Wirklichkeit aufzuzeigen, so kann sowohl ihre Formulierung wie auch das Verstehen des Sinngehalts notwendigerweise nur der mehr oder weniger großen Auffassungsfähigkeit und Intelligenz, der individuellen Konditionierung und dem Charakter, dem Wissenshintergrund und der Bewusstseinsstufe sowie der persönlichen Auswahl der philosophierenden oder studierenden Person entsprechen.
Hieraus ergibt sich, dass die genaueste und umfassendste Darstellung der Wahrheit oder Wirklichkeit nur vonseiten eines Wesens gegeben werden kann, das sich von den Schleiern des konzeptuellen Denkens und der Störgefühle bereits gereinigt hat, also von dem, was wir »einen Buddha« oder ein »völlig erwachtes Wesen« nennen. Die Buddhas haben die Ursachen des Leidens der Menschen und aller fühlenden Wesen und den Weg zu deren Beseitigung und zu dauerhaftem Glück klar erkannt und aufgezeigt, doch die meisten Menschen ziehen es vor, weiterzuträumen und sich ihr eigenes Weltbild auszudenken, wobei sie zumeist die gerade dominierenden Vorstellungen ihrer Gesellschaft spiegeln. Damit bleiben sie leider im dualistischen Denken befangen und üben sich nicht darin, dieses zu überschreiten. Doch ohne die Fähigkeit, das Denken zu überschreiten, kann man seine Funktionsweise und seine Wunder nicht verstehen. Man bleibt im Käfig der eigenen Begriffe gefangen.
Was hier gemeint ist, kommt zum Ausdruck in dem enigmatischen Satz eines Zen-Meisters des 9. Jahrhunderts: »Wenn du verstehst, dass der Geist nicht Geist ist, verstehst du den Geist und seine Werke.«
Das heißt, wenn wir die absolute, leere und klare Natur des Geistes in der Kontemplation, in der »Unio mystica«, »erfahren« haben, verstehen wir intuitiv auch die Wunder seiner Erscheinung. Wir verstehen dann die Lehre im Herzsutra: »Erscheinung ist Leerheit, und Leerheit ist Erscheinung.«

Wenn wir den Begriff der »Luzidität« im Kontext einer konstruktivistischen Psychologie und Verhaltenstherapie verwenden, so steht er hier für einen Zustand gesteigerter Geistesklarheit, in dem wir nicht nur unserer Wahrnehmungen gewahr sind, sondern uns auch darüber klar sind, dass alle gedanklichen Vorstellungen, die wir über uns selbst als »den Wahrnehmenden« und über »unsere Wahrnehmungen« gebildet haben und bilden, nichts anderes sind als ebendas: unsere eigenen Vorstellungen und Interpretationen des Erlebten. Sich hierüber klar zu werden ist schon sehr viel, und aus dieser Erkenntnis entsteht sehr wahrscheinlich dann die Bereitschaft in uns, jede Vorstellung, die wir uns von uns selbst und von der Welt gemacht haben, systematisch infrage zu stellen, zum Beispiel indem wir häufig zu ergründen versuchen: »Wer ist sich dieses Traums gewahr?« Diese Fragestellung ist besonders effizient, um zu einer verlässlichen Luzidität zu kommen, denn mit dem ersten Teil des Satzes, also »Wer …?«, ziehen wir das »Ich« und jedes »Selbstbild« in Zweifel, und mit dem zweiten stellen wir die »objektive Wirklichkeit« der Welt infrage, indem wir affirmieren, dass all unser Erleben die Natur eines Traums hat. In Richtung auf die fiktionale Natur des menschlichen Denkens und Erkennens räsonierte ja auch die Erkenntnistheorie des Philosophen Kant und die von Descartes, und Letzterer ahnte in seinen Überlegungen zum sogenannten »Traumargument«, dass es in jeder Erlebnisform und Wahrnehmung im Schlafen und Wachen eigentlich unmöglich ist nachzuweisen, dass das Erlebte nicht ebenfalls Teil unseres Traumes ist.
Leider verblieben beide schlussendlich in einer dualistischen Sichtweise, die letztlich nur das Subjektive diskreditierte und das Objektive als davon unabhängig existierend affirmierte. Descartes identifizierte sich so sehr mit seinem Denken, dass er sein Sein als davon abhängig definierte, indem er zu dem Schluss kam: »Ich denke, also bin ich.«
Descartes wird mit Recht als Vorläufer der modernen Philosophie betrachtet. Wo der Geist nur philosophiert, aber nicht fähig ist, das eigene Denken zu »über-schreiten«, kann er die antinomische Natur des Denkens auch nicht transzendieren – und folglich die übergegensätzliche Natur des Geistes nicht realisieren.

Die buddhistische Philosophie und Psychologie wuchs aus der direkten Beobachtung von Körper und Geist – aus einer unmittelbaren empirischen Beobachtung, die durch ein rigoroses Beiseitelassen von Konzepten vermeiden konnte, die Beobachtung mit den eigenen konzeptuellen Prämissen zu kontaminieren. Sie beschreibt das Wesen des »Geistes« oder des »Lebens« als die prinzipielle Untrennbarkeit von Gewahrsein und seinen Erscheinungen oder Erfahrungen, die nur scheinbar, eben wie in einem Traum, auseinandertreten, um das Spiel der Selbstwahrnehmung des Geistes überhaupt zu ermöglichen.
Dem Buddha nach ist das Wesen des »Wahrnehmenden« und der »Dinge« an sich und in sich unerkennbar – aber was heißt das? Es ist unerkennbar, weil in Wirklichkeit das »allumfassende« große Ganze eins ist, weil das gesamte Universum ein einziger lebendiger Geist ist. Alles Erkennen vollzieht sich also innerhalb des Geistes und ist niemals wirklich von ihm getrennt, sondern nur in seiner eigenen Vorstellung.
Wie gesagt: So wie wir luzide geworden sind im Traum, diesen als unseren eigenen Traum erkennen, so erkennen wir luzide geworden im Wachzustand den konzeptuellen Prozess der Vorstellung, der das fließende Erleben der meisten Menschen fast immer begleitet, als unsere eigene Vorstellung und Projektion. Luzide geworden, halten wir unseren eigenen Traum nicht mehr für eine von uns unabhängige Wirklichkeit, und ebenso halten wir die Vorstellungen, die wir von den »Dingen« haben, dann nicht mehr für eine objektive, von uns unabhängige, eigenständige Wirklichkeit.
Es versteht sich wohl von selbst, dass diese Art durchschauender Luzidität und diese nichturteilende Achtsamkeit und Freiheit von Gedanken einer systematischen Geistesschulung und Einübung bedürfen, um schließlich zu einer gewissen Stabilität des Ruhens in einem Zustand reinen, luziden Gewahrseins gelangen zu können. Solange wir noch nicht völlige Freiheit von Gedanken erlangt haben, sind wir auch nicht völlig frei von möglicher Projektion und Übertragung.
Eine einsichtsvolle Zurückhaltung in Bezug auf den Hochmut des Denkens, Benennens und Urteilens, wie sie aufleuchtet im Wort des Angelus Silesius: »Ich weiß nicht, was ich bin, und ich bin nicht, was ich weiß«, ist also immer angebracht. Stillesein, Rezeptivität, Einfühlungsvermögen, Nichturteilen und Zuhörenkönnen sind Qualitäten der klar erkennenden Natur des Geistes, die das Wesen der Dinge intuitiv und nonverbal unterscheiden und verstehen kann.

Wenn ein Therapeut sich selbst vergessen und sein Rat und Hilfe suchendes Gegenüber so ohne Vorbehalte und Vorwissen annehmen und empfangen kann wie ein leerer und klarer Spiegel, so sind die idealen Voraussetzungen für eine einfühlsam-mitfühlende, intuitive Erkenntnis des imaginären Problemzusammenhangs seitens des Therapeuten und für ein vertrauendes Sichöffnen, befreiendes Erkennen und Loslassen seitens des Hilfesuchenden gegeben. Mit nichturteilendem Gewahrsein werden die psychischen Probleme des Gegenübers zwar mitfühlend als wirksam anerkannt und betrachtet, aber es wird ihnen keine Wirklichkeit zugestanden, indem man sie weiter konzeptualisiert und mit Aufmerksamkeit auflädt. Entsprechend dem wundervollen Diktum des Mahasiddha Tilopa – »Wisse, mein Schüler, nicht die Erfahrungen binden dich, sondern nur dein Anhaften an ihnen« –, kann sowohl die Vergänglichkeit eines jeden gedanklichen Konstrukts aufgezeigt werden wie auch die Möglichkeit, einschränkenden, selbstreferenziellen Vorstellungen und Strukturen keine Aufmerksamkeit mehr zu widmen und die Aufmerksamkeit stattdessen auf heilsame, selbsttranszendierende Ideen zu lenken.

Der Gordische Knoten einer Problemvorstellung muss und kann nicht auf derselben Bewusstseinsebene gelöst oder durchschnitten werden, auf der er geflochten wurde. Ich möchte dies hier darauf beziehen, dass jeder illusionäre Knoten im Bewusstsein geflochten und im Unterbewusstsein festgehalten wird, seine Lösung aber liegt im Gewahrsein und in der entschiedenen Loslösung, dem Durchschneiden der problematisierenden Gedanken. Die intuitive Fähigkeit, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu finden, erübrigt lange Analysen, welche ja selbst neue Konstrukte sind. Dieses erlösende Wort kommt spontan aus einem freien und offenen Geist, es kommt vom Herzen, und es zeigt in der fiktiven, vom Denken immer wieder verdichteten, erdichteten Wand der jeweiligen Konstrukte auf die immer offene Tür, die übersehen wurde, weil die Aufmerksamkeit bisher unnötigerweise auf eine gedankliche Struktur oder Erinnerungsspur fixiert war. Es zeigt auf das in diesem Augenblick ganz offene, frische und heile Gewahrsein des in Gedanken und Gefühle verstrickten, Lösungen suchenden Menschen. Es zeigt direkt auf den Himmel, auf den Raum zwischen zwei Gedanken, der unsere wahre, ungeborene Natur ist, während alles andere immer fließend geboren wird und stirbt. »Nur das, was sich nicht verändert, ist wirklich«, so lehrten schon die Upanishaden. »Was ist es, das all dieser vergänglichen Erfahrungen gewahr ist?« Diese Fragestellung führt uns direkt zurück in unsere unvergängliche Mitte und in den Zustand der Luzidität.