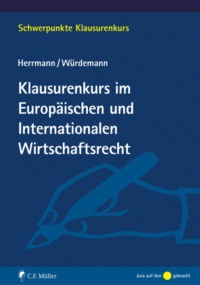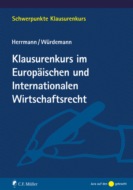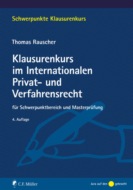Kitabı oku: «Klausurenkurs im Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrecht», sayfa 10
Fall 2 Wildschweinjagd im Binnenmarkt › Lösungsvorschlag
Lösungsvorschlag
Das Vertragsverletzungsverfahren hat Aussicht auf Erfolg, soweit es zulässig und begründet ist.
A. Zulässigkeit des Vertragsverletzungsverfahrens
I. Zuständigkeit des Gerichtshofes
129
Gemäß Art. 258 Abs. 2 bzw. Art. 259 Abs. 1 AEUV i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. a EUV ist für das Vertragsverletzungsverfahren der Gerichtshof der Europäischen Union (GHEU) zuständig. Der GHEU umfasst gemäß Art. 19 Abs. 1 S. 1 EUV den Gerichtshof, das Gericht sowie die Fachgerichte. Aus der Aufzählung in Art. 256 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1 AEUV ergibt sich, dass der Gerichtshof für Vertragsverletzungsverfahren zuständig ist. Gegenteiliges folgt auch nicht aus Art. 256 Abs. 1 UAbs. 1 S. 2 AEUV i.V.m. Art. 51 der Satzung des GHEU. Damit ist der Gerichtshof zuständig.
II. Beteiligtenfähigkeit
130
Die Voraussetzungen der Beteiligtenfähigkeit müssten vorliegen. Die Europäische Kommission ist gemäß Art. 258 Abs. 1 AEUV aktivlegitimiert, während die Mitgliedstaaten passivlegitimiert sind (sogenannte Aufsichtsklage). Nach Art. 259 Abs. 1 AEUV ist neben der Kommission auch jeder Mitgliedstaat aktivlegitimiert (sogenannte Staatenklage).
Vorliegend klagt die Kommission gegen den EU-Mitgliedstaat B, sodass es sich um eine Aufsichtsklage gemäß Art. 258 Abs. 1 AEUV handelt. Mit der Kommission als Klägerin sowie dem Mitgliedstaat B als Beklagtem sind die Anforderungen an die Beteiligtenfähigkeit erfüllt.
III. Klagegegenstand
131
Es müsste ein tauglicher Klagegegenstand vorliegen. Art. 258 Abs. 1 AEUV setzt einen Verstoß des betreffenden Mitgliedstaats gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen voraus. Aus dem Wortlaut der Norm ergibt sich, dass damit Verstöße sämtlicher staatlicher Einrichtungen des Mitgliedstaates gemeint sind. Erfasst sind zunächst vor allem primärrechtliche Pflichtverstöße. Entgegen dem Wortlaut des Art. 258 Abs. 1 AEUV ist aber auch ein sekundärrechtlicher Pflichtverstoß tauglicher Klagegegenstand.
Vorliegend erfolgt der Verstoß gegen Art. 34 AEUV seitens B möglicherweise durch das erlassene Verwendungsverbot von Nachtzielgeräten (NZGs) bei der Jagd gemäß § 19 BJagdG. Ein tauglicher Klagegegenstand liegt damit vor.
IV. Vorverfahren
132
Gemäß Art. 258 Abs. 1 AEUV müsste das vor Klageerhebung erforderliche Vorverfahren ordnungsgemäß (aber erfolglos) durchgeführt worden sein. Das Vorverfahren ist zweistufig und setzt ein Mahnschreiben der Kommission an den betreffenden Mitgliedstaat („Gelegenheit zur Äußerung“) sowie eine „mit Gründen versehene Stellungnahme“ der Kommission voraus.[1]
133
Hinweis:
Ausnahmen vom Erfordernis des Vorverfahrens i.S.v. Art. 258 AEUV finden sich in Art. 108 Abs. 2 AEUV (Anrufung des GHEU nach Feststellung einer unionsrechtlich unzulässigen Beihilfe), Art. 114 Abs. 9 AEUV (Anrufung des GHEU bei Missbrauch der mitgliedstaatlichen Befugnisse gemäß Art. 114 AEUV) und Art. 348 Abs. 2 AEUV (Anrufung des GHEU wegen Verfälschung der Wettbewerbsbedingungen aufgrund Maßnahmen gemäß Art. 346, 347 AEUV). Im Rahmen des Art. 126 Abs. 1 bis 9 AEUV (Haushaltsdisziplin) ist das Vertragsverletzungsverfahren gemäß Art. 258, 259 AEUV gar in Gänze ausgeschlossen.
1. Mahnschreiben der Kommission an B
134
Zur Eröffnung des Vorverfahrens müsste die Kommission die Regierung von B vorab gemahnt haben. Ein ordnungsgemäßes Mahnschreiben setzt voraus, dass die Kommission dem Mitgliedstaat schriftlich mitteilt, auf Grundlage welcher faktischen und rechtlichen Tatsachen sie den Vertragsverstoß annimmt. Zudem muss die Kommission die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens in dem Mahnschreiben ankündigen und dem Mitgliedstaat eine Frist zur Äußerung einräumen, die in der Regel zwei Monate beträgt.
Aus dem Sinn und Zweck des Mahnschreibens ergibt sich, dass dieses als erste, knappe Zusammenfassung der dem Mitgliedstaat vorgeworfenen unionsrechtlichen Verletzung dient und dass keine zu hohen Anforderungen an den Inhalt des Mahnschreiben gestellt werden dürfen.[2] Das Mahnschreiben legt zugleich den Streitgegenstand für das spätere Verfahren vor dem Gerichtshof fest, sodass eine nachträgliche Erweiterung des Streitgegenstandes weder im Rahmen der späteren Stellungnahme noch mit Klageerhebung erfolgen kann.[3]
Die Kommission hat B bezüglich des angeblichen Verstoßes gegen Art. 34 AEUV schriftlich gemahnt, ein Vertragsverletzungsverfahren angedroht und B eine zweimonatige Frist zu Äußerung gegeben. Die Voraussetzungen eines ordnungsgemäßen Mahnschreibens sind damit erfüllt.
2. Stellungnahme der Kommission vor Klageerhebung
135
Zudem müsste die Kommission vor Klageerhebung eine Stellungnahme abgegeben haben. Aus der Stellungnahme muss für den Mitgliedstaat zum einen hervorgehen, gegen welche konkreten unionsrechtlichen Bestimmungen der Mitgliedstaat verstoßen haben soll, zum anderen müssen die Tatsachen und Rechtsgründe hierfür benannt werden. Darüber hinaus muss die Stellungnahme gemäß Art. 258 Abs. 2 AEUV mit einer Frist versehen sein, die es dem Mitgliedstaat ermöglicht, die Unionsrechtsverletzung abzustellen, um ein Verfahren vor dem Gerichtshof zu vermeiden. Die Länge der Frist ist primärrechtlich nicht niedergelegt, soll aber so ausgestaltet sein, dass der betreffende Mitgliedstaat die Unionsrechtsverletzung tatsächlich abstellen kann, wobei regelmäßig zwei Monate genügen.[4]
Vorliegend hat die Kommission der Regierung von B eine mit Gründen versehene Stellungnahme übersandt (Zugang am 27.4.2017). Allerdings erfolgte diese ohne vorherige Äußerung von B in Bezug auf das Mahnschreiben. Dies könnte zur Folge haben, dass die Kommission im Rahmen des Vorverfahrens (noch) keine Stellungnahme erlassen durfte. Ein Mitgliedstaat könnte jedoch durch das Ignorieren des Mahnschreibens den Erlass der Stellungnahme und damit die zweite Stufe des Vorverfahrens verhindern. Es liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Mitgliedstaats, die Möglichkeit des rechtlichen Gehörs auch tatsächlich wahrzunehmen. Folglich ist es für die Zulässigkeit der Stellungnahme unerheblich, ob sich der betreffende Mitgliedstaat zum Inhalt des Mahnschreibens geäußert hat oder nicht. Entscheidend ist einzig, dass dem betreffenden Mitgliedstaat im Rahmen des vorherigen Mahnverfahrens Gelegenheit zur Äußerung eingeräumt worden ist. Die Kommission durfte daher die gegenüber B erfolgte Stellungnahme erlassen.
3. Zwischenergebnis
136
Das Vorverfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt.
V. Form und Frist
137
Die Klageschrift müsste die Formanforderungen gemäß Art. 21 Abs. 1 S. 2 EuGH-Satzung i.V.m. Art. 120 EuGH-VerfO erfüllen. Von der Erfüllung der erforderlichen Formvorgaben durch die Kommission ist auszugehen.
Bezüglich der Fristanforderung folgt aus Art. 258 Abs. 2 AEUV, dass die Kommission den Gerichtshof erst anrufen kann, wenn die Frist zur Beseitigung des Verstoßes abgelaufen ist. Die zweimonatige Frist begann mit Zugang bei der Regierung von B am 27.4.2017 und endete 27.6.2017. Somit konnte die Kommission am 14.7.2017 Klage erheben.
VI. Rechtsschutzbedürfnis
138
In Anbetracht der Aufhebung des § 19 BJagdG vor Klageerhebung ist allerdings möglicherweise das Rechtsschutzbedürfnis entfallen.[5] Der Wortlaut des Art. 260 Abs. 1 AEUV lässt jedoch erkennen, dass auch Erledigungskonstellationen mit dem Vertragsverletzungsverfahren verfolgt werden können. So verlangt die Vorschrift nicht, dass der Mitgliedstaat aktuell noch gegen Unionsrecht „verstößt“, sondern lässt einen bereits vergangenen Unionsrechtsverstoß durch einen Mitgliedstaat ausreichen – zumal der Gerichtshof lediglich ein Feststellungsurteil fällt. Hinzu kommt, dass das Vertragsverletzungsverfahren als objektives Beanstandungsverfahren kein subjektives Interesse der Kommission an der Feststellung eines Vertragsverstoßes verlangt, sondern vielmehr objektiv ansetzt.[6]
Mit der Aufhebung des § 19 BJagdG nach Ablauf der im Rahmen der Stellungnahme erfolgten Frist ist der mögliche Vertragsverstoß zwar ausgeräumt. Allerdings besteht auch weiterhin ein allgemeines Bedürfnis daran, die Unionsrechtswidrigkeit der Vorschrift festzustellen.
139
Hinweis:
Dagegen würde es an dem erforderlichen (objektiven) Rechtsschutzbedürfnis fehlen, sofern der Vertragsverstoß vor Ablauf der mit der Stellungnahme gesetzten Frist entfällt.[7]
140
Hinweis:
Darüber hinaus könnte man diskutieren, ob die hier vorliegende Erledigungskonstellation eines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses bedarf. In einem wie dem vorliegend gelagerten Fall bejahte der Gerichtshof das Bestehen eines „ausreichenden Rechtsschutzinteresses“.[8] In seiner Folgerechtsprechung etablierte der Gerichtshof die Voraussetzung eines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses.[9] Er legte für das besondere Rechtsschutzbedürfnis Fallgruppen fest (z.B. Wiederholungsgefahr des Verstoßes oder die besondere Bedeutung der dem Verfahren zu Grunde liegenden Rechtsfrage für die Union). Allerdings ist der Gerichtshof vom Erfordernis des besonderen Rechtsschutzbedürfnisses wieder abgerückt und lässt mittlerweile ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis genügen.[10]
VII. Zwischenergebnis
141
Das Vertragsverletzungsverfahren ist zulässig.
B. Begründetheit des Vertragsverletzungsverfahrens
142
Das Vertragsverletzungsverfahren ist begründet, soweit die B vorgeworfene Maßnahme objektiv gegen eine im Vorverfahren als verletzt gerügte Vorschrift des Unionsrechts verstößt. Das Verwendungsverbot gemäß § 19 BJagdG könnte gegen Art. 34 AEUV verstoßen.
I. Anwendbarkeit von Art. 34 AEUV
1. Keine unionale lex specialis
143
Spezielles, abschließend regelndes Sekundärrecht in Bezug auf die Verwendung von NZGs existiert nicht.
144
Hinweis:
Soweit ein Regelungsbereich durch das unionsrechtliche Sekundärrecht abschließend harmonisiert worden ist, erfolgt die Prüfung eines etwaigen Verstoßes einzig am Sekundärrecht, sodass es keines Rückgriffs auf die Grundfreiheiten als Teil des Primärrechts mehr bedarf. Das Sekundärrecht ist aber gegebenenfalls selbst auf die Vereinbarkeit mit dem Primärrecht zu überprüfen.
145
Exkurs:
Die Grundfreiheiten bewirken als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbote eine sogenannte „negative Integration“, während das Sekundärrecht aufgrund seiner harmonisierenden Wirkung zur „positiven Integration“ beiträgt.[11] Diese Differenzierung erklärt auch den oben geprüften Anwendungsvorrang des Sekundärrechts vor dem Primärrecht.
2. Sachlicher Anwendungsbereich von Art. 34 AEUV
146
NZGs müssten Waren i.S.v. Art. 28 Abs. 2 AEUV sein. Waren sind körperliche Gegenstände, die einen Geldwert haben und Gegenstand von Handelsgeschäften sein können. Dabei kommt es allerdings grundsätzlich weniger auf die Körperlichkeit als auf die Handelbarkeit im Verkehr an. Angesichts des vorliegenden NZG-Erwerbs durch J über einen Online-Händler sind NZGs unstrittig als Waren i.S.v. Art. 28 Abs. 2 AEUV einzustufen.
3. Grenzüberschreitender Bezug der eingeführten Ware
147
In Anbetracht des Wortlauts von Art. 34 AEUV („alle Maßnahmen (…) zwischen den Mitgliedstaaten“) müsste ein grenzüberschreitender Sachverhalt vorliegen.
Vorliegend kauft J über einen Online-Händler ein NZG aus dem EU-Mitgliedstaat A, um dieses in seinem Herkunftsland, dem EU-Mitgliedstaat B, zu verwenden. Ein grenzüberschreitender Sachverhalt ist damit gegeben.
4. Zwischenergebnis
148
Der Anwendungsbereich des Art. 34 AEUV ist eröffnet.
II. Eingriff
149
Es müsste ein Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit i.S.v. Art. 34 AEUV vorliegen. Dies ist der Fall, wenn es sich bei dem Verwendungsverbot gemäß § 19 BJagdG um eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung oder um eine Maßnahme gleicher Wirkung seitens eines Verpflichtungsadressaten handelt.
1. Maßnahme eines Verpflichtungsadressaten
150
Bei § 19 BJagdG müsste es sich um eine Maßnahme eines Verpflichtungsadressaten handeln. Die Grundfreiheiten richten sich unmittelbar an die Mitgliedstaaten, die Unionsorgane selbst und teilweise auch an Private. Als boarisches Gesetz ist § 19 BJagdG eine Maßnahme des EU-Mitgliedstaats B und damit eine Maßnahme eines Verpflichtungsadressaten.
2. Mengenmäßige Einfuhrbeschränkung i.S.v. Art. 34 AEUV
151
Eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung liegt vor, wenn die Einfuhr einer Ware ganz oder auch teilweise der Menge nach beschränkt wird. Das Verbot des § 19 BJagdG bezieht sich allerdings auf die Verwendung von NZGs auf Schusswaffen bei der Jagd, nicht auf deren zahlenmäßige Einfuhr. Somit wird die Einfuhr von NZGs nicht mengenmäßig beschränkt.
152
Hinweis:
Von einer mengenmäßigen Einfuhrbeschränkung wird etwa dann ausgegangen, wenn bestimmte Kontingente für die Einfuhr von Produkten festgelegt oder Durchfuhrverbote für eine Ware erlassen werden. Keine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung, sondern eine Maßnahme gleicher Wirkung stellen dagegen bestimmte Beschaffenheitsvoraussetzungen dar, die ein Mitgliedstaat für ausländische (wie auch inländische) Waren erlässt.
3. Maßnahme gleicher Wirkung i.S.v. Art. 34 AEUV
153
Fraglich ist, ob § 19 BJagdG eine Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung darstellt.
154
Hinweis:
Die Prüfung von Maßnahmen gleicher Wirkung i.S.v. Art. 34 AEUV erfolgt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs grundsätzlich dahingehend, ob eine Diskriminierung oder eine Beschränkung (i.S.d. Dassonville-Formel) vorliegt. Die Ausweitung des Anwendungsbereichs von Art. 34 AEUV durch die Dassonville-Formel hat der Gerichtshof durch die Keck-Formel als mögliche Tatbestandsausnahme wieder eingeengt. Mittlerweile hat sich der Gerichtshof von der Prüfung der Keck-Formel gelöst und führt eine sogenannte Dreistufenprüfung durch. Danach prüft der Gerichtshof das Vorliegen einer Maßnahme gleicher Wirkung i.S.v. Art. 34 AEUV anhand von drei Fallgruppen:[12] (1) Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot, (2) Missachtung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung (Vorliegen von produktbezogenen, unterschiedslos anwendbaren Vorschriften, nach denen Produkte bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, selbst wenn sie in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sind; produktbezogenes Beschränkungsverbot), (3) Marktzugangshindernis. Das Kriterium der Marktzugangsbehinderung ist damit eindeutig zum Leitprinzip der Eingriffsprüfung i.R.d. Art. 34 AEUV geworden. Darüber hinaus scheint die Dreistufenprüfung auch die Dassonville-Formel entbehrlich zu machen.[13]
Bislang ist das Verhältnis zwischen der Dreistufenprüfung und der Keck-Formel allerdings nicht abschließend geklärt und einzelne Kammern des Gerichtshofs verwenden weiterhin die tradierten Formeln. Daher kann von Studierenden nicht zwingend eine Dreistufenprüfung erwartet werden.
a) Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot
(erste Stufe der Dreistufenprüfung)
155
Das Verwendungsverbot könnte diskriminierend wirken. Das in den Grundfreiheiten enthaltene Diskriminierungsverbot erfasst Maßnahmen, die entweder unmittelbar bzw. offen an die Herkunft der Ware anknüpfen (de jure-Diskriminierung) oder typischerweise ausländische Waren betreffen (de facto-Diskriminierung bzw. verdeckte/indirekte Diskriminierung).
§ 19 BJagdG gilt jedoch weder ausdrücklich für NZGs aus bestimmten EU-Mitgliedstaaten noch betrifft die Vorschrift typischerweise NZGs aus dem EU-Ausland. Eine Diskriminierung ist daher nicht gegeben.
b) Missachtung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung
(zweite Stufe der Dreistufenprüfung)
156
§ 19 BJagdG verstößt möglicherweise gegen den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung. Danach sind Maßnahmen gleicher Wirkung i.S.v. Art. 34 AEUV solche Maßnahmen, die sich unterschiedslos auf in- und ausländische Waren beziehen und eine bestimmte Produktbeschaffenheit verlangen, obwohl das jeweilige Produkt in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellt und in den Verkehr gebracht worden ist.
§ 19 BJagdG gilt zwar unterschiedslos sowohl für in- als auch für ausländische NZGs, stellt allerdings keine bestimmten Voraussetzungen an deren Produktbeschaffenheit. Vielmehr verbietet die Regelung grundsätzlich die Verwendung von NZGs. Damit fällt das Verwendungsverbot nicht in die zweite Fallgruppe der Dreistufenprüfung des Gerichtshofs.
c) Verwendungsverbot als Marktzugangshindernis
(dritte Stufe der Dreistufenprüfung)
157
Fraglich ist, ob das Verwendungsverbot gemäß § 19 BJagdG eine Marktzugangsbehinderung darstellt. Welche konkreten Anforderungen an die Behinderung des Marktzugangs zu stellen sind, ist bislang durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes nicht eindeutig geklärt. Bisweilen qualifiziert der Gerichtshof die erforderliche Marktzugangsbeschränkung als „erheblich“[14] oder verlangt eine „starke“[15] Nutzungsbeschränkung. Sinn und Zweck des Kriteriums ist jedenfalls das „Herausfiltern“ solcher nationalen Maßnahmen, die sich erschwerend auf den Zugang eines Produkts zu dem jeweiligen mitgliedstaatlichen Markt auswirken.
§ 19 BJagdG verbietet nicht unmittelbar den Marktzugang von NZGs, sondern verbietet deren Verwendung in B. Die Vorschrift entfaltet ihre Regelungswirkung damit erst nach dem Marktzugang von EU-ausländischen NZGs. Allerdings reduziert die Absolutheit des Verwendungsverbots, die eine Verwendung durch Jäger ausschließt, das Erwerbsinteresse an NZGs regelmäßig so stark, dass auf dem boarischen Markt kaum eine Nachfrage bezüglich NZGs besteht.[16] NZGs sind ohne die Verwendung mit Schusswaffen nämlich nur in geringem Maße einsetzbar.[17] Das in § 19 BJagdG enthaltene Verbot macht die Einfuhr von NZGs nach B folglich in erheblichem Maße unattraktiv. Damit ist der Marktzugang für NZGs mit Bildwandler, die für Schusswaffen gebaut sind, erheblich erschwert. Das Verwendungsverbot gemäß § 19 BJagdG stellt ein Marktzugangshindernis dar.
158
Hinweis:
Alternativ kann auch weiterhin auf die Dassonville-Formel i.V.m. der Keck-Formel abgestellt werden:[18]
(…)
c) Vorliegen einer Beschränkung i.S.d Dassonville- Formel
Fraglich ist, ob § 19 BJagdG eine Maßnahme gleicher Wirkung i.S.v. Art. 34 AEUV darstellt. Nach der Dassonville-Formel ist jede mitgliedstaatliche Handelsregelung eine Maßnahme gleicher Wirkung i.S.v. Art. 34 AEUV, die geeignet ist, den innerunionalen Handel unmittelbar, mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern.[19]
§ 19 BJagdG sieht ein absolutes Verwendungsverbot von NZGs bei Schusswaffen für die Jagd vor. Infolgedessen wird die Nachfrage nach NZGs auf dem boarischen Markt verhindert und deren Einfuhr nach B zumindest mittelbar beeinträchtigt. § 19 BJagdG stellt damit eine Maßnahme gleicher Wirkung i.S.v. der Dassonville-Formel dar.
d) Voraussetzungen der Keck -Formel
Möglicherweise ist das Verwendungsverbot gemäß § 19 BJagdG als Maßnahme i.S.d. Keck-Formel vom Tatbestand des Art. 34 AEUV ausgenommen. Nach der Keck-Formel ist die Anwendung nationaler Bestimmungen auf Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten, die bestimmte Verkaufsmodalitäten beschränken oder verbieten, nicht geeignet, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten i.S.d. Dassonville-Rechtsprechung zu behindern, sofern diese Bestimmungen für alle betroffenen Wirtschaftsteilnehmer gelten, die ihre Tätigkeit im Inland ausüben, und sofern sie den Absatz der inländischen Erzeugnisse und der Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten rechtlich wie tatsächlich in gleicher Weise berühren.[20]
aa) Analoge Anwendung der Keck- Formel auf Verwendungsmodalitäten
Fraglich ist, ob die Keck-Formel entgegen ihres Wortlauts („Verkaufsmodalitäten“) auf die Fallgruppe der sogenannten Verwendungsmodalitäten erweitert werden kann.[21]
Dafür spricht, dass eine Trennung zwischen Verkaufs- und Verwendungsmodalitäten in vielen Konstellationen nicht eindeutig zu treffen ist. Dies rührt insbesondere daher, dass Verwendungsmodalitäten in zeitlicher Hinsicht ebenfalls erst nach der Einfuhr der Ware in den anderen Mitgliedstaat greifen und in Bezug auf die Art und Intensität ihrer Auswirkungen auf das Kaufverhalten des Verbrauchers Verkaufsmodalitäten ähneln.[22] Damit ist die Keck-Formel auf Verwendungsmodalitäten übertragbar.
Der Gerichtshof hat sich – im Gegensatz zu den Schlussanträgen von GAin Kokott – nicht zur Übertragung der Keck-Formel auf Verwendungsmodalitäten geäußert, sondern stellte allein darauf ab, inwiefern die betreffende Maßnahme eine Markzugangsbeschränkung darstellte.
bb) Anwendung der Keck-Kriterien auf den vorliegenden Fall
Fraglich ist allerdings, ob das vorliegende NZG-Verwendungsverbot überhaupt eine Verwendungsmodalität darstellt. In Anlehnung an den Begriff der Verkaufsmodalität (als vertriebsbezogener Maßnahme in Abgrenzung zur produktbezogenen Maßnahme) ist auch die Verwendungsmodalität durch einen geringen Marktzugangsbezug geprägt.
Vorliegend besteht aufgrund des absoluten Verwendungsverbotes allerdings eine starke Verwendungseinschränkung, die sich mittelbar auf den Marktzugang von EU-ausländischen NZGs auswirkt. Das in § 19 BJagdG enthaltene Verbot macht die Einfuhr von NZGs nach B damit in erheblichem Maße unattraktiv und erschwert deren Marktzugang. Das Verwendungsverbot gemäß § 19 BJagdG ist damit nicht lediglich eine (Verwendungs-)Modalität.
cc) Zwischenergebnis
Eine Tatbestandsausnahme i.S. der Keck-Formel analog bezüglich des NZG-Verwendungsverbotes scheidet damit aus.