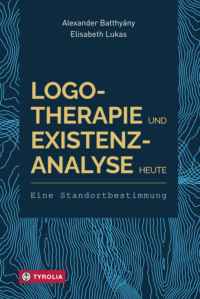Kitabı oku: «Logotherapie und Existenzanalyse heute», sayfa 4
2. DOKTRINÄRE FÜGSAMKEIT
Batthyány: Ja, wie Sie sagen, ist nicht nur das Selbstbild, sondern auch das Menschenbild ein entscheidender Faktor für die Art und Weise, wie wir der Welt und anderen Menschen begegnen. Es gibt auch dazu empirische Befunde, die mit demselben experimentellen Paradigma wie die oben beschriebenen Studien die Wechselwirkung von dem Glauben an Willensfreiheit und Dankbarkeit bestätigen. Um das kurz zu fassen: Menschen, die an die Wahl- und Willensfreiheit glauben, empfinden, wenn sie sich an Situationen erinnern, in denen ihnen jemand geholfen oder sich großzügig gezeigt hat, signifikant mehr Dankbarkeit als jene, die nicht an die Willensfreiheit glauben. Im Prinzip ist auch dieser Befund relativ leicht erklärbar – Deterministen sehen die „Ursache“ des großzügigen Verhaltens eines Dritten nicht in seiner freien persönlichen Entscheidung, sondern in unbewussten oder anderen nicht steuerbaren Einflussfaktoren begründet. Daher werten sie auch die persönliche Leistung der Großzügigkeit ab – warum auch jemandem sonderlich danken, der ohnehin „nicht anders konnte“ als eben so zu handeln, wie es die jeweiligen Determinanten vorgegeben haben? Wir sehen also: Wir haben es hier mit durchaus sozial- und alltagsrelevanten Wirkungen des Glaubens oder Nichtglaubens an die eigene Willensfreiheit bzw. des Selbst- und Menschenbilds insgesamt zu tun.
Wie subtil und tiefgreifend solche Effekte sind, zeigt sich allerdings auch daran, dass sie nicht nur im Bereich der bewussten steuerbaren mentalen Funktionen wirken und keineswegs nur das Problem der Willensfreiheit betreffen. Andere Untersuchungen haben etwa nachgewiesen, dass Patienten orthodoxer Psychoanalytiker überzufällig häufig von klassisch psychoanalytischen Traumthemen wie sexuellen Symbolen berichten, wohingegen Patienten klassischer Individualpsychologen Träume produzieren, in denen es „theoriegerecht“ um Selbstbehauptung, Geltungsstreben und Gruppendynamik geht. Und Patienten von Jungianern träumen signifikant oft von archetypischen und mythischen Figuren. Man nennt dieses bemerkenswerte Phänomen „doktrinäre Fügsamkeit“.28
Nun enden diese Wechselwirkungen zwischen Selbst- und Menschenbild auf der einen Seite und Erleben und Verhalten auf der anderen Seite keineswegs in den eben besprochenen Phänomenen selbst. Vielmehr beschreiben beide Befunde, jene zur Frage der „geglaubten Willens(un)freiheit“ ebenso wie die zur „doktrinären Fügsamkeit“ darüber hinaus einen sich fortwährend selbst verstärkenden Prozess. Das ist leicht nachzuvollziehen: Denn natürlich bestätigt das Erleben und Verhalten indoktrinierter Personen denjenigen, der aus den Beobachtungen ihres Erlebens und Verhaltens psychologische Modelle und Theorien abzuleiten versucht. Wenn also Versuchspersonen bewusst oder unbewusst Erwartungseffekte des Forschers oder Therapeuten erfüllen, dann liefern sie zugleich ja auch in hohem Maße theoriebestätigende Daten; und je mehr diese Daten die Theorie bestätigen, desto sicherer wird der jeweilige Forscher oder Therapeut sich fühlen, dass seine Theorie stimmt. Und je sicherer er sich fühlt, desto eher und stärker wird er seinerseits Erwartungseffekte evozieren.
Dieser sich selbst verstärkende Prozess macht die experimentelle Psychologie natürlich massiv artefaktanfällig.29 Vermutlich erklärt dieser Rückkoppelungsprozess auch einen Großteil der widersprüchlichen Befunde einzelner psychologischer und psychotherapeutischer Schulen – selbst wenn bei ihren Messungen methodisch sauber gearbeitet wird, was wir einmal voraussetzen wollen. Die Psychologiegeschichte besteht ja zu einem gar nicht so geringen Anteil aus einem Katalog an Modellen und Theorien, die sich zumindest eine Zeit lang bestätigen und bestätigten, obwohl wir zugleich aus der Forschung wissen, dass sie gar nicht gültig oder haltbar waren oder sind. Und in dem Zusammenhang fällt dann meist auf, dass diese Befunde nur von jenen Arbeitsgruppen erfolgreich wiederholt werden, die von der Richtigkeit dieser Modelle und Theorien hinreichend überzeugt sind, von anderen aber nicht (daher gilt ja auch die unabhängige Wiederholung als Goldstandard der Forschung). Kurz: Es ist anzunehmen, dass (neben einer unsauberen Methodologie) die genannten Rückkoppelungs- und Erwartungseffekte bei dem Bestätigungsphänomen obsoleter psychologischer Theorien eine Rolle spielen.
Abgesehen vom „Schulenstreit“ und der Artefaktanfälligkeit der psychologischen Forschung scheint mir jedoch noch wichtiger, auf die praktischen, sozialen und auch moralischen Implikationen der hier besprochenen Querverbindungen hinzuweisen. Fügt man nämlich all dieses Wissen zusammen, dann wird einem die Verantwortung, aber auch die Aufgabe (insbesondere des Logotherapeuten) bewusst, gegenzusteuern gegen eine Verkennung des Menschen. Frankl selbst ist immer wieder gegen den Reduktionismus, gegen eine egozentrische Psychologisierung und gegen den wachsenden Nihilismus gerade in den Wohlstandsgesellschaften aufgetreten und hat den Menschen verteidigt gegen jedweden Versuch, ihn „schlechter zu machen, als er ist“.
Lukas: Es ist eine blendende Idee von Ihnen, zwischen den Auswirkungen und den Entstehungen von Menschenbildern einen „circulus vitiosus“ zu wittern. In der Tat verhalten wir Menschen uns gemäß unseren Selbstbildern und unserem Selbstverständnis, und dieses unser Verhalten wird dann zum bekräftigenden Beweis jener Bilder und jenes Verständnisses, die Wissenschaftler (und andere Führungspersonen, z. B. Religionsvertreter) uns Menschen zuordnen. Vermutlich gibt es gar keinen Ausstieg aus diesem Zirkelprozess. Es gibt nur Veränderungen, die entweder an einem allmählichen Verhaltenswandel vieler Menschen ansetzen – und damit Veränderungen im populären Menschenbild nach sich ziehen, oder an einem allmählichen (Selbst-)Bewusstseinswandel vieler Menschen ansetzen – was sich modulierend auf ihr Verhalten auswirkt. Auch Zirkelprozesse sind dem „Panta rhei“ unterworfen.
Nun ist die Frage der gezielten suggestiven Beeinflussung, wie gesagt, uralt, allgegenwärtig und im Zeitalter der totalen Vernetzung aktueller als jemals zuvor. Wer hätte sich noch vor 60 Jahren vorstellen können, dass man Menschenmassen vom Schreibtisch aus per Mausklick mobilisieren, ja, sogar radikalisieren kann, etwas Bestimmtes zu tun oder zu glauben? Dass man Werbekampagnen für oder gegen Kaufartikel, Parteien, Volksangehörige, Weltanschauungen etc. durch den Äther schicken kann mit drastischen Konsequenzen? Denn nicht nur das Bild, das wir uns über uns selbst machen, dirigiert unser Verhalten, sondern auch das Bild, das wir uns über gewisse Personengruppen machen (siehe „Mutterbild“), steuert unseren Umgang mit jenen Personengruppen, was schon Despoten von Herodes bis Hitler ausgenutzt haben. Nicht umsonst hat Frankl nicht nur vor dem Psychologismus (problematisches eigenes Menschenbild), sondern auch vor dem Kollektivismus eindringlich gewarnt, der seinen Spuk mit problematischen Fremdbildern treibt.
3. UNTER DEM STERNENHIMMEL SICH UND DEM LEBEN NEU BEGEGNEN
Batthyány: Damit wird aber auch die Frage aufgeworfen: Was kann und soll die Logotherapie hierzu ausrichten – wie kann sie hier beitragen, um heilsam und korrigierend zu wirken? Natürlich kann – und soll sie wohl – aktiv am öffentlichen Diskurs über den Menschen teilnehmen, und tut das ja auch seit jeher. Ich möchte die Frage aber gerne konkreter mit Blick auf die Psychohygiene und Psychotherapie, also die Korrektur eines problematischen eigenen Menschenbilds, stellen.
Lukas: Ich denke, dass sich die Logotherapie vor dem Fehler hüten muss, eine Doktrin mit einer anderen zu bekämpfen. Als sich Frankl von der ersten und zweiten Wiener Schule der Psychotherapie abzugrenzen und eigene Wege zu beschreiten begann, war es für ihn notwendig, den gängigen reduzierten Menschenbildern ein vollständigeres entgegenzuhalten. Aber wir wissen aus anderen Zusammenhängen, dass der Versuch einer Gegeneinflussnahme nicht viel besser ist als die Einflussnahme, gegen die sie opponiert. Oder, wie ich meinen Patienten zu sagen pflegte: „Auch der umgedrehte Spieß ist ein Spieß“. Lässt sich eine Frau zum Beispiel jahrelang von ihrem Mann anschreien und demütigen, und gelingt es ihr dann endlich, sich auf die eigenen Füße zu stellen, zurückzuschreien und zurückzudemütigen, so hat sie sich damit noch lange nicht weiterentwickelt. Sie hat zwar gelernt, sich zu verteidigen, und wenn etwas daran gut ist, dann hat sie gelernt, sich auf ihre Würde zu besinnen, aber ansonsten hat sie sich exakt auf der Stufe verhakt, auf der ihr Mann steht, und kein Höckerchen höher. Erst wenn sie gewaltlos und in authentischer Gelassenheit seine Exzesse abwehren oder ignorieren oder belächeln oder ihnen ausweichen kann, erst wenn sie sich ohne Verteufelung ihres Mannes ein für sie beide günstiges Verhaltensrezept erarbeiten kann, ist sie wirklich um etliche Stufen höher aufgestiegen.
Analog ist es nicht die optimale Aufgabe eines Psychotherapeuten, seine negativ indoktrinierten Patienten gegenzuindoktrinieren, auch nicht zu ihren Gunsten. Man macht das zwar hin und wieder, um größeres Übel zu verhindern. Frankl verglich solche appellativen und suggestiven Strategien mit der sogenannten „Seilhilfe“ am Berghang. Klettern zwei Bergsteiger eine steile Wand empor, dann sichert der obere Kamerad, nachdem er einen festen Stand erlangt hat, den nachkommenden unteren Kameraden mit einem Seil. Dieses Seil soll den unteren retten, falls er abrutscht. Aber es ist nicht dafür gedacht, den unteren emporzuhieven. Sollte allerdings der untere Kletterer bedroht sein, den Halt zu verlieren, oder einfach keinen Griff in der Wand über sich mehr entdecken, gibt ihm der obere Kletterer einen kleinen Ruck mit dem Seil – gerade so viel, dass sein Kamerad den Aufstieg fortsetzen kann. Obwohl solche „Seilhilfe“ unter den professionellen Kletterern verpönt ist, verlangt eben die knallharte Realität so manche Konzession, und das ist in der psychotherapeutischen Praxis nicht anders.
Frankl, der ein begeisterter Bergsteiger war, wusste das. Wenn möglich, umschiffte er direktive Anweisungen und konkrete Beeinflussungen seiner Patienten, aber er scheute nicht davor zurück, zu ihrem Wohl deutlicher zu werden, als es sonst in der Branche üblich ist. Dennoch bevorzugte er den „Sokratischen Dialog“, und auch ich halte die In-Frage-Stellung von Selbst- und Fremdbildern, Menschen- und Weltbildern für außerordentlich fruchtbar. Fragen locken Antworten hervor, und Antworten tasten nach Argumenten. Über plausible Argumente kann man in einen Dialog eintreten, der seinem Namen gerecht wird, indem der „logos“, um den sich die Debatte gerade entfaltet, aus mehrfacher Warte betrachtet und à deux sorgfältig herausgeschält wird. Die psychotherapeutische Aufgabe ist es, die Mündigkeit und Kritikfähigkeit der Patienten zu fördern, ihr selbständiges Denken zu schärfen und blinde Nachsagerei und Rechthaberei ins Wanken zu bringen. Mitläufertum ist stets fatal. Die Despoten dieser Erde gewönnen keinerlei Macht, hätten sie keine Scharen von Mitläufern im Rücken …
Es stimmt: Wir Menschen sind beeinflussbare Wesen. Innere und äußere Einflüsse formen und prägen uns zuhauf. Doch da ist darüber hinaus jenes geistige Kapital, das uns befähigt, Stellung zu nehmen zu allem und jedem, und daher auch zu jedem Einfluss, der nach unserer Seele greifen will. Geist ist findig. Wenn jemand spürt, dass er sich einer Infiltrierung nicht entwinden kann, kann er allemal den Kontakt zu ihr stoppen. Genauso, wie Werbespots im Fernsehen nicht angeschaut werden müssen, weil man schließlich den Apparat abschalten oder während der Sendung aus dem Zimmer marschieren kann, genauso muss Idolen nicht gelauscht werden, die abstruse Gesichtspunkte verkünden. Es knospet genug Weisheit in unserem innersten Gespür, um Gutes von Bösem ungefähr unterscheiden zu können. Mein Tipp: gelegentlich in den nächtlichen Sternenhimmel blicken!
Ich weiß, das hat Seltenheitswert! Oft ist es zu kalt dafür. Oft ist der Himmel von Wolken verhangen. Für die Städter ist die Lichtverschmutzung zu krass: Über den beleuchteten Straßenschluchten zeigt sich kein Stern. Leider gibt es Millionen Kinder, die den Sternenhimmel gar nicht mehr kennen. Und wer nimmt sich schon die Muße dafür, nachts ins Freie aufzubrechen, um sich ins Firmament zu versenken?
Dennoch ist es eine wunderbare Möglichkeit, beunruhigende Indoktrinationen, falsche Vorbilder und implantierte Meinungen abzustreifen und mit dem verborgenen Zentrum des Selbst wieder in Verbindung zu kommen. Es ist eine sehr lange Tradition, dass Menschen, die Orientierung suchten, die Augen über den Nachthimmel haben gleiten lassen. Sie waren Wanderer, Seefahrer – und Reisende sind wir motorisierten Menschen auch. Wir sind auf einer Reise, die uns flott durch die rotierenden Jahreszeiten jagt; immer rascher und unaufhaltsamer, wie es uns dünkt. Der ehrfürchtige Blick zu den Sternen kann uns da eine sagenhafte Atempause verschaffen. Das sollten wir öfters ausprobieren.
Sie wundern sich vielleicht über diesen seltsamen Tipp.
Batthyány: Ich finde ihn vor allem sehr schön!
Lukas: Tatsache ist, dass wir tagsüber mit Mutter Erde stärker verwurzelt sind als nachts. Der Tag mit seinen Tagesgeschäften nährt die Vorstellung, dass sich unsere Existenz in ihnen weitgehend erfüllt. Die klare Nacht hingegen öffnet das Schaufenster zu einem überdimensionalen Kosmos, in dem sich die meisten unserer Geschäfte in überwältigender Bedeutungslosigkeit verlieren. Dafür zeichnet sich schemenhaft ab, was Ewigkeitswert haben könnte … und das sind sicher nicht die Auffassungen irgendwelcher Zeitgenossen, die uns mit ihren Phrasen überzeugen wollen. Wahrhaft Überzeugendes ragt in den Metaraum über uns hinaus und kann auch nur dort „sinn-bild-lich“ erfahren werden.
22Baker, M. C. & Goetz, S. (Eds.) (2011). The Soul Hypothesis: Investigations into the Existence of the Soul. London: A. & C. Black; Zunke, C. (2012). Kritik der Hirnforschung: Neurophysiologie und Willensfreiheit. Berlin: Walter de Gruyter; Gabriel, M. (2015). Ich ist nicht Gehirn: Philosophie des Geistes für das 21. Jahrhundert. München: Ullstein eBooks; Peschl, M. F. & Batthyány, A. (Hrsg.) (2008). Geist als Ursache? Mentale Verursachung im interdisziplinären Diskurs (Vol. 2). Würzburg: Königshausen & Neumann
23Martijn, C., Tenbült, P., Merckelbach, H., Dreezens, E. & de Vries, N. K. (2002). Getting a grip on ourselves: Challenging expectancies about loss of energy after self-control. In: Social Cognition, 20 (6), 441–460
24Vohs, K. D. & Schooler, J. W. (2008). The value of believing in free will: Encouraging a belief in determinism increases cheating. In: Psychological Science, 19 (1), 49–54
25Stillman, T. F. et al. (2010). Personal philosophy and achievement: Belief in free will predicts better job performance. In: Social Psychological and Personality Science, 1 (1), 43–50; Baumeister, R. F., Masicampo, E. J. & DeWall, C. N. (2009). Prosocial benefits of feeling free: Disbelief in free will increases aggression and reduces helpfulness. In: Personality and Social Psychology Bulletin, 35 (2), 260–268; MacKenzie, M. J., Vohs, K. D. & Baumeister, R. F. (2014). You didn’t have to do that: Belief in free will promotes gratitude. In: Personality and Social Psychology Bulletin, 40 (11), 1423–1434
26Batthyány, A. (2019). The Impact of Free Will Beliefs on Pro-Social and Altruistic Behavior & Getting a Grip on Ourselves: The Impact of Free Will Beliefs on Procrastination and Phobia-based Avoidant Behavior. Mauren: IAP Monographie 2
27Zum Beispiel hat er nervösen Patienten mit vor lauter Sorge erhöhtem Blutdruck suggeriert, ihr Blutdruck sei normal, was diesen auf Grund der Erleichterung der Patienten sofort abschwellen ließ.
28Cohen, D. (1952). Expectation effects on dream structure and content in Freudian psychoanalysis, Adlerian individual psychology, and Jungian analytical psychology. In: Modern Thought, 1 (2), 151–159; Ehrenwald, J. (1957). Doctrinal compliance in psychotherapy. In: American Journal of Psychotherapy, 11 (2), 359–379
29Bungard, W. (1980). Die „gute“ Versuchsperson denkt nicht. Artefakte in der sozialpsychologischen Forschung. Wien: Urban & Schwarzenberg
III. AUFMERKSAMKEIT, ACHTSAMKEIT UND SINNFINDUNG
1. ACHTSAMKEIT UND SINNORIENTIERUNG
Batthyány: Apropos Metaraum und Atempause – das Thema führt unser Gespräch auf einen aktuellen Trend der Psychologie. In den letzten Jahrzehnten hat die Achtsamkeitsmeditation (und Achtsamkeit im Allgemeinen) einen enormen Triumphzug innerhalb der Psychotherapie und auch der Medizin erlebt. Die Idee besteht kurz gesagt darin, bewusst dem Atem zu folgen und dabei Gedanken, Gefühle und Empfindungen einfach unbewertet vorüber- und vorbeiziehen zu lassen. Die wissenschaftliche Forschung attestiert dieser Methode eine hohe Effizienz bei einer ganzen Bandbreite von Indikationen – sei es bei Ängsten, bei Schmerzen, bei Unruhe und Übererregbarkeit und Affektlabilität etc.30
Allerdings fällt aus logotherapeutischer Sicht zugleich etwas auf – und das stellt auch einen Gegensatz dar zu der von Ihnen vorgeschlagenen Besinnung unter dem freien Sternenhimmel: Die Methode der Achtsamkeitsmeditation zielt im Grunde einzig und allein auf die Selbstdistanzierung hin, zugleich geht ihr aber jedwede Anregung zur Selbsttranszendenz ab – also zum Blick über den Tellerrand der eigenen Befindlichkeit auf Zusammenhänge, in denen wir irgendwo da draußen in der Welt gemeint sind oder in denen etwas oder jemand auf unser Engagement und unseren Beitrag wartet. Im Gegenteil: Wenn man die Achtsamkeitsmeditation regelgerecht ausübt, geht es sogar darum, jene Gedanken und Einsichten, die einen zum Engagement in der Welt inspirieren wollen, ebenfalls unbewertet und detachiert vorüberziehen zu lassen … Im Mittelpunkt steht das Sichdistanzieren, das Bewusst-, aber eben gerade nicht das Involviertsein, das Geschehenlassen und das Nichtwerten der eigenen Eindrücke, Assoziationen und Gedanken. Achtsamkeitsmeditation ist, so hilfreich sie auch ist, buchstäblich eine wertefreie Methode …
Man kann noch weitergehen und feststellen, dass diese Methode von ihrer Intention her letztlich (über den Umweg der Selbstdistanzierung) nur ein „zuständliches“, aber kein „gegenständliches“ Ziel hat: nämlich Stressresistenz und Affektregulation, vielleicht auch eine gewisse Desensibilisierung gegenüber unangenehmen körperlichen Empfindungen wie Schmerzen oder Verspannungen. Aber im Mittelpunkt der Intention steht stets das Empfinden von Gleichmut. Anders gesagt: Es wird, wenn man das konsequent betreibt, zwar ein „guter Zustand“ des relativen Gleichmuts und vielleicht auch der inneren Gelassenheit erreicht, aber die entscheidende Frage, wofür – also für wen oder für was – man diese nun frei werdenden Ressourcen und die wachsende innere Souveränität gegenüber Innen- und Außenzuständen sinnvoll einsetzen und nutzen kann, wird außer Acht gelassen. Auch in der einschlägigen Literatur zur Achtsamkeit wird diese Frage meistens gar nicht angesprochen, wodurch leicht der Eindruck entstehen kann, der entspannte Zustand des Gleichmuts stelle quasi den Selbst- und Endzweck des Ganzen dar.
Dazu muss man allerdings ergänzend festhalten: In den religiösen Traditionen, in denen die Achtsamkeitsmeditation entstanden ist und weitergegeben wurde, stand sie eigentlich so gut wie nie dermaßen isoliert dar. Sie war vielmehr immer auch eingebettet in einen moralischen Kanon – sie soll Leid lindern, aber zugleich Ressourcen freimachen für Einsicht und rechtes Handeln.31 Dieser Aspekt ist in der zeitgenössischen Version der Achtsamkeitsmeditation – vor allem im psychotherapeutischen und medizinischen Kontext – in der Regel kaum mehr vorzufinden.
Mit einem Wort – wir haben es hier mit einer effektiven Methode der Affektregulation zu tun, und als solche hat sie fraglos Platz im therapeutischen Werkzeugkasten. Allerdings wird man den Verdacht nicht los, diese Methode sei in der gegenwärtig propagierten Form aus den erwähnten Gründen noch irgendwie unvollständig.
Lukas: Nun, die Intensivierung der Achtsamkeit ist in der Psychotherapie keine neue Errungenschaft, auch wenn sie derzeit auf einer Modewelle mitschwimmt. Genau genommen ist sie das psychotherapeutische Anliegen schlechthin. Die verschiedenen Therapieschulen spalten sich erst auf, sobald es darum geht, worauf von den Hilfesuchenden geachtet werden soll. Bei den Psychoanalytikern sind es die Bedürfnisse und Triebmeldungen, die von den Patienten nicht (mehr) unter den Teppich gekehrt, sondern berücksichtigt werden sollen. Bei den Körpertherapeuten sind es die Signale aus dem vegetativen Nervensystem, die gehört und verstanden werden sollen. Bei den Verhaltenstherapeuten sind es die Fehlkonditionierungen, die gestoppt und nach Plan umgelernt werden sollen. Bei den Gesprächspsychotherapeuten sind es die vagen Ansichten und Aussagen der Patienten, die unter die Präzisionslupe genommen werden sollen.
Die Empfehlung zum Verfolgen des Atemrhythmus, und sich dabei bar jeder Beurteilung seinen „vorbeiwehenden“ Empfindungen zu widmen, ist nur eine Variation uralter Meditationsverfahren, die stets zum Innehalten in der alltäglichen Betriebsamkeit, zur Entschleunigung und „Entstreuung“ einladen. Das Beste daran ist dieses Innehalten im Galopp des Lebens, denn ohne eine zeitweise Besinnung und Neuorientierung läuft man zu schnell dahin und vergisst zu schnell, wohin. Jeder Wanderer muss gelegentlich rasten, verschnaufen, die Landkarte, den Kompass oder sein Navigationsgerät aus dem Rucksack ziehen, prüfen, ob der Kurs noch stimmt, Kräfte sammeln für den Aufbruch, und sich innerlich auf die nächste Wegstrecke einstellen. Er muss „zu Atem kommen“, denn keuchend kann er nicht weiterrennen. Und er muss Empfindungen wie Durst, Müdigkeit, schmerzende Fersen etc. wahrnehmen und ernst nehmen. Jedes Achtsamkeitstraining ist dem Diktat des Lebens abkopiert, denn das sich abspulende Leben ist es, das uns ermahnt, nicht achtlos draufloszustürmen. (Nur wer diese Ermahnungen ignoriert, braucht einen Therapeuten, Coach, Yogalehrer oder simpel einen guten Kameraden als „Lautsprecher“ für die Ermahnungen des Lebens.)
Sie haben aber ganz recht, wenn Sie solche Besinnungsrasten mit einer Intensivierung der Selbstdistanzierung in Verbindung bringen. Denn wer achtet schließlich auf wen? Klarerweise ist es die geistige Person, die auf sich selbst als Ganzheit zu achten hat. Sie hat die Oberhoheit über das Zusammenspiel der dimensionalen Regionen im Menschen. Sie muss sich um ein klopfendes Herz und Blasen an den Fersen genauso kümmern wie um eine flatternde Psyche, die am Durchdrehen ist, oder um einen Verstand, der mit Absenzen ringt. Sie hat schwierige Koordinierungsaufgaben zu erfüllen, und hätte sie nicht mit ihrem „Sinn-Organ Gewissen“ (Frankl) ein verlässliches Leitsystem an ihrer Seite, wäre sie wahrscheinlich des Öfteren ratlos. Aber das Gewissen, der „Kompass“ (oder moderner: das „Navigationsgerät“) lässt den Wanderer nicht im Stich, wenn er sich die Ruhe gönnt, in Abständen darauf zu schauen und prinzipiell darauf zu vertrauen. Und so lautet denn die speziell logotherapeutische Achtsamkeitsparole (im Kontrast zu den anderen Therapieschulen): „Man soll auf die zarten Regungen seines Gewissens achten!“
An dieser Diskursstelle möchte ich einen kleinen Schlenker vollziehen. Ich möchte betonen, dass sich aus der generellen Achtsamkeit auch die Achtsamkeit im Umgang mit Ressourcen ergibt, wobei es keine Rolle spielt, ob es Ressourcen der eigenen Existenz sind, oder Fremdressourcen, zu denen man Zugriff hat. Ich bin einmal von einer Reporterin gebeten worden, dank meiner psychotherapeutischen Erfahrung mit ein paar Tausend Patienten (ich hatte bis zu 300 Patienten im Jahr) in aller Kürze auszudrücken, wovon seelische Gesundheit oder Krankheit am ehesten abhängt. Spontan habe ich damals geantwortet: „Vom Umgang mit den Ressourcen“, und ich stehe heute noch zu meinem Wort. Lebenszeit zum Beispiel ist eine so kostbare Ressource – aber für welchen Kleinkram wird sie vergeudet! Menschen dröhnen sich voll mit Ablenkungen und stumpfer Routine, statt im Sinne des klösterlichen „ora et labora“ ein vernünftiges Wechselspiel von Produktivität und Regeneration einzuhalten. Selbstverständlich ist auch das „schnöde“ Geld eine wichtige Ressource – aber für welche Überflüssigkeiten wird es verschwendet! Vom Keller bis zu den Dachböden werden Kästen und Laden in unserem Land mit Zeug vollgestopft, das man gar nicht braucht und das nur belastet, statt sich die Freude an wenig Materiellem und viel Spirituellem zu bewahren32. Welch fantastische Ressource ist darüber hinaus unser Organismus, der uns Tag und Nacht gestattet, durchs Leben zu spazieren – und wie schlecht wird es ihm vergolten! Er wird mit Schadstoffen gefüttert, in seiner Beweglichkeit eingeschnürt, mit Schlafentzug gemartert und mit Grämlichkeiten überfrachtet, statt dass er seiner Natur gemäß gepflegt und seiner Leistung gemäß geschätzt würde. Oder was ist die Familie für eine segenspendende Ressource, die in größter Not, wenn alles kippt, ja selbst noch in Todesnähe Reserven für einen bereitstellt – aber wie mutwillig wird ihr Frieden für Belanglosigkeiten riskiert und ihre Harmonie mit Füßen getreten! Was streiten Angehörige unentwegt miteinander, statt einander tolerant, verständnisvoll und barmherzig zu begegnen.
Batthyány: Das ist natürlich eine zutiefst logotherapeutische Wendung des Umgangs mit Achtsamkeit, die zugleich Anschluss findet an die ursprünglichen Zusammenhänge der Achtsamkeitsmeditation: Nicht die Methode wird in den Mittelpunkt gestellt, und auch nicht die Gelassenheit des bewertungsfreien Geschehenlassens, sondern die Frage des achtsamen und guten Umgangs mit etwas oder jemandem – also steht nicht nur, oder nicht notwendig, das neutrale Beobachten im Zentrum, sondern vielmehr die Frage, was und wie wir etwas oder jemanden beachten oder mit Zuwendung und Wohlwollen beschenken. Das hat gewiss auch therapeutische Bedeutung?