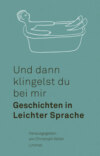Kitabı oku: «Fälle und Lösungen zum Eingriffsrecht in Nordrhein-Westfalen», sayfa 4
III. Materielle Rechtmäßigkeit
Zu prüfen ist § 50 Abs. 1 PolG NRW (Zwangsanwendung durch Durchsetzung eines erlassenen Verwaltungsaktes; sog. gestrecktes Verfahren).
1. Zulässigkeit des Zwangs (§ 50 Abs. 1 PolG NRW)
Gem. § 50 Abs. 1 PolG NRW kann ein Verwaltungsakt, der auf die Vornahme einer Handlung oder auf Duldung oder Unterlassung gerichtet ist, mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, wenn er unanfechtbar ist oder wenn ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat. Der nach § 80 Abs. 1 VwGO vorgesehene Suspensiveffekt (§ 80 Abs. 1 VwGO) entfällt nach § 80 Abs. 2 Nr. 2 VwGO, wenn es sich um unaufschiebbare Anordnungen und Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten handelt. Es handelt sich hier um eine unaufschiebbare Maßnahme zur Gefahrenabwehr, sie ist sofort vollziehbar, da gem. § 80 Abs. 2 Nr. 2 VwGO die aufschiebende Wirkung förmlicher Rechtsbehelfe entfällt. Die Voraussetzungen des sog. gestreckten Zwangsverfahrens nach § 50 Abs. 1 PolG NRW liegen vor.
2. Zulässigkeit des Zwangsmittels
In Betracht kommt vorliegend der unmittelbare Zwang (§ 55 PolG NRW). Die Voraussetzungen der (Vollstreckungs-)Ermächtigung (§ 55 PolG NRW) liegen vor. Die Polizei durfte somit das Zwangsmittel des unmittelbaren Zwanges anwenden. Nach § 55 Abs. 1 Satz 2 PolG NRW gelten für die Art und Weise der Anwendung unmittelbaren Zwanges die §§ 57 ff. PolG NRW. Ist die Polizei nach diesem Gesetz (PolG NRW) oder anderen Rechtsvorschriften zur Anwendung unmittelbaren Zwanges befugt, gelten für die Art und Weise der Anwendung die §§ 58 bis 66 und, soweit sich aus diesen nichts Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes (§ 57 Abs. 1 PolG NRW).
3. Art und Weise des (Verwaltungs-)Zwanges
Mangels entsprechender Hinweise im Sachverhalt ist davon auszugehen, dass alle Verfahrensvorschriften beachtet wurden, und zwar insbesondere hinsichtlich der Androhung des unmittelbaren Zwanges (§§ 51 Abs. 2, 56 Abs. 1, 61 Abs. 1 PolG NRW).
4. Allgemeine Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen
An der objektiven Zwecktauglichkeit der (Zwangs-)Maßnahme bestehen keine Zweifel, sie ist somit geeignet. Auch hinsichtlich der Erforderlichkeit bestehen keine Bedenken. Eine Verfügung wurde nicht befolgt. Die Zwangsanwendung war fraglos auch verhältnismäßig, denn die geringe Zwangsanwendung auf den Betroffenen (Z) steht in einem angemessenen Verhältnis zum Zweck der Maßnahme. Die zwangsweise Durchsetzung der Gewahrsamnahme war rechtmäßig.
1 Braun StaatsR, S. 79; Braun PSP 3/2017, 37 (38); Schenke POR, Rn. 132. — 2 Tegtmeyer/Vahle PolG NRW; § 34, Rn. 1; Kay/Böcking PolR NRW, Rn. 234. — 3 Petersen-Thrö apf 2008, 370 (371). — 4 Braun StaatsR, S. 61. — 5 Statt vieler: Merten DPolBl. 3/2003, 2. — 6 Vertiefend: Beaucamp JA 2009, 279 ff. — 7 Omnibusse des Linienverkehrs fallen unter die zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmten Räume i. S. des § 123 Abs. 1 StGB, Hartmann, in: DDKR, § 123 StGB Rn. 11. — 8 Chemnitz PolR NRW, § 4 Rn. 8.3.1 (Unmittelbarkeitstheorie). — 9 DWVM Gefahrenabwehr, S. 392. — 10 Im Überblick zum Zwang Wälter, Prüfungsschema: Rechtmäßigkeit der zwangsweisen Durchsetzung einer polizeilichen Maßnahme, Beilage PSP 4/2019. — 11 Der sofortige Vollzug darf nicht mit der sog. sofortigen Vollziehung (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO) verwechselt werden. Die sofortige Vollziehung setzt immer einen bereits erlassenen Verwaltungsakt voraus. Die Anordnung erfolgt in diesen Fällen, damit Rechtsbehelfe und Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung haben; ergänzend: Sadler Die Polizei 2005, 185. — 12 von Blohn/Schucht POR, S. 31. — 13 Haurand POR, S. 161. — 14 Vertiefend: Vahle Kriminalistik 1994, 360 ff. — 15 Näher dazu Gusy PolR, Rn. 436 ff. — 16 Buschmann/Schiller NWVBl. 2007, 249 (251). — 17 Schmitt/Kammler NRWVBl. 1995, 166. — 18 WHM POR NRW, Rn. 195. — 19 Gusy PolR, Rn. 183. — 20 Ausführlich: Brühl JuS 1997, 926 ff.; 1021 ff. und JuS 1998, 65 ff. — 21 Knemeyer POR, Rn. 277 ff. — 22 Tetsch ER Bd. 2, S. 267 ff. — 23 Kay/Böcking PolR NRW, Rn. 359. — 24 Gornig/Jahn PolR, S. 76 (80)., m. w. N. — 25 Erbguth apf 2008, 106 (108). — 26 BVerwG NJW 1984, 2591; BVerfG NVwZ 1999, 291. — 27 Koehl Polizei-heute 2008, 168 (173): So kann z. B. die Auflösung einer Versammlung (und die Entfernungspflicht der Versammlungsteilnehmer) erst nachträglich auf ihre Rechtswidrigkeit hin untersucht werden. Ein Widersetzen der Teilnehmer – gerade bei einer rechtswidrigen Auflösungsverfügung – macht den Einsatz polizeilicher Zwangsmittel nicht grundsätzlich unzulässig (BVerfG, NVwZ 1999, 291). — 28 BVerfG NVwZ 1999, 290 (292). — 29 Vertiefend: P-TRE PolR Sachsen, S. 211 f. — 30 Am 1. 11. 2007 ist in Nordrhein-Westfalen das sog. Bürokratieabbaugesetz II in Kraft getreten. Es soll den Bürgerinnen und Bürgern schneller als bislang zu ihrem Recht verhelfen. Hierzu wird die Statthaftigkeit des Widerspruchsverfahrens auf wenige Fälle reduziert und der Devolutiveffekt weitgehend eingeschränkt; näher dazu Theisen NRW, DVP 2008, 63 ff.; Holzner DÖV 2008, 217; Beaucamp/Ringemuth DVBl 2008, 426; Kamp NRWVBl. 200841 ff.; Kallerhof NRWVBl. 2008, 334. — 31 „Übrige Vorschriften des Gesetzes“ sind (wohl) die allgemeinen Bestimmungen des PolG NRW, so beispielsweise § 2 (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit), § 3 (Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens) und die §§ 4 bis 6 (Adressatenregelungen). — 32 Die Androhung kann mit dem Grundverwaltungsakt verbunden werden. Sie soll mit ihm verbunden werden, wenn ein Rechtsmittel, wie bei polizeilichen Verwaltungsakten regelmäßig der Fall (§ 80 Abs. 2 Nr. 2 VwGO), keine aufschiebende Wirkung hat, Rachor/Graulich, in: Lisken/Denninger HdB PolR, Kap. E Rn. 890. — 33 P-TRE PolR Sachsen,S. 209. — 34 OVG Münster NJW 1980, 138. — 35 BayObLG NVwZ 1999, 106. — 36 OVG Bremen NordÖR 2000, 109; dazu auch Haase NVwZ 2001, 164; Geißler/Subatzus NVwZ 1998, 711. — 37 OLG Hamm NVwZ-RR 2008, 321. — 38 LT-Drs. 17/2352, S. 1. — 39 OVG Bremen NVwZ 2001, 221. — 40 Basteck, in: BeckOK POR NRW, § 35 PolG, Rn. 41. — 41 Kingreen/Poscher POR, § 11 Rn. 10. — 42 Götz/Geis POR, § 12, Rn. 5; Schenke, Rn. 115. — 43 Schenke POR, Rn. 115.
Fall 2: Ruhestörung
Schwerpunkte: Generalklausel, Betreten von Wohnungen, Zwang, Ersatzvornahme, Zufallsfunde (BtM), Gewahrsam zwecks Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten
Sachverhalt: 1
An einem Sonntagabend, 23.30 Uhr rufen Anwohner des Mehrfamilienhauses Hansastraße 56 in A-Stadt telefonisch wegen Ruhestörung und überlauter Musik die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeibeamten POK B und POK C wird überlaute Musik festgestellt. Es befinden sich mehrere Mietparteien des Mehrfamilienhauses auf ihren Balkonen, weil diese sich durch die Musik gestört fühlen. Auch an angrenzenden und gegenüberliegenden Wohnhäusern fühlten sich Personen gestört. Die Musik geht von der Wohnung des Fachhochschulstudenten A aus. Die Beamten klingeln an der Wohnungstür des A. Als dieser die Tür öffnet, wird er aufgefordert, die Musik leiser zu stellen. Dieser zeigt sich einsichtig. Die Musik wird leiser gestellt. Kurz nachdem sich die Polizeibeamten wieder entfernt haben, gehen erneut mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Polizei in A-Stadt ein. Wieder beschwerten sich Anwohner über die überlaute Musik aus der Wohnung des A. POK A und POK B werden erneut zur Hansastraße 56 entsandt. Am Einsatzort nehmen die Beamten vor dem Wohnhaus erneut überlaute Musik wahr. Die Beamten entschließen sich, die Wohnung des A zu betreten, „um endgültig für Ruhe zu sorgen“, nötigenfalls auch durch Mitnahme der Musikanlage. Auf Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür reagiert niemand. Als auf erneutes Klopfen an der Wohnungstür mit „Zurückklopfen“ und Beschimpfungen reagiert wird, fordern die Polizeibeamten den A lautstark auf, die Tür zu öffnen und die Musik leiser zu stellen. A gibt den Beamten zu erkennen. dass er die Tür keinesfalls öffnen werde. Vielmehr beschimpft er die Beamten als „Spaßverderber“ und gibt ihnen zu erkennen, dass „sie schon sehen werden, was sie davon haben“, wenn sie seine Wohnung betreten würden. Schließlich habe er in der BLÖD-Zeitung gelesen, dass man „einmal im Jahr feiern dürfe“. Als die Beamten androhen, die Tür nötigenfalls auch zwangsweise öffnen zu lassen, ernten sie Gelächter. Sodann wird die Musik noch lauter gestellt. Zu allem Überfluss wird nunmehr auch noch gegen die Wand zur Nachbarwohnung getrommelt.
Die Beamten verständigen über die Leitstelle einen Schlüsseldienst, der die Wohnungstür des A öffnet. Die Beamten betreten die Wohnung des A und halten hierbei auch Ausschau nach der Musikanlage. In der Wohnung des A befinden sich mehrere angetrunkene Personen. A erklärt den Beamten unaufgefordert, er werde „die Musik sowieso wieder aufdrehen“, wenn die Beamten die Wohnung verlassen hätten. Schließlich habe er „Geburtstag und einmal im Jahr dürfe man laut Gesetz auch feiern“. Als POK A die Sicherstellung der Musikanlage in Aussicht stellte, erklärt A, man könne auch ohne Musikanlage Musik machen, z. B. durch „Rhythmisches Trommeln“. Die Beamten schließen nun aus diesem Verhalten, das A und seine „Gäste“ gewillt waren, auch weiterhin in jedem Fall Lärm zu machen und die Nachbarn zu stören. Die Betroffenen werden schließlich zur Wache mitgenommen und am nächsten Morgen entlassen. A erhob später über seinen Rechtsanwalt gegen das seiner Meinung nach „willkürliche Vorgehen“ der Polizei Beschwerde. Schließlich habe er am Samstag Geburtstag gehabt und „einmal im Jahr“ dürfe man schließlich auch lauter feiern.
Aufgabe:
1. Beurteilen Sie rechtsgutachtlich die polizeilichen Maßnahmen:
– Klingeln an der Wohnungstür des A und Ermahnung zur Ruhe
– Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür des A und Aufforderung, die Wohnungstür zu öffnen (Betreten der Wohnung)
– Öffnen der Wohnungstür mit Schlüsseldienst
2. In der Wohnung des A sehen die Beamten auf dem Küchentisch einen Beutel mit Haschisch. Darf dieses Betäubungsmittel als Zufallsfund sichergestellt werden?
3. Nehmen Sie problemorientiert Stellung zur Gewahrsamnahme des A und seinen Gästen.
Hinweis: Die örtliche Zuständigkeit als formelles Erfordernis kann unterstellt werden.
Lösung zu Aufgabe 1
A. Klingeln an der Wohnungstür des A und Ermahnung zur Ruhe
I. Ermächtigungsgrundlage
Nach dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes bedarf es bei einem Grundrechtseingriff einer Ermächtigungsgrundlage, welche auf ein verfassungsmäßiges Gesetz zurückzuführen ist. Ein Eingriff ist jede durch Hoheitsakt bewirkte, nicht absolut geringfügige Beeinträchtigung eines Grundrechtes. Durch die Verfügung an A („zur Ruhe ermahnt“) wird eingegriffen in die Allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG).2 Die polizeiliche Verfügung („Ermahnung zur Ruhe“) erfolgte erkennbar zur Gefahrenabwehr (Verhinderung von Ordnungsstörungen/Ordnungswidrigkeiten, §§ 9, 17 LImSchG NRW).3
II. Formelle Rechtmäßigkeit
Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 1 Abs. 1 Satz 1, 3 PolG NRW i. V. m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 POG NRW. Gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 PolG NRW hat die Polizei die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). Gefahr ist eine Sachlage, die einen Schaden für die öffentliche Sicherheit erwarten lässt. Das ist insbesondere gegeben, wenn ein tatsächliches Geschehen den Schluss rechtfertigt, dass möglicherweise individuelle Rechte wie Leib, Leben, Gesundheit usw. einer Person oder das Sicherheitsgut „Rechtsordnung“ zu Schaden kommen könnten.4 Durch den Lärm werden die Nachbarn in ihrer Nachtruhe gestört und damit in ihrer körperlichen Integrität (§ 223 StGB) beeinträchtigt. Die Ruhestörung beeinträchtigte nicht nur die objektive Rechtsordnung, sondern auch die subjektiven Rechte und Rechtsgüter der Nachbarn. Durch die fortgesetzte massive Ruhestörung zur Nachtzeit ist vorliegend das individuelle Sicherheitsgut Gesundheit anderer Personen in Gefahr. Derartige Ruhestörungen sind Ordnungswidrigkeiten (§§ 9, 10, 17 LImSchG NRW), sodass hier auch eine Gefahr für das Sicherheitsgut der Allgemeinheit „Rechtsordnung“ besteht.
 Gem. § 9 Abs. 1 LImSchG NRW sind von 22 bis 6 Uhr Betätigungen verboten, welche die Nachtruhe zu stören geeignet sind. Für das Verbot kommt es nicht darauf an, dass tatsächlich eine Störung der Nachtruhe eintritt, sondern es genügt die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass die entsprechende Handlung zu einer Störung führen kann („geeignet sind“). Ziel der Nachtruhe ist es, einen gesunden Schlaf zu gewährleisten. Gem. § 10 Abs. 1 LImSch NRW dürfen Geräte, die der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe dienen (Musikinstrumente, Tonwiedergabegeräte und ähnliche Geräte), nur in solcher Lautstärke benutzt werden, dass unbeteiligte Personen nicht erheblich belästigt werden. Tongeräte in diesem Sinne sind neben Musikinstrumenten auch Radios, Fernsehgeräte, Kassettenrekorder, Plattenspieler, CD-Player, Tonbandgeräte, Megafone usw. Nach Nr. 10.1 VV LImschG NRW gilt diese Vorschrift zudem für Verstärker und Lautsprecher. Es sei erwähnt, dass das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit5 dem Wohnungsinhaber nicht das Recht gibt, „einmal im Monat durch lautstarkes Feiern die Nachtruhe zu stören“. Der Wohnungsinhaber ist vielmehr dafür verantwortlich, dass von einer von ihm darin veranstalteten Geburtstagsfeier kein Lärm ausgeht, der die Nachtruhe zu stören geeignet ist.6
Gem. § 9 Abs. 1 LImSchG NRW sind von 22 bis 6 Uhr Betätigungen verboten, welche die Nachtruhe zu stören geeignet sind. Für das Verbot kommt es nicht darauf an, dass tatsächlich eine Störung der Nachtruhe eintritt, sondern es genügt die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass die entsprechende Handlung zu einer Störung führen kann („geeignet sind“). Ziel der Nachtruhe ist es, einen gesunden Schlaf zu gewährleisten. Gem. § 10 Abs. 1 LImSch NRW dürfen Geräte, die der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe dienen (Musikinstrumente, Tonwiedergabegeräte und ähnliche Geräte), nur in solcher Lautstärke benutzt werden, dass unbeteiligte Personen nicht erheblich belästigt werden. Tongeräte in diesem Sinne sind neben Musikinstrumenten auch Radios, Fernsehgeräte, Kassettenrekorder, Plattenspieler, CD-Player, Tonbandgeräte, Megafone usw. Nach Nr. 10.1 VV LImschG NRW gilt diese Vorschrift zudem für Verstärker und Lautsprecher. Es sei erwähnt, dass das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit5 dem Wohnungsinhaber nicht das Recht gibt, „einmal im Monat durch lautstarkes Feiern die Nachtruhe zu stören“. Der Wohnungsinhaber ist vielmehr dafür verantwortlich, dass von einer von ihm darin veranstalteten Geburtstagsfeier kein Lärm ausgeht, der die Nachtruhe zu stören geeignet ist.6
Es besteht eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Auch liegt öffentliches Interesse vor. Ein solches ist grundsätzlich immer dann gegeben, wenn es um die Abwehr von Gefahren für die Rechtsordnung geht. Dabei spielt der Umstand, dass die Gefahr im privaten Bereich verursacht wurde, keine Rolle. Die Beamten sind subsidiär zuständig; ein Handeln der an sich zuständigen (Ordnungs-)Behörde ist nicht oder nicht rechtzeitig möglich (§ 1 Abs. 1 Satz 3 PolG NRW). Soweit Polizeibeamte gestützt auf § 8 Abs. 1 PolG NRW Verwaltungsakte erlassen, sind die allgemeinen Regeln des VwVfG NRW zu berücksichtigen, insbesondere die §§ 28, 37 Abs. 2 VwVfG NRW. Der Verwaltungsakt ist entsprechend § 41 Abs. 1 VwVfG NRW bekannt zu geben, er wird dann wirksam (§ 43 Abs. 1 VwVfG NRW).
III. Materielle Rechtmäßigkeit
1. Tatbestandliche Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage
Die Grundlage für die polizeiliche Verfügung („Ermahnung zur Ruhe“) könnte in der Generalklausel gesehen werden. § 8 Abs. 1 PolG NRW kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn eine Spezialnorm diesen Bereich nicht erfasst. Andere spezialgesetzliche Regelungen sind nicht ersichtlich, insbesondere kommen die §§ 9 – 46 PolG NRW nicht in Betracht. Es ist also auf die Generalklausel zurückzugreifen. Die Polizei kann notwendige Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende – mindestens konkrete – Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren. Die konkrete Gefahr setzt voraus, dass aufgrund der Gesamtumstände in Bezug auf Ort, Zeit, Personen, Verhalten im Einzelfall ein Schadenseintritt wahrscheinlich ist. Hier ist ein Schaden („Rechtsordnung“) bereits eingetreten. Die Gefahr hat sich hier bereits realisiert. Wenn die Störung aber in die Zukunft wirkt und damit die „Gefahr der nächsten Sekunde“ begründet, liegt Gefahrenabwehr vor. Die Gefahr besteht weiterhin („Dauergefahr“).
2. Besondere Verfahrensvorschriften
Besondere Verfahrensvorschriften sind hier nicht zu beachten.
3. Adressatenregelung
P hat durch sein Verhalten die Gefahr unmittelbar verursacht. Er ist somit Verhaltensstörer (§ 4 Abs. 1 PolG NRW).
4. Rechtsfolge der konkret herangezogenen Ermächtigungsgrundlage
a) Rechtsfolge entspricht der Ermächtigungsgrundlage
Die Rechtsfolgen der Generalklausel sind auf den Erlass der „notwendigen Maßnahmen“ gerichtet. Gemeint sind grundrechtseingreifende Maßnahmen aller Art, gebietende und verbietende Verwaltungs- und (auch) Realakte. Denkbar sind mithin auch faktische Rechtseingriffe aufgrund der Generalklausel. Die „notwendigen Maßnahmen“ sind also die Maßnahmen, die auch i. S. des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erforderlich sind.
b) Bestimmtheit (§ 37 Abs. 1 VwVfG NRW)
§ 37 Abs. 1 VwVfG NRW enthält mit dem Bestimmtheitserfordernis in Abs. 1 ein materiell-rechtliches Erfordernis. Verstöße sind hier nicht ersichtlich.
c) Ermessen (§ 3 PolG NRW)
Rechtsfehler hinsichtlich der pflichtgemäßen Ermessensausübung, insbesondere eine Missachtung der Grundsätze aus § 40 VwVfG NRW sowie des Differenzierungsge- und -verbotes sind dem Sachverhalt nicht zu entnehmen.
d) Übermaßverbot (§ 2 PolG NRW)
Die Verfügung ist geeignet (objektiv zwecktauglich), die beschriebene Gefahr abzuwehren. Auch ein Verstoß gegen das Gebot der Erforderlichkeit ist nicht ersichtlich. Eine andere (mildere) Maßnahme – als eine polizeiliche Verfügung – ist vorliegend nicht denkbar. Da die Maßnahme auch (insbesondere) der Verhältnismäßigkeit i. e. S. entspricht, dürfte die polizeiliche Verfügung rechtmäßig sein.
Parallelnormen § 8 Abs. 1 PolG NRW (Generalklausel): § 14 Abs. 1 BPolG; § 3 BWPolG; Art. 11 Abs. 1 BayPAG; § 17 Abs. 1 ASOG Bln; § 10 Abs. 1 BbgPolG; § 10 Abs. 1 BremPolG; § 3 Abs. 1 HmbSOG; § 11 HSOG; § 13 MVSOG; § 11 NdsSOG; § 9 Abs. 1 RhPfPOG; § 8 Abs. 1 SPolG; § 3 Abs. 1 SächsPolG; § 13 LSASOG; § 174 SchlHVwG; § 12 ThürPOG
B. Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür und Aufforderung, die Wohnungstür zu öffnen (Betreten der Wohnung)
I. Ermächtigungsgrundlage
Nach dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes bedarf es bei einem Grundrechtseingriff einer Ermächtigungsgrundlage, welche auf ein verfassungsmäßiges Gesetz zurückzuführen ist.
1. Grundrechtseingriff
a) Art. 2 Abs. 1 GG
Da die Aufforderung („Öffnen Sie die Tür“) nicht unbedingt mit einer Durchsuchung oder einem Betreten der Wohnung einhergehen muss, greift nach einer Auffassung die Aufforderung, die Tür zu öffnen, als eigenständiger Grundrechtseingriff in das Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit, Art. 2 Abs. 1 GG, ein. Dieses Grundrecht gilt für alle natürlichen Personen und schützt jegliches Tun und Unterlassen. Hier wird eine Handlung von dem Adressaten gefordert. Dieser Auffassung folgend liegt ein Eingriff in Art. 13 Abs. 1 GG dann noch nicht vor, weil die durch dieses Grundrecht geschützte Intimsphäre noch nicht betroffen ist.
b) Art. 13 Abs. 1 GG
Sieht man die Aufforderung, die Tür zu öffnen, als eine Maßnahme an, die zur Ermächtigung des § 41 PolG NRW (Betreten und Durchsuchen von Wohnungen) gehört, so könnte man hier von einem Eingriff in Art. 13 Abs. 1 GG ausgehen. Sieht man in der Aufforderung nur einen Begleiteingriff zum Betreten der Wohnung, so liegt kein eigenständiger Eingriff vor.7 Geschützt ist die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das Private der Räume wird hier gestört, indem die Polizei dazu auffordert, die Tür zu öffnen. Die Beamten wollen die Wohnung betreten und nicht nur vor der Wohnungstür mit dem A reden. Das begründet den Eingriff in Art. 13 Abs. 1 GG.8 Vorliegend wollen die Beamten die Wohnung betreten bzw. durchsuchen, sodass in der Aufforderung, die Tür zu öffnen, ein Begleiteingriff zu einer Durchsuchung oder einem Betreten der Wohnung zu sehen ist.9