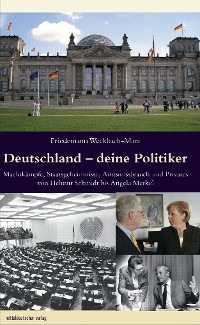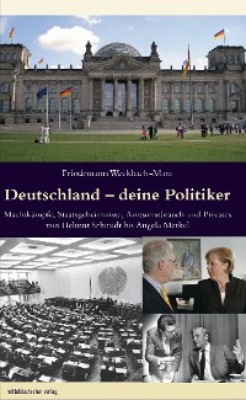Kitabı oku: «Deutschland – deine Politiker», sayfa 3
II.Geheimnisse um kranke Politiker
Ludwig Erhard stirbt
Heimlichkeiten beim Privatleben gab es lange Zeit erst recht im Umgang mit Krankheiten von Politikern. So blieb die verhängnisvolle Ursache für das Leiden von Ludwig Erhard20 für die Öffentlichkeit lange im Dunkeln, obwohl der Hergang sehr klar war: Der Vater des deutschen Wirtschaftswunders hatte sich Anfang März 1977 die Rippen schwer geprellt, als sein damals 33-jähriger Fahrer Dieter Räbsch mit 1,3 Promille einen leichten Verkehrsunfall baute. Der Fahrer bekam einen neuen Job als Bote. Erhard erholte sich von den Folgen des Unfalls nie mehr ganz. Zwar durfte er am 27. April das Krankenhaus verlassen, aber er hatte bereits Gedanken an den Tod. Erhard rief seine engsten Mitarbeiter zu sich: Die beiden Sekretärinnen Dorothea Bilda (seit 20 Jahren bei ihm) und Eva-Marie Schattenberg (seit 14 Jahren) sowie seinen engsten Vertrauten Karl Hohmann, schenkte jedem zum Abschied eine wertvolle Grafik des Mahlers Ernst Günter Hansing (1929–2001). Dann ordnete er seinen Nachlass: Die Ludwig-Erhard-Stiftung soll mit 1,5 Millionen D-Mark junge Wissenschaftler fördern. Außerdem verleiht sie jährlich eine 120 Gramm schwere Goldmedaille „für Verdienste um die soziale Marktwirtschaft“. Für die beiden Töchter wird eine halbe Million D-Mark in bar vorgesehen.

Ludwig Erhard bei einem seiner letzten Interviews
An diesem Mittwochabend sah Erhard sich das Fußballspiel Deutschland-Nordirland (5 : 0) im Fernsehen an, bekam aber schon nach dem Spiel wieder heftige Brustschmerzen und fuhr am folgenden Donnerstag mit einem Krankenwagen zurück ins Bonner Elisabethkrankenhaus. Chefarzt Dr. Hubert Westermann konnte die Schmerzen lindern und das Fieber auf 38 Grad senken. Der Vater des Wirtschaftswunders hing am Tropf und fiel meist in einen Dämmerschlaf. Bei einem kurzen Aufwachen am Abend des 2. Mai sagte er mit erstaunlich fester Stimme „Ich weiß, dass ich sterben muss.“ Das waren seine letzten Worte. Am Mittwoch, den 4. Mai, wurde seine Tochter Elisabeth Klotz an das Krankenbett ihres Vaters gerufen. Ein absolut zuverlässiger Informant erklärte mir, dass keine Hoffnung mehr bestehe und Erhard die kommende Nacht sicher nicht überstehen werde. Dazu durfte ich ihn als einen ungenannten Arzt zitieren: „Wir haben alles versucht. Es gibt keine Chance mehr.“ Mit dieser Exklusiv-Information entschieden wir uns für die Schlagzeile „Erhard stirbt“. Die „Bild“-Ausgabe vom 5. Mai war damit längst gedruckt, als Dr. Westermann um 2.50 Uhr offiziell den Tod feststellte. Sechs Stunden später erhoben sich Abgeordneten des Deutschen Bundestages von ihren Plätzen, um den großen Kollegen zu ehren, denn Erhard war seit 26 Jahren bis zu seinem Tode Abgeordneter. Beim Staatsakt erklärte Bundeskanzler Helmut Schmidt: „Wir Sozialdemokraten waren häufig ganz anderer Meinung als Ludwig Erhard, aber ich weiß schon seit langem und habe ihm das auch selbst gesagt: Der schnelle wirtschaftliche Aufstieg wäre ohne Ludwig Erhard so nicht möglich gewesen. […] Wir verneigen uns vor ihm in Dankbarkeit und Respekt.“ Bundespräsident Scheel appellierte: „Es ist an uns, ob wir sein Erbe in gedankenlosem Egoismus verschleudern oder aber zur Mehrung der Freiheit unserer Bürger nutzen.“ Bei diesem Staatsakt fehlte lediglich SPD-Chef Willy Brandt, der sich mit Genossen in Oslo traf.
Vertuschungsversuche und Todeskämpfe der Mächtigen
Beim späteren Bundeskanzler Helmut Schmidt21 sollte die erste schwere Erkrankung in seiner Amtszeit ganz geheim bleiben. Es ist der 12. Oktober 1981. Schmidt fliegt im Alter von 62 Jahren mit dem Hubschrauber zu seinem Arzt Dr. Völpel ins Bundeswehrzentralkrankenhaus von Koblenz. Offizielle Erklärung: „Fieberhafter Infekt.“ Diese Beschwichtigung war kein Einzelfall.

Helmut Schmidt beim Interview vor seiner Krankheit
So hatten „Spiegel“, Nachrichtenagenturen und Zeitungen bereits am 27. Januar 1981 gemeldet, Bundeskanzler Schmidt sei herzkrank und habe keine rechte Lust mehr am Regieren. Das Dementi des damaligen Regierungssprechers Kurt Becker: „Der Kanzler ist gesund und in einem erstklassigen Leistungszustand. Da müssen Intriganten am Werk gewesen sein, die ich aber noch nicht ausgemacht habe.“ Am 13. Oktober 1981 meldete Becker harmlos „einen fieberhaften Infekt“. Meine Recherche vor Ort ergab dagegen: Tatsächlich ist Schmidt während einer Voruntersuchung im Bundeswehrzentralkrankenhaus mehrmals bewusstlos geworden.
Statt der angeblichen Grippe beginnt unter Leitung von Professor Satter und Dr. Völpel um 17.00 Uhr der einstündige Eingriff: Unter örtlicher Betäubung erhält Schmidt einen Herzschrittmacher, 40 Gramm schwer, so klein wie eine flache Streichholzschachtel, gibt 70 Stromstöße in der Minute. Danach erstes Telefonat mit seiner Loki, die mir hinterher sagt: „Jetzt bin ich sehr erleichtert, dass er mir sagte, es geht ihm wieder besser.“ Seinem Vertrauten Wischnewski kündigt er an: „Nächste Woche bin ich wieder an Deck.“ Am 17. Oktober lässt Loki Schmidt ein weißes Papierband vor die Tür zum Krankenzimmer ihres Mannes spannen, zerschneidet es am Abend, als Helmut Schmidt die Tür öffnet: „Ein Symbol für den neuen Lebensabschnitt.“ Noch Jahrzehnte später erleben wir, wie er geistig topfit mit über 90 Jahren am Schreibtisch sitzt, Schnupftabak und Zigarette in der Hand Rauchverbote als „Prohibition“ (englisch ausgesprochen) abtut oder in Talkshows hellwach die große Politik erklärt.
Die damalige Geheimniskrämerei um die ersten Tage im Krankenhaus ist auch nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern das Werk des glücklosen Regierungssprechers Kurt Becker mit seinen 16 Monaten Amtszeit. Im Umgang mit Krankheiten seines Chefs hatte er sich offenbar an früheren Beispielen orientiert. So erlitt der damalige SPD-Chef Willy Brandt Mitte November 1978 einen Herzinfarkt. Erste vorsichtige Meldungen darüber dementierte die Parteizentrale energisch. Statt eine Lungenentzündung und einen Infarkt der vorderen Herzwand einzugestehen, beschimpften Brandt-Mitarbeiter die Journalisten und verbreiteten: „Der SPD-Vorsitzende hat eine Grippe. kein Anlass zur Sorge!“ Ähnlich ging auch Schmidts Amtsnachfolger Helmut Kohl22 Jahre später vor.
Im November 1995 erklärte das Bonner Bundeskanzleramt immer wieder, Helmut Kohl habe eine schwere Grippe und schone sich für die Asien-Reise. Kohls Helfer schilderten sogar detailliert, wie der Kanzler zu Hause in Oggersheim von Ehefrau Hannelore23 mit frischem Zitronen- und Orangensaft und heißem Tee kuriert werde. Doch das alles war nicht einmal die halbe Wahrheit: Tatsächlich hatte Helmut Kohl so starke Schmerzen, dass er in die Mainzer Universitätsklinik fuhr. Dort gab es statt Zitronensaft eine Operation an der Prostata. Gleichzeitig erfuhren wir, dass Kohl sechs Jahre zuvor schon einmal von Professor Rudolf Hohenfellner operiert wurde und 1992 ein zweites Mal.
Als das Magazin „Focus“ am 4. November um 8.16 Uhr die Nachricht über Kohls Prostata-Operation veröffentlichte, dementierte die Bundesregierung den Krankenhausaufenthalt des Kanzlers zunächst entschieden. Um 10.36 Uhr tickerte Reuter: „Bericht über Kohls Operation dementiert“. Dann, gegen 11.00 Uhr, erklärte ein Regierungssprecher vorsichtig: „Wir suchen jetzt nach einer offiziellen Sprachregelung.“ Um 12.04 Uhr tickerte die Agentur ap: „Kohl war doch an Prostata erkrankt – Neu: Bundespresseamt relativiert frühere Aussagen“. Kohl sei an einem „grippalen Infekt, verbunden mit einer Prostata-Infektion“ erkrankt.
◆
Noch dauerhafter als Schmidt und später Kohl verschwieg Vizekanzler Genscher seine Krankheiten. Über Jahre dementierte er heftig alle Berichte über Herzinfarkte. Davon ist mir der 24. November 1977 in besonderer Erinnerung. Für diesen Donnerstag hatten wir, wie Tage zuvor bereits angekündigt, die Leser aufgerufen, Vizekanzler, Außenminister und FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher bei uns in der Redaktion anzurufen. Zwei Extraleitungen waren für die Telefonaktion geschaltet. Der Ankündigungstext ließ auf einen erfolgreichen Tag hoffen: „Heute, wenige Tage nach der weltbewegenden Reise Sadats nach Israel, können Sie mit Bundesaußenminister Genscher zwischen elf und zwölf Uhr am ‚Bild‘-Telefon über alle wichtigen Fragen sprechen: Wird die FDP 1980 wieder mit der SPD zusammengehen? Was halten Sie von einer Großen Koalition? Wann gibt es eine internationale Konvention gegen Luftpiraten? Wird die Regierung neue Initiativen ergreifen, um die Zahl der Arbeitslosen von fast einer Million spürbar zu senken? Wie bewähren sich die CDU/FDP-Regierungen in Niedersachsen und im Saarland?“

Hannelore Kohl in der Bonner Beethoven-Halle (links meine Frau Ute)

Der junge Hans-Dietrich Genscher im Interview
Kurz nach neun Uhr kam ein Anruf, Genscher habe leider Fieber, deshalb müsse an seiner Stelle FDP-Fraktionschef Wolfgang Mischnick kommen. Spontan rief ich in Genschers Privatwohnung an. Seine Frau, die ich von zahlreichen Auslandsreisen an der Seite ihres Mannes kannte, wirkte bedrückt und meinte, es gebe einen Verdacht auf Herzinfarkt. Doch schon wenige Minuten danach rief Genschers Sprecher bei mir an und erklärte mit aller Bestimmtheit, ich hätte Frau Barbara Genscher falsch verstanden. Von Herzinfarkt könne keine Rede sein. Es gebe den Verdacht auf eine verschleppte Lungenentzündung. Deshalb sei er am späten Mittwochabend begleitet von seiner Frau in das Bonner Malteser-Krankenhaus gebracht worden. Das mussten wir so hinnehmen. Trotzdem habe ich in der Folgezeit mehrmals Genscher direkt darauf angesprochen. Er hat mir stets klipp und klar gesagt, es habe nie einen Herzinfarkt gegeben. Bei dieser glatten Lüge betonte er sogar: „Dass es keinen Herzinfarkt gab, kann man heute bei jedem EKG erkennen.“

Mit Barbara Genscher in Moskau
Erst im November 1981 gestand Genscher beim Redaktionsbesuch: „Ich hatte am 23. November 1977 einen Herzinfarkt. Deshalb musste ich damals sechs Wochen pausieren.“ Der dritte Herzinfarkt holte ihn im Sommer 1989 ein, dazwischen gab es immer wieder verschwiegene Herzrhythmusstörungen. 2005 kam ein lebensgefährlicher Darmverschluss hinzu und am 27. März 2012 musste er, gerade 85 Jahre geworden, an der Herzklappe operiert werden.
◆
Im Gegensatz zu Genscher ging Franz Josef Strauß24 mit seinen Erkrankungen offen um. Als es mit ihm zu Ende ging, wurde die Krankengeschichte traurig kompliziert. Der CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern steuerte noch mit seinen 73 Jahren leidenschaftlich gern das Flugzeug und wie Kenner bestätigten gekonnt. So auch bei seinem letzten Flug. Da gab es plötzlich einen Druckabfall in der Kabine. Begleiter berichteten, dass er „bilderbuchmäßig“ die Maschine im schnellen Sinkflug stabilisierte. Trotzdem bereitete der heftige Druckabfall den Passagieren erhebliche Unannehmlichkeiten. Für den Kreislauf älterer Menschen ein Problem, das oft länger anhält. Offenbar auch bei Strauß. Zurück in München, ging er mit Verteidigungsminister Rupert Scholz (CDU, bekannter Verfassungsrechtler, für ein Jahr bis April 1989 Verteidigungsminister) am 1. Oktober 1988 zum Oktoberfest und gleich anschließend auf die Jagd ins Revier des Fürsten Johannes von Thurn und Taxis.

Franz Josef Strauß, in Bonn auf der Straße zum Interview eingefangen
Um 16.00 Uhr bricht er vor der Jagdhütte zusammen. Herbeigeeilte Notärzte stellen „tiefe Bewusstlosigkeit“ fest und unternehmen die üblichen Wiederbelebungen. Dabei können schon mal Rippen brechen. Beim Luftröhrenschnitt erwischt es auch die Speiseröhre. Ein Rettungshubschrauber fliegt den Patienten ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg. Zusätzliches Medizingerät wird aus München eingeflogen. Doch Strauß wacht nicht mehr auf. Am 3. Oktober 1988 stirbt er um 11.45 Uhr. Nachfolger im CSU-Vorsitz wird Theo Waigel.
◆
Der große SPD-Politiker Peter Struck25 hatte da zunächst mehr Glück mit seinen Schlaganfällen und Herzinfarkten. Es ist der 24. Juni 2000. Ich fahre nichtsahnend zu dem sympathischen Vollblutpolitiker nach Uelzen. Er sitzt mir vergnügt mit der obligatorischen Pfeife gegenüber, da sehe ich eine frische Narbe am Hals. Freimütig erzählt er: „Ich war zur Routineuntersuchung beim Hausarzt und sagte ihm, dass ich wiederholt sekundenlang Sehstörungen habe. Da hat er mich direkt zum Chef der gefäßchirurgischen Abteilung unseres Krankenhauses hier in Uelzen geschickt. Mit Ultraschall und Computertomographie stellte der Arzt fest, dass meine Halsschlagader zu 95 Prozent verschlossen war. Kurz danach wurde ich operiert.“ Dabei wurden aus der zum Gehirn führenden Halsschlagader die Ablagerungen aus Kalk, Fettrückständen und Blutgerinnsel entfernt: „Wenn ich heute die Narbe im Spiegel sehe, wird mir bewusst: Ich war kurz vor einem Schlaganfall, wäre sicherlich linksseitig gelähmt und möglicherweise als Pflegefall im Rollstuhl gelandet. Ich bin froh, dass ich noch einmal davongekommen bin.“ Struck versprach damals seiner Frau Brigitte weniger Tabak und mehr Bewegung. Für seine Berliner Wohnung kaufte er einen Hometrainer, der aber schnell zum Kleiderständer mutierte. Die Pfeife blieb sein Markenzeichen, auch als im Reichstag ein Rauchverbot verhängt wurde.
Dann der nächste Schlag für ihn Anfang Juni. Spät und sehr müde geht Verteidigungsminister Peter Struck zu Bett. Es ist lange nach Mitternacht, da wacht er auf. Ihm ist übel, er fühlt sich wie gelähmt, versucht mit seinen Personenschützern zu telefonieren, heraus kommt aber nur unklares Gestammel. Die Leibwächter erkennen sofort, dass ein Notarzt kommen muss: „Chef, der Arzt ist schon unterwegs.“ Der Schlaganfall wird in der Charité behandelt. Die Öffentlichkeit erfährt nichts davon. Sein Sprecher und Freund Norbert Bicher erklärt die Abwesenheit des Ministers mit Kreislaufproblemen und einem Schwächeanfall. Zehn Wochen muss Struck um seine Rückkehr ins gesunde Leben kämpfen, seine Sprache wiederfinden. Gerüchte vom möglichen Schlaganfall kursieren in Berlin, aber Bicher schweigt so lange eisern, bis Struck wieder – wenn auch mit etwas Mühe – reden kann. Mitte August erklärt Struck seinen Schlaganfall in der Nacht vom 9. zum 10. Juni und fügt hinzu, dank der Behandlung in der Berliner Charité sei er jetzt wieder fit: „Die gesundheitlichen Probleme sind ausgeräumt – und ich bin wieder hundertprozentig einsatzfähig. Ich habe dem Kanzler gesagt: Du kannst auf mich zählen. Bis 2006 auf jeden Fall – und wenn der Wähler es will, dann auch darüber hinaus.“

Selbst in der „Challenger“ der Luftwaffe griff Peter Struck zur Pfeife
Auch diesmal raten ihm die Ärzte zu mehr Bewegung und das Pfeiferauchen aufzugeben. Wie zur Bestätigung sagt er mir: „Ich weiß, nach dem Schlaganfall ist vor dem Schlaganfall.“ Er nimmt zahlreiche Medikamente und ist froh, noch einmal davongekommen zu sein, denn mit erkennbaren Sprachproblemen wäre seine Politikerlaufbahn jäh zu Ende gegangen.
Stattdessen folgten noch glückliche Jahre, bis ihn der dritte Herzinfarkt kurz vor Weihnachten 2012 einholte. Die Beerdigung am 3. Januar verlief in Uelzen (vom Regenwetter abgesehen) ganz nach seinen Wünschen mit militärischen Ehren und beim Gottesdienst in St. Marien mit Bonhoeffers Lied „Von guten Mächten treu und still umgeben …“
So war das mit Schäuble wirklich
Ähnlich wie Struck nach seinem schweren Schlaganfall fürchtete auch Wolfgang Schäuble26 nach seiner schweren Schussverletzung trotz fortschreitender Genesung um seine politische Zukunft. Gemeint ist nicht der Rollstuhl, mit dem er sich unglaublich schnell zurechtfand, sondern eine Gesichtsoperation, die durch seine Schussverletzungen notwendig wurde. Diese OP war hochgradig riskant.
Dazu ein kurzer Rückblick auf das, was er seinen Unfall nennt. Den Vertrag zur Wiedervereinigung (294 Seiten lang) hatte Schäuble bis zum 31. August 1990 maßgeblich verhandelt. Nun ist Wahlkampf. Freitagabend, 12. Oktober. Sechs Beamte des Bundeskriminalamtes sichern die Umgebung und den Innenraum der Brauereigaststätte „Bruder“ in Oppenau (Schwarzwald). Ein Streifenwagen steht vor der Tür. Drinnen spricht Innenminister Wolfgang Schäuble über die Widervereinigung. 280 Zuhörer applaudieren lautstark. Um 21.55 Uhr geleitet der örtliche CDU-Chef Gerd Hoferer seinen prominenten Gast zum Ausgang. Dort wartet Schäubles Tochter Christine (damals 19). Als ihr Vater fast den Ausgang erreicht hat, zieht Dieter Kaufmann (damals 37) unter seiner Lederjacke eine entsicherte Pistole vom Typ „Smith & Wesson“, Kaliber 38, feuert aus 60 Zentimeter Entfernung und trifft den Minister mit zwei Kugeln in Brust und Unterkiefer. Die dritte Kugel verletzt Schäubles Leibwächter Klaus-Dieter Michalski (damals 28) an Bauch und Hand, als der Hauptwachtmeister schützend vor den Minister springt. Zehn Minuten später ist der Notarzt da. Eine Kugel steckt bei Schäuble noch im Kiefer, die zweite in der Wirbelsäule. Hubschrauber, Krankenhaus, Notoperation.
Der Täter gesteht, die Waffe seinem Vater gestohlen zu haben und erweist sich als psychisch krank.
Am nächsten Tag wacht Schäuble gegen 16.00 Uhr aus der Narkose auf. In einem langen Telefonat gibt er mir aus seinem Krankenzimmer das erste Interview. Dabei schildert er seine Umgebung so genau, dass mir unser Gespräch vorkommt, als wäre ich bei ihm vor Ort: Im hellgestrichenen Krankenzimmer der Rehaklinik von Langensteinbach sitzt neben einem Berg von Akten ein Mann, der sein schweres Schicksal akzeptiert hat. Gefasst und voller Zukunftspläne spricht er zum ersten Mal darüber: „Den Umständen entsprechend geht es mir inzwischen ganz ordentlich, wobei die Ungewissheit, was aus der Lähmung wird, bleibt. Ich konzentriere mich einstweilen darauf, das Leben im Rollstuhl zu lernen und hoffe, in absehbarer Zeit wieder zumindest zeitweilig in Bonn zu sein.“
In seinem Ministerium sind die schweren Türen schnell ausgetauscht, damit er sie vom Rollstuhl aus selbst öffnen kann, Fußschwellen werden beseitigt. Bald kann Schäuble mit dem Rollstuhl perfekt umgehen, sich selbst herausstemmen. Sein Privathaus in Gengenbach (Baden-Württemberg) wird rollstuhlgerecht umgebaut. Er meistert das neue Leben.


Wolfgang Schäuble auf Sylt vor dem Attentat und danach mit dem Hand-Bike
Doch da war noch ein anderes Problem, das Außenstehenden verborgen blieb: Die zweite Kugel hatte Schäubles Wange schwer verletzt. Da musste noch etwas geschehen. Dazu sagte er mir: „Mein Arzt hat zu Vorbereitung die Operation an einer Leiche geübt, denn er musste sehr vorsichtig mit den Nervensträngen sein. Ein Schnitt auch nur um einen halben Millimeter daneben und mein Gesicht wäre unweigerlich schief geblieben. Mit einem so schiefen Mund wäre meine Politikerlaufbahn zu Ende gewesen.“ Wäre. War sie aber nicht. Die Operation verlief erfolgreich.
Wie zäh er auch physisch kämpft, konnte ich später mehrmals erleben. So lud er mich zum Interview „mit Radtour“ in seine Heimat ein. Bei dem Wort entstand bei mir eine kleine Schrecksekunde der Sprachlosigkeit, bis er erläuterte: „Ich fahre mit meinem Hand-Bike.“ Gemeint war der Rollstuhl mit Handkurbel, die im Gegensatz zum Fahrrad parallel gedreht wird. Da mein Rad nicht in den Kofferraum ging, nahm ich meine Inline-Skates mit.
So fuhren wir gemeinsam über die asphaltierten Wege der Weinberge von Gengenbach in der Nähe von Offenburg. Er hielt problemlos das Tempo und zeigte mir mit einem Hauch von Stolz, dass sein T-Shirt über den starken Muskeln der Oberarme schon bedenklich spannte. Und in Berlin staunte ich jedes Mal, wenn wir uns beim Sommerfest des Bundespräsidenten trafen. Traditionell regnet es an dem Tag, zumindest ist meist der Rasen nass und schwer. Trotzdem schuftete Schäuble sich mit bewundernswerter Energie durch das Menschengetümmel.
Bei jeder Begegnung habe ich seine Energie gespürt, mit der er kämpft, privat wie in der Politik. Daher war es für mich geradezu selbstverständlich, dass Schäuble auch 2013 erneut für den Bundestag kandidierte.
◆

Georg Leber vor seiner Erkrankung
Bei dem legendären Sozialdemokraten Georg Leber ging es 1976 auch buchstäblich ums Überleben.
Am Dienstag, den 10. November, hat er bei starken Schmerzen im Bauchbereich 40 Grad Fieber. Die Wehrdebatte im Bundestag wird abgesetzt. Oberstabsarzt Dr. Schiefgen gibt ihm eine Penicillinspritze. Mitten in Generals- und Spionageaffären will Leber unbedingt weiter arbeiten. Mittwochmorgen sitzt Leber27 mit Schüttelfrost kreidebleich am Kabinettstisch (sein Staatssekretär kuriert gerade eine Lungenentzündung aus, der Generalinspekteur liegt mit Schädelbruch im Krankenhaus).
Schmerzgebeugt steigt er nach der Sitzung in seinen dunkelblauen Opel Diplomat, bricht auf der Fahrt zusammen. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn nach Koblenz ins Bundeswehrzentralkrankenhaus. In einer zweistündigen Operation entfernen die Ärzte den Blinddarm. Da wir seit Jahren vertrauensvoll miteinander umgehen, empfängt er mich früh in seinem Krankenzimmer, schenkt mir ein Bundeswehrtaschenmesser (wie scharf es ist, spürte unsere Tochter später unfreiwillig am Finger) und erzählt mir mit seiner tiefen, ruhigen Stimme: „Der Blinddarm war so vereitert, dass jeden Moment die akute Gefahr des Durchbruchs bestand. Ich hatte Riesenglück, dass ich noch einmal davongekommen bin.“
◆
Das konnte auch Johannes Gerster28 sagen, obwohl seine Chancen besonders problematisch waren. Die Diagnose: Krebs an den Lymphknoten.
Es ist Freitag, nicht gerade der 13., sondern der 23. April 1993, als wir uns in seiner Mainzer Wohnung treffen. Äußerlich ruhig erzählt der erfahrene CDU-Politiker: „Ende November kam ich nach einer langen Klausurberatung über Asylgesetze nach Hause mit einem dicken Hals. Meine Frau sagte gleich, das kommt nicht vom Ärger, morgen gehst du zum Arzt. Gut, dass ich ihrem Rat gefolgt bin, denn am folgenden Montag ging alles Schlag auf Schlag. Vom Hausarzt zum Radiologen. Mein Hals war wirklich inzwischen so geschwollen, dass Speise- und Luftröhre bereits verbogen wurden. Das hätte ich nicht lange überlebt. Am Donnerstag wurden mir Lymphknoten herausoperiert, um zu sehen, was los ist.“ Statt auszuruhen, fährt er wieder nach Bonn zu den Beratungen über neue Asylgesetze: „Ich wollte dabei sein, wenn wir das Ergebnis langer harter Arbeit einfahren.“ Danach zu Hause der nächste Besuch im Krankenhaus: „Die Ärzte machten so ein komisches Gesicht, das ließ nichts Gutes ahnen. Dann haben sie mir eröffnet, dass die Lymphknoten von Krebs befallen waren. Das nennen die Ärzte wohl Hodgkinsche Krankheit. Ich war zuerst sehr niedergeschlagen, bin richtig in die Knie gegangen. Dann habe ich an meine Familie gedacht, wie schwer es für sie ist, eine solche Nachricht aufzunehmen. Nach schweren Stunden und Tagen hatte ich mich wieder gefangen und bin seitdem entschlossen, zu kämpfen.“
Seine Frau Regina lädt zur Fischsuppe. Ihr Mann sinniert: „Wir sind Spatzen in Gottes Hand. Mir hat der Glaube sehr geholfen.“ Der Katholik fügt hinzu: „Ich weiß, ich kann die Krankheit niederkämpfen. Ich werde sie besiegen. Diesen Kampf aufzunehmen, ist die wichtigste Voraussetzung, um wieder gesund zu werden. Ich sage das auch offen, um anderen Mut zu machen, die vielleicht an dieser Krankheit verzweifeln würden.“ Ein bisschen Arbeit, aber nicht zu viel, ist sein Rezept. Deshalb hat er mit Bundeskanzler Helmut Kohl und Fraktionschef Wolfgang Schäuble verabredet, dass er „vorläufig keine Termine in Bonn wahrnehme. Nur an meiner wöchentlichen Sprechstunde halte ich eisern fest, denn ich meine, jeder Abgeordnete ist das seinen Wählern schuldig. Nachher wird es meine 1.984. Sprechstunde.“ Aus dem Kanzleramt erfahre ich, dass Kohl ihn schon morgens um 8.15 Uhr angerufen hat, um ihm Mut zu machen: „Gerster, du schaffst das schon.“
Nach Operationen und einer Chemotherapie über fünf Monate meint er: „Gestern war ich das letzte Mal für Stunden am Tropf, da habe ich heute noch Pudding in den Beinen. Als nächstes kommt die Bestrahlungstherapie auf mich zu.“ Er blickt auf den Rhein und fügt etwas trotzig hinzu: „Bis auf die eine Krankheit bin ich ja gesund. Freunde, Bekannte, meine Kinder und meine Frau sagen immer wieder: Du packst das doch. Heute bin ich überzeugt, sie haben Recht, ich werde es packen und komme in zwei Monaten wieder gesund nach Bonn zurück.“
Auf der Heimfahrt von diesem ergreifenden Termin rufe ich meine Frau an. Den Tränen nahe gestehe ich ihr: „Ich werde schreiben, was ich bei dem Treffen erlebt habe, aber es fällt mir schwer, seinen Optimismus und seine Hoffnung zu teilen.“ Erfreulicherweise ein Irrtum. Johannes Gerster habe ich als gesunden Freund noch Jahre später in Jerusalem und in Mainz getroffen.
◆
Ebenfalls mit großer Zuversicht ging Manfred Wörner (1934–1994, ab 1982 Bundesminister der Verteidigung und seit 1988 erster deutscher NATO-Generalsekretär) mit seiner Krebserkrankung um. Als ich Anfang Januar 1994 morgens mit ihm telefonierte, schwärmte er von seiner neuen Krebsdiät, die ihn heilen würde. Genau daran habe ich mich erinnert, als ich im März 2011 die Berliner Charité nach erfolgreicher Darmkrebsoperation verließ. Der großartige Chirurg Professor Dr. Joachim M. Müller gab mir mit auf den Weg: „Sie sind wieder gesund. Lassen Sie sich jetzt nichts Falsches einreden. Es gibt keine Diät gegen Krebs, leben Sie einfach gesund weiter.“ Das sah Wörner anders. Der sportlich-dynamische Jetpilot litt seit 1992 an Darmkrebs, wurde im April operiert, doch der Krebs kam wieder. Ende Juni 1993 dauerte die zweite Operation sechs Stunden. Dann rieten ihm seine Ärzte zur – wie sie es nannten – ‚Krebsdiät‘. Seit dem Sommer aß er nur noch Nüsse und Gemüse, kein Fleisch, trank jede Menge Karottensaft. Trotzdem musste er Mitte Dezember erneut operiert werden. Vorsorglich blieb er bis Heiligabend in der Klinik. Diesmal waren die Ärzte zuversichtlich, dass alles überstanden sei. Wörner selbst nannte es „ein Wunder“ und fügte hinzu: „Meine Ärzte waren selbst überrascht. Der Darm ist völlig krebsfrei. Nur an der Narbe saßen noch zwei Geschwülste, die aber schon in Auflösung waren.“ Seine Diät sollte die Gesundheit absichern. Leider ohne Erfolg. Am 13. August erlag Manfred Wörner dem Darmkrebs.

Johannes Gerster gesund in Jerusalem

Manfred Wörner im Interview
◆
Dagegen war die Krankheit von Hans Eichel geradezu eine Lappalie, mit der er im Februar 2001 er sehr offen umging. Gut beraten von seinem Sprecher Torsten Albig machte Eichel seinen Krankenhausaufenthalt ganz bewusst öffentlich: Als Ursache für seinen Bandscheibenvorfall wurde eine Verrenkung bei der Hausarbeit („Putzen“) des sparsamen Ministers genannt. Das kam gut an. War wohl auch fast wahr. Nach der Bandscheibenoperation besuchte ich ihn in seinem kargen Krankenzimmer. Professor Wolfgang Lanksch erklärte mir am ersten Februarwochenende 2001 im Eichel-Krankenzimmer: „Die Operation hat 50 Minuten gedauert. Es ist alles so gut verlaufen, dass Herr Eichel bereits am Freitag zum ersten Mal aufstehen konnte. Er wird auch schneller als sonst üblich am Montag oder Dienstag das Krankenhaus verlassen. Doch dann muss er mindestens 14 Tage kürzer treten, sich schonen. Am besten gar nicht sitzen, erst recht nicht im Flugzeug.“ Der Eingriff ist für Mediziner zwar Routine, doch Professor Lanksch schränkte ein: „Natürlich kann eine solche Operation auch schiefgehen. Wenn die Nervenwurzeln verletzt werden, hat der Patient hinterher noch mehr Lähmungserscheinungen und Schmerzen, die sogar chronisch werden können. In Deutschland gibt es etwa 40.000 bis 50.000 Bandscheibenoperationen. Ich muss aber leider sagen, dass viele davon gar nicht notwendig wären.“ Zur Vorbeugung, um einen Bandscheibenvorfall zu verhindern, wusste Professor Lanksch auch keinen Rat: „So was trifft selbst Hochleistungssportler genauso wie Nicht-Sportler. Ab dem 15. Lebensjahr degeneriert die Bandscheibe bei jedem Menschen. Das Einzige, was man wirklich raten kann, ist: möglichst wenig sitzen.“
Genau das nahm sich Hans Eichel zu Herzen: „In Zukunft vertausche ich meinen Schreibtisch mit einem Stehpult. Das finde ich ohnehin ganz angenehm.“ Angst hatte Eichel nach eigenen Worten vor der Operation „überhaupt keine. Mir geht es auch schon wieder richtig gut. Ich hoffe, bald ist alles wieder wie vorher.“ Wurde es auch.