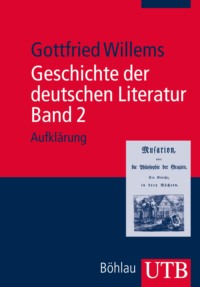Kitabı oku: «Geschichte der deutschen Literatur. Band 2», sayfa 3
2 Eine Reise zu Voltaire und Rousseau Kulturgeschichtliche Voraussetzungen der literarischen Entwicklung
2.1 James Boswell und seine „Grand Tour“
Nachdem wir uns erste Begriffe von der Aufklärung und ihrer Literatur erarbeitet haben, können wir es wohl wagen, uns mit einem großen Sprung mitten in die Welt des 18. Jahrhunderts hineinzuversetzen, mitten unter die, die die Aufklärung gemacht haben und denen sich das verdankt, was an Literatur aus jenen Jahren auf uns gekommen ist, mitten unter die Intellektuellen der Zeit, die „Philosophen“. Wir gehen in das Jahr 1764 zurück, in die Blütezeit der Aufklärung in Europa, und heften uns an die Sohlen eines jungen Mannes, eines Schotten mit Namen James Boswell, der seinerseits gerade dabei ist, diese Welt für sich zu entdecken, der nämlich eine der großen Bildungsreisen absolviert, wie sie damals in seinen gesellschaftlichen Kreisen üblich waren, eine sogenannte „Grand Tour“. Es handelt sich um einen jungen Mann mit den typischen Interessen derer, die an der Aufklärungsbewegung teilhaben – er selbst sagt von sich und seiner Reise, er sei „als Philosoph unterwegs“,14 und das heißt nichts anderes, als daß er als aufgeklärter Mensch in die Welt blickt – um einen Menschen überdies, der mit Vorliebe literarische Interessen verfolgt, so daß ihn seine Reise nacheinander zu den beiden berühmtesten Autoren der Zeit gebracht hat, zu Voltaire und Rousseau. Wir machen uns seine „Grand Tour“ also für unsere eigene Entdeckungsreise in die Welt des 18. Jahrhunderts zunutze.
Das können wir, weil James Boswell ein großer Schreiber von Tagebüchern und Briefen gewesen ist, wie so viele in seiner Zeit und in der
[<< 29] Seitenzahl der gedruckten Ausgabe
Schicht von Gebildeten, der er angehörte, einer, der alles, was ihm auf seiner Reise widerfuhr, mit großer Genauigkeit festgehalten hat, vor allem seine Begegnungen mit Menschen, bis hin zu den Gesprächen, die er mit ihnen geführt hat – so daß sich seine Beobachtungen und Erlebnisse gut nachvollziehen lassen, einschließlich seiner Begegnungen mit Voltaire und Rousseau.
Damit sind nun einige Aspekte der Alltagskultur berührt, denen bei der Beschäftigung mit der Literatur des 18. Jahrhunderts und insbesondere bei der Frage nach deren kulturgeschichtlichen Voraussetzungen seit jeher große Bedeutung beigemessen worden ist und die deshalb sogleich etwas genauer unter die Lupe genommen werden sollen: das Reisen, das Schreiben von Briefen und Tagebüchern und die Praktiken der Konversation. Aus dem Jahrhundert der Aufklärung hat sich – anders als aus früherer Zeit – eine große Zahl von Reiseberichten, Briefwechseln, Tagebüchern und Gesprächsnotizen erhalten. In ihnen lassen sich die Formen des kulturellen Lebens, aus denen die Literatur erwachsen ist, besonders gut greifen. So bezeichnen sie für uns nicht nur eine Quelle der Kulturgeschichte unter anderen, sondern geradezu den soziokulturellen Humus – oder jedenfalls doch ein Gutteil davon – aus dem seinerzeit die Pflanze der Literatur erwachsen ist, eben den Bereich der soziokulturellen Aktivität, der Einblick in die Art und Weise gewährt, wie die Alltagskultur und das literarische Leben zusammenhängen.
2.1.1 Reisebeschreibung, Tagebuch, Brief und Konversation als Quellen der Kulturgeschichte
Erneuerung und Aufstieg des Romans im 18. Jahrhundert
Eine der wichtigsten literaturgeschichtlichen Entwicklungen des 18. Jahrhunderts ist der Aufstieg des Romans, beginnend mit seiner Erneuerung in der Mitte des Jahrhunderts und endend mit seiner Apotheose als eigentliche und wahre Form der modernen Poesie durch die Literaturtheorie der Jenaer Frühromantik, durch die Brüder August Wilhelm und Friedrich Schlegel und Friedrich von Hardenberg, der sich als Autor den Namen Novalis gab. Der Roman wird in dieser Zeit von einer zwar populären, aber weithin als problematisch bewerteten Erscheinung am Rande dessen, was als Dichtung gilt, zu eben der Gattung, in der sich die Essenz der Poesie verkörpern soll. Noch
[<< 30]
Schiller hat den „Romanschreiber“ einen bloßen „Halbbruder“ des Dichters genannt;15 das entspricht einer langen Tradition, in der der Roman als moralisch und ästhetisch problematisch angesehen worden ist. Die Brüder Schlegel und Novalis hingegen wollen in den neunziger Jahren im Roman die Form aller Formen erblicken, den Inbegriff einer modernen, „romantischen“ Poesie.
Die Erneuerung des Romans seit der Jahrhundertmitte hat sich aber vor allem in den Formen des Reiseromans, Briefromans, Tagebuchromans und Gesprächsromans vollzogen. Um sogleich einige Beispiele zu nennen, sei für den Reiseroman auf „Candide“ (1759) von Voltaire, „Sophiens Reise von Memel nach Sachsen“ (1769 –1773) von Johann Timotheus Hermes und „Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich“ (1791 –1805) von Moritz August von Thümmel verwiesen, für den Briefroman auf „Pamela“ (1740) und „Clarissa“ (1747 –1748) von Samuel Richardson sowie „Julie ou La Nouvelle Héloïse“ (1761) von Jean-Jacques Rousseau, für den Tagebuchroman auf Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ (1774) – was äußerlich zwar ein Briefroman ist, sich bei näherem Zusehen aber als ein verkappter Tagebuchroman entpuppt, da überwiegend nur einer, Werther, Briefe schreibt – und für den Gesprächsroman auf zwei romanartige Gebilde von Denis Diderot, die von Schiller und Goethe ins Deutsche übersetzt worden sind: „Jacques le fataliste“ (entstanden 1773 –1775, dt. Teilübers. 1785) und „Le neveu de Rameau“ (entstanden 1762 –1774, dt. Übers. 1805).
Goethes Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ vom Ende des Jahrhunderts läßt sich formal als Vereinigung all dieser neuen Möglichkeiten des Romans begreifen. Als Basis der Handlung haben wir hier die Struktur der Reise – Wilhelm ist fast während des ganzen Romans auf Reisen – es gibt ausgedehnte Brief- und Tagebuch-Passagen und darüber hinaus auch viele lange Gespräche. Überdies sind eine ganze Reihe von lyrischen Gedichten in ihn eingelegt. So ist es kein Wunder, daß gerade Goethes „Wilhelm Meister“ für die Frühromantiker das große Beispiel für ihre Vorstellung vom Roman als Inbegriff einer
[<< 31]
modernen, „romantischen Poesie“ geworden ist, die Verkörperung dessen, was Friedrich Schlegel eine „progressive Universalpoesie“ nennt, die „alle getrennte Gattungen der Poesie wieder (…) vereinig(t)“.16
Kulturgeschichtliche Voraussetzungen
Hinter den neuen formalen Möglichkeiten des Romans als Reise-, Brief-, Tagebuch- und Gesprächsroman steht nun eben als reale kulturgeschichtliche Folie eine rege Kultur des Reisens, des Brief- und Tagebuchschreibens und des Konversierens, die ihrerseits auch schon in gewissem Maße literarische Züge annimmt, die nämlich die pragmatischen, vor- oder halbliterarischen, jedenfalls non-fiktionalen Formen der Reisebeschreibung, des in Buchform präsentierten Briefwechsels und Tagebuchs sowie der philosophisch-ästhetischen Gesprächsliteratur zeitigt. Die berühmteste Reisebeschreibung17 der Zeit stammt aus der Feder des Engländers Lawrence Sterne (1713 –1768) und trägt den Titel „A Sentimental Journey through France and Italy“ (1768); sie hat einer ganzen Unterströmung innerhalb Aufklärungsbewegung ihren Namen gegeben, dem Sentimentalismus; zu deutsch: Empfindsamkeit. Für den Brief18 seien hier nur die „Freundschaftlichen Briefe“ (1746) des vor allem als Lyriker bekannt gewordenen Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719 –1803) genannt. Das meistbeachtete Tagebuch 19 in deutscher Sprache ist das „Geheime Tagebuch“ (1772/1773) des Goethe-Freunds Johann Kaspar Lavater (1741 –1801). Und was die Gesprächsliteratur 20 anbelangt, so haben etwa viele Beiträge in den Zeitschriften des
[<< 32]
18. Jahrhunderts die Form eines Gesprächs. Die Theorie zu dieser Form findet sich früh im Jahrhundert bereits bei Shaftesbury, in dessen „philosophischer Rhapsodie“ „Die Moralisten“, mit dem Untertitel „Eine Wiedergabe gewisser Unterhaltungen über Natur und Moral“ (1709).
Neue Formen fiktionaler Literatur erwachsen bekanntlich gar nicht so selten aus pragmatischen, non-fiktionalen Textsorten; so auch hier. Der Reiseroman läßt sich als fiktive Reisebeschreibung begreifen, der Briefroman als fiktiver Briefwechsel, usw. In diesem Sinne sind die Kultur des Reisens, des Briefeschreibens und Tagebuchführens sowie die zeitgenössische Konversationskultur in der Tat als kulturgeschichtlicher Humus der Literatur einzustufen. Hierzu gehört übrigens auch die damals neue Form der Autobiographie,21 die vor allem für den Entwicklungs- und Bildungsroman als fiktive Biographie Bedeutung erlangt. Insgesamt haben wir hier also drei Ebenen zu unterscheiden: erstens die soziokulturelle Praxis des Reisens, Brief- und Tagebuchschreibens und der Konversation, zweitens deren Literarisierung in den non-fiktionalen Formen der Reisebeschreibung, des Tagebuchs und Briefwechsels in Buchform und der Konversations-Schule, und drittens deren Fiktionalisierung in Reiseroman, Briefroman, Tagebuchroman und dialogischer Literatur.
2.1.2 James Boswell als Autor der Aufklärung
Unser Reisender nun lebt und webt mit seinem ganzen Herzblut in dieser Welt vor- und halbliterarischer Formen, als passionierter Reiseberichterstatter, als Brief- und Tagebuchschreiber, als Protokollant von Gesprächen und als Biograph. Es ist ein junger Schotte, der in Deutschland nie besonders bekannt geworden ist, den aber in Großbritannien jeder Gebildete als Verfasser einer Biographie kennt, die in keinem gut sortierten Bücherschrank fehlen darf, der Biographie des Aufklärers Dr. Samuel Johnson.
[<< 33]
James Boswell
Der Name unseres Reisenden ist James Boswell.22 Er ist 1740 geboren, bei Antritt der Reise 1764 also 24 Jahre alt. Er stammt aus altem schottischem Adel, ist der älteste Sohn und Erbe des Laird of Auchinleck, eines Clan-Chefs, Gutsbesitzers und Landrichters. Und das sei sogleich festgehalten: er ist ein Mann von altem Adel; daran wird zu erinnern sein, wo von seinem Umgang mit bürgerlichen Literaten wie Voltaire und solchen kleinbürgerlicher Abkunft wie Rousseau die Rede ist. Der Vater hat Boswell zur Juristerei bestimmt, aber es zieht ihn zur Literatur, und das heißt: nach London, in das Zentrum der englischen Literatur. Und so liegt er eine Weile mit seinem Vater im Clinch. Dabei ist dann als Kompromiß herausgekommen, daß er seinem alten Herrn um den Preis der Fortsetzung seiner juristischen Studien die Finanzierung einer „Grand Tour“ abgehandelt hat, eben die große Bildungsreise, auf die wir ihn ein Stück des Wegs begleiten wollen.
Boswells „Grand Tour“
Boswells Reise ist wie jede „Grand Tour“ eine Reise nach Italien – warum gerade Italien? Dahinter steht noch der alte humanistische Bildungsgedanke. Sich bilden heißt, die Antike studieren. Wo aber könnte man die Antike besser studieren als in Italien, als auf dem „klassischen Boden“ Italiens, von dem Goethe in seinen „Römischen Elegien“ (1795) spricht, der selbst in den Jahren 1786 –1788 auch eine Italienische Reise absolviert hat, wenngleich anders, als es der Tradition entsprach, erst in vorgerücktem Alter. Denn die „Grand Tour“ machte man eigentlich mit Anfang der zwanziger Jahre, nach dem Studium, und nicht erst mit 37 Jahren wie Goethe. In Italien, etwa in Rom, konnte und kann man der Hinterlassenschaft der Antike unmittelbar begegnen.23 Die „Grand Tour“ von Boswell dauerte fast drei Jahre, von 1764 bis 1766, und sie führte ihn von den Niederlanden aus zunächst durch Deutschland und die Schweiz, sodann eben nach Italien, und von da über Korsika und Frankreich zurück nach England. Das war das Übliche, sowohl was die Route als auch was die
[<< 34]
Dauer der Reise anbelangt. Auch in Deutschland hat es sich Boswell übrigens nicht nehmen lassen, die seinerzeit berühmtesten Autoren aufzusuchen; so hat er in Leipzig sowohl bei Gottsched als auch bei Gellert vorgesprochen.24
Boswells Weg zur Literatur
Boswell hat dann nach seiner Rückkehr eine zeitlang in Schottland als Rechtsanwalt und Landrichter gearbeitet und sich auch als Politiker versucht. Wohlgemerkt: er hat als Rechtsanwalt gearbeitet; als Abkömmling eines altadligen Geschlechts hat er diesen Beruf ausgeübt, der doch als ein typisch bürgerlicher Beruf gilt. Das ist seinerzeit in England durchaus nichts Ungewöhnliches mehr gewesen. Also so, wie man sich das mancherorts vorstellt mit dem Gegensatz von Adel und Bürgertum, ist es offenbar im 18. Jahrhundert schon lange nicht mehr, jedenfalls nicht überall. Schließlich ist Boswell aber doch zur Literatur zurückgekehrt und hat bis zu seinem Tod 1795 in London ein der Kunst und Wissenschaft gewidmetes Leben geführt.
Literarischen Ruhm hat sich Boswell vor allem mit drei Büchern erworben, mit Büchern, die keine Literatur im engeren Sinne sind, keine Belletristik, sondern das, was wir heute ein Sachbuch nennen würden, Bücher freilich mit großen literarischen Qualitäten. Sie seien hier kurz vorgestellt, auch wenn sich damit der Zeitpunkt, an dem wir neben Boswell in seiner Reisekutsche Platz nehmen, noch ein wenig hinauszögert. Aber wir erhalten hier Gelegenheit, den Horizont eines aufgeklärten Literaten in der Jahrhundertmitte, in der Hochblüte der Aufklärung kennenzulernen, und zwar den Horizont eines Mannes, der keiner der großen Heroen der Aufklärung ist wie Voltaire und Rousseau, sondern nur einer ihrer kleinen Soldaten. Auch so, ja gerade so kann man sich mit den zentralen Anliegen der Aufklärung vertraut machen.
„Ein Bericht über Korsika“
Das erste Buch von Boswell ist ein unmittelbarer Ertrag seiner Grand Tour, basierend auf seinem Tagebuch, das Journal einer Reise durch Korsika, „An Account of Corsica“, 1769 erschienen. Warum Korsika ? In jenen Jahren gab es ein großes Interesse der aufgeklärten Welt an der kleinen Insel im Mittelmeer, denn die Korsen waren in einen Kampf um ihre Unabhängigkeit begriffen, damals schon, und dieser
[<< 35]
Kampf war seinerzeit europaweit von großem publizistischem Interesse. Korsika war Jahrhunderte lang eine Kolonie der Republik Genua gewesen und versuchte nun unter der Führung von Pasquale Paoli, die Herrschaft Genuas abzuschütteln. Paoli hat übrigens Rousseau gebeten, eine Verfassung für Korsika auszuarbeiten, der er mit seinem „Entwurf einer Verfassung für Korsika“ (1765) auch nachkam. Das alles endete damit, daß Genua Korsika an Frankreich verkaufte und Frankreich die Insel in Besitz nahm. Einen gewissen Rückhalt fanden die Korsen mit ihrem Streben nach Unabhängigkeit in England, wegen der See-Interessen Englands im Mittelmeer, und in diesem Zusammenhang ist wohl der Erfolg von Boswells Buch in England zu sehen.
Korsika ist ein erstes großes Beispiel, sozusagen das Modell dafür, daß der Kampf kleiner Völker für ihre Unabhängigkeit zu einem Thema wird, bei dem sich der moderne Intellektuelle zu engagierter Stellungnahme aufgefordert fühlt und publizistisch tätig wird. Nach Korsika kamen dann in den siebziger Jahren die englischen Kolonien in Amerika, der Unabhängigkeitskrieg der USA, kam im frühen 19. Jahrhundert Griechenland in seinem Kampf gegen die Türken, und so ging es immer weiter bis hin zu Vietnam und Nicaragua in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts.
Damit derlei zu einem großen Thema für den modernen Intellektuellen und engagierten Literaten werden kann, müssen offenbar folgende Voraussetzungen erfüllt sein: es muß sich um den Kampf eines kleinen Volks gegen einen übermächtigen Gegner handeln, der als Großmacht ökonomische Interessen verfolgt und der sich insofern gut für moralische Empörung eignet, wenn nicht gar für eine Stilisierung zum Bösen. Und es muß sich um einen Krieg in einer weit entfernten Weltgegend handeln, so daß sich die Unabhängigkeitsbestrebungen zum Freiheitskampf schlechthin stilisieren lassen, zu einem Kampf, in den sich alles hineinprojizieren läßt, was man an gesellschaftlichen und politischen Wunschvorstellungen hegt, unbehindert durch die Nahsicht der wirklichen Verhältnisse. Dafür ist Korsika ein erstes großes Beispiel, und dahin gehört Boswell mit seinem Korsika-Buch und gehört der Erfolg seines Buchs in der aufgeklärten Welt. Wie Boswell haben sich die modernen Intellektuellen und Literaten seither immer wieder dazu aufgerufen gefühlt, sich für Befreiungskriege in fernen Weltgegenden zu engagieren.
[<< 36]
„Ancient Poetry“, Präromantik
Das zweite Buch von Boswell, das seinerzeit nicht weniger berühmt geworden ist, ist „The Journal of a Tour to the Hebrides with Samuel Johnson“, 1785 publiziert. Die Hebriden sind Inseln im Nordmeer, nordwestlich vor der Küste von Schottland gelegen. Auch dieses Buch traf wieder einen Nerv der Zeit, wenngleich einen anderen als das Buch über Korsika. In den fünfziger, sechziger Jahren war es auf den Britischen Inseln Mode geworden, sich für sogenannte Ancient Poetry zu interessieren, für alte Sagen, Balladen und Lieder, deren Entstehung in die Zeit vor dem Humanismus, wenn nicht gar vor dem Christentum zurückreichte und die seinerzeit vom ungebildeten oder unverbildeten „Volk“ immer noch erzählt und gesungen wurden. Man spricht im Zusammenhang mit dieser Bewegung auch von Präromantik, denn das Interesse an literarischen Altertümern, die nicht aus dem Süden Europas, aus der antiken Welt stammen, sondern aus dem Norden und die sich in der Volkskultur erhalten haben, ist später dann vor allem von der Romantik kultiviert worden.
Das romantische Interesse an den Altertümern des Nordens ist also mitten in der Epoche der Aufklärung entstanden, und auch aus genuin aufklärerischen Impulsen heraus. Es verdankt sich dem Ausgehen der Aufklärung auf die Natur und alles, was sich als natürlich begreifen läßt, hier dem Ausgehen auf eine natürliche Dichtung, auf „Naturpoesie“. Denn eben dafür hat man jene volksläufigen Altertümer gehalten, übrigens auch noch zu Zeiten der Romantik. Das wichtigste Dokument dieses Interesses sind die „Reliques of Ancient Poetry“ (1765) von Thomas Percy (1729 –1811), ein Werk, auf das dann in der deutschen Szene Johann Gottfried Herder (1744 –1803) seit 1774 mit einer eigenen Sammlung von Volksballaden und Volksliedern geantwortet hat, einer Sammlung, die sich übrigens nicht scheut, auch aus Percy zu schöpfen. Das sind die berühmten „Stimmen der Völker“; dieser Titel ist allerdings erst 1778 hinzugekommen. Auch und gerade für Herder sind solche „Stimmen der Völker“, sind solche „Lieder des Volks“ „Naturpoesie“, „natürliche“ Dichtung.25
[<< 37]
Ein weiteres wichtiges Dokument dieses präromantischen Interesses an den Altertümern des Nordens, das in ganz Europa Furore gemacht hat, sind „The Works of Ossian“ – kurz: der „Ossian“ – von James Macpherson (1736 –1796), wie die Sammlung von Percy 1765 erschienen. Macpherson hat im schottischen Hochland und auf den Hebriden Sagen gesammelt und dann in einer von ihm erarbeiteten Form als Werke eines sagenhaften Sängers, eben des Sängers Ossian, publiziert. Dieser „Ossian“ wurde seinerzeit enthusiastisch aufgenommen; unter anderem hat Goethe im „Werther“ seitenweise aus ihm zitiert (HA 6, 108 –114). Herder hat den Sänger Ossian geradezu als einen Homer des Nordens gefeiert,26 was nicht sonderlich schwer war, da Macpherson stilistisch stark von Homer beeinflußt ist. Alt-Schottland, die Highlands und die Hebriden wurden so zu einer Art nordischem Pendant zur griechisch-römischen Antike, zum Ort einer eigentümlich nordischen Archaik, zum Schauplatz einer Romantik des urtümlich Nordischen. Das hat Wirkungen gehabt bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, bis zu Fontane, der selbst noch Schottland bereist und Balladen in schottischem Stil geschrieben hat.
Reisen und Literatur
Dahin also ist Boswell mit Dr. Johnson aufgebrochen, und von dieser Reise in den wilden, ursprünglich-natürlichen Norden, dem genauen Gegenstück zu seiner Reise in den Süden, nach Italien als Inbegriff der Bildungswelt des Humanismus, handelt sein zweites Buch. Die kurze Einleitung, die dem Ganzen vorangestellt ist, ist höchst aufschlußreich. Sie beginnt wie folgt:
Martins Buch über die Hebriden hatte uns seinerzeit auf den Gedanken gebracht, wir könnten auf jenen Inseln eine uns völlig fremde Lebensweise beobachten. Das einfache Leben in der wilden Natur, wie es sonst nur in fernen Ländern oder Zeiten vorkommt, hier aber in greifbare Nähe gerückt war, schien uns ein würdiger Gegenstand der Wißbegier.27
[<< 38]
Als etwas durchaus Typisches sei zunächst festgehalten, daß es sich hier um ein Reisen handelt, das eng mit der Welt der Literatur verknüpft ist. Es ist ein Buch, was die Idee zur Reise eingibt, und das Resultat der Reise ist auch wieder ein Buch. Man reist, weil man gelesen hat und weil man schreiben will, zumal wenn man wie Boswell der Überzeugung ist: „Es hat keinen Sinn, mehr zu erleben, als man aufzeichnen kann (…)“ (BB 15). Das gilt natürlich genauso für die Italienreisenden der Zeit, und es gilt für sie sogar in besonderem Maße. Gerade von Italien hat man ja im Zuge seiner humanistischen Bildung immerzu gelesen, wie die Beschreibungen von Italienreisen selbst auch wieder auf dieses humanistische Interesse rechnen können. Das bezeugt etwa noch Goethes „Italienische Reise“ (1816 –1817) mit großer Deutlichkeit. Diese Art des Reisens ist ein besonders charakteristisches Beispiel für die Art von literarisch vermittelter Welterfahrung einerseits und von erfahrungvermittelter Literatur andererseits, wie sie die Aufklärer, die „Philosophen“ als hommes de lettres kennzeichnen.
Die Suche nach dem „einfachen Leben in der wilden Natur“
Das Motiv von Boswells Reise nach den Hebriden ist, wie er schreibt, das Interesse an dem „einfachen Leben in der wilden Natur“. Das bezeichnet nun in der Tat ein zentrales Interesse der Aufklärer, ein Interesse, auf das man überall in der Literatur des 18. Jahrhunderts treffen kann und das seinerzeit etwas durchaus Neues gewesen ist. Reisen nach Italien sind Reisen zur Kunst, Reisen nach dem Norden sind Reisen zur Natur. Im 17., im 16. Jahrhundert, in den Zeiten des frühmodernen Humanismus, war die Einstellung zu dem „einfachen Leben in der wilden Natur“ noch eine ganz andere. Da war es in erster Linie der Morast, aus dem man herauswollte, aus dem man sich mit Hilfe von Kunst und Wissenschaft herausarbeiten wollte. Hier im 18. Jahrhundert wird es, wie es bei Boswell heißt, zu einem „würdigen Gegenstand der Wißbegier“ – ein besonders handfestes Beispiel für die Umorientierung von der Buchgelehrsamkeit auf die Natur.
Wir verbinden das Interesse am „einfachen Leben in der wilden Natur“, den „retour à la nature“, das Zurück zur Natur heute vor allem mit dem Namen von Rousseau. Aber dieses Interesse ist schon vor Rousseau am Werk, und es bezeugt sich allenthalben in den Schriften der Aufklärung. Hier sei nur an das wichtigste frühe Beispiel der deutschen Literatur erinnert, das Lehrgedicht „Die Alpen“ von Albrecht von Haller aus dem Jahr 1729; damals hatte Rousseau
[<< 39]
überhaupt noch nicht publiziert. Bei Haller richtet sich das Interesse am „einfachen Leben in der wilden Natur“ erstmals auf die Schweizer Bergwelt; Haller ist ja von Hause aus Schweizer gewesen. Später findet sich dann auch ein entsprechendes Kapitel in Rousseaus Roman „Julie oder Die neue Héloïse“, eine Reise des Helden in das Wallis, das strukturell als Gegenbild zu dem überfeinerten, verdorbenen, „entfremdeten“ Leben in der großen Stadt Paris gesetzt wird.28 In jenen Jahren begann man erstmals, freiwillig, zu Bildungs- und Erholungszwecken die Alpen zu bereisen, und es entstand jenes Bild der Schweiz, das noch heute dem Schweiz-Tourismus zugrunde liegt. Zu dieser neuen Mode der Reisen in die Schweiz gehört etwa auch eine Reise des jungen Goethe 1775, und gehört noch die entsprechende Reise von Kleist, der 1801 auf den Spuren Rousseaus aus Paris an die Aare flieht. Und literarisch ist das neue Bild der Schweiz dann z. B. in Schillers „Wilhelm Tell“ fruchtbar geworden: das „einfache Leben in der wilden Natur“ als Basis für die Erkundung des Geists der Freiheit. Die Reise in die Schweiz, ein Seitenstück zur Reise von Boswell und Dr. Johnson nach den Hebriden, und beides Gegenstücke zu der bis dahin üblichen Italienreise.
Die Suche nach der Natur in „fernen Zeiten“
Boswells kurze Einleitung zu seinem Bericht von der Reise nach den Hebriden gibt zu erkennen, daß das aufklärerische Interesse am „einfachen Leben in der wilden Natur“ vor allem drei Felder findet, auf denen es sich ausleben kann. Das erste Feld: „ferne Zeiten“, will sagen: frühe Zeiten, frühgeschichtliche Verhältnisse als Zeugnisse eines ursprünglich-natürlichen Lebens. In diesem Sinne hat man sich seinerzeit vor allem folgenden Bereichen des kulturellen Erbes mit neuem Interesse zugewandt: 1. dem Alten Testament der Bibel, als Zeugnis für das Leben der sogenannten „Patriarchen“, der Noah, Abraham, Isaak, Joseph; eine zeitlang war das ein beliebter Gegenstand für Dramen und Epen, kultiviert vor allem von Bodmer und seiner Schule; 2. Homer: wenn schon Antike, dann die älteste Antike, die früheste Zeit der alten Griechen, und die findet man eben bei Homer, in der „Ilias“ und der
[<< 40]
„Odyssee“; 3. dem Ossian, als Zeugnis altnordischen Lebens; hier denke man an das Echo bei Herder und Goethe; und 4. in Deutschland dann auch der Frühzeit der Germanen, der Zeit Hermanns, des Cheruskers, jenes Arminius, der den Römern die Schlacht im Teutoburger Wald geliefert hat; dafür finden sich Beispiele bei Klopstock. All diesen Feldern des Interesses an „fernen Zeiten“ kann man dann bei Herder gemeinsam begegnen, der in der deutschen Tradition besonders viel für das präromantische Interesse und das Interesse an der Geschichte überhaupt getan hat. Die Welt der alttestamentarischen Patriarchen, die Welt Homers, die Welt Ossians und die Welt Hermanns gehören für Herder als Zeugnisse früher, ursprünglich-natürlicher Verhältnisse des menschlichen Lebens zusammen.
Die Suche nach der Natur in „fernen Ländern“
Das zweite Feld, auf dem das aufklärerische Interesse am „einfachen Leben in der wilden Natur“ auf seine Kosten kommt, sind „ferne Länder“, nämlich die weite Welt des Kolonialismus außerhalb von Europa: Amerika, die Karibik, Afrika, Asien, die Südsee, und hier besonders Tahiti, wie es dem europäischen Leser in den siebziger Jahren durch die Reisebeschreibungen von Louis-Antoine de Bougainville (1729 –1811), dem Namenspatron der exotischen Bougainvillea, und James Cook (1728 –1779) nahegebracht worden war – noch heute ein beliebtes Ziel für zivilisationsmüde „Aussteiger“. Das bekannteste Beispiel dafür, wie dieses Interesse zu Literatur wird, ist der Roman „Die Abenteuer des Robinson Crusoe“ von Daniel Defoe (1660 –1731) aus dem Jahr 1719. Da wird das „einfache Leben in der wilden Natur“ in der Südsee angesiedelt. Aus diesem Interesse an „fernen Ländern“ ist aber nicht nur der literarische Exotismus, sondern auch die moderne Ethnologie, die moderne „Völkerkunde“ erwachsen, als ein neuer Zugang zur Anthropologie.
Die Suche nach der Natur „in greifbarer Nähe“
Und das dritte Feld ist eben jenes „einfache Leben in der wilden Natur“, das man, wie es bei Boswell heißt, „in greifbarer Nähe“ findet, bezeichnen die Inseln eines altertümlich-naturnahen Lebens innerhalb der Grenzen von Europa. Ihm gegenüber formiert sich ein Interesse, das über die entsprechende Literatur hinaus die „Volkskunde“ als eine Art europäische Binnen-Ethnologie hervorgebracht hat. Und mit diesem „volkskundlichen“ Interesse blickt man nun eben auf die Hebriden, oder auf die Alpenregionen der Schweiz oder, um ein deutsches Beispiel zu nennen, auf Westfalen mit seinen patriarchalischen
[<< 41]
Lebensformen. Für Westfalen ist etwa Justus Möser (1720 –1794) mit seinen „Patriotischen Phantasien“ zu nennen, ein vierbändiges Werk, das 1774 –1778 erschienen ist und einen nicht unerheblichen Einfluß auf die deutsche Literatur gehabt hat.
Motive und Grenzen des Interesses an der „wilden Natur“
Zu einem „würdigen Interesse der Wißbegier“ werden diese Inseln eines altertümlich-einfachen Lebens in und mit der Natur natürlich zunächst nur in den Augen derer, die in ihm, wie Boswell formuliert, „eine uns völlig fremde Lebensweise“ erblicken, die nämlich selbst fern von der „wilden Natur“ leben; die ein keineswegs „einfaches“ Leben, sondern in städtischem oder höfischem Ambiente das komplizierte, zivilisatorisch verfeinerte, überdrehte und abgehobene Leben eines modernen Intellektuellen führen. Aus dem Kontrast zu einem als überbildet begriffenen Leben heraus wird das „einfache Leben in der wilden Natur“ für sie interessant.
Die sich von daher für das naturnahe Leben interessieren, behaupten nun keineswegs alle gleichermaßen, das einfache Leben sei das bessere Leben, so wie das Rousseau gelegentlich, aber nicht immer getan hat. Sie finden zunächst einmal nur, daß es da etwas zu lernen gäbe darüber, wie der Mensch von Natur aus sei; das aber heißt keineswegs immer schon, daß sie in dem einfachen Leben das Modell eines besseren Lebens erblicken würden. So ist es jedenfalls bei Boswell und Dr. Johnson. Zumal Dr. Johnson erweist sich als ein moderner Großstadtmensch, der das Herumziehen in der schottischen Wildnis vor allem als unbequem und gefährlich erlebt. Überhaupt steht er dem präromantischen Interesse eher skeptisch gegenüber; so hat er z. B. den „Ossian“ von Anfang an für eine Fälschung des Herrn Macpherson gehalten, nicht ganz zu Unrecht, wie wir heute wissen. Für Dr. Johnson ist das „einfache Leben in der wilden Natur“ vor allem primitiv, nämlich beschwerlich und langweilig. So hat Boswell denn auch immer wieder von Johnsons Heimweh nach London und dessen städtischen Annehmlichkeiten zu berichten, oder davon, daß sich Dr. Johnson, sobald ein schottischer Gutshof erreicht ist, als erstes in das vertraute Ambiente der Bibliothek zurückzieht, um dort den Bücherbestand zu sichten. Dabei stößt er übrigens selbst in den entlegensten Regionen immer wieder auf die neusten Highlights des aufgeklärten Schrifttums – ein Indiz dafür, wie rasch die neuen Ideen verbreitet wurden und wie weit sie dabei gelangten.