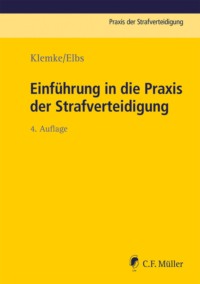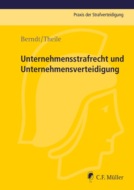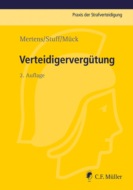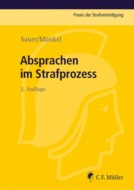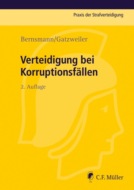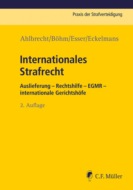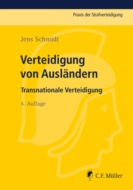Kitabı oku: «Einführung in die Praxis der Strafverteidigung», sayfa 11
b) Kontakt zu Zeugen und Strafantragsberechtigten
184
Der Verteidiger darf, selbst wenn dies auch heute noch so mancher Staatsanwalt und Richter nicht zu glauben vermag, Zeugen befragen oder sonstige eigene Ermittlungen anstellen. Die Strafverfolgungsorgane haben kein Erstvernehmungsrecht.[26] Der Verteidiger darf auch solche Tatsachen und Beweismittel einführen, die einen von ihm lediglich für möglich gehaltenen Sachverhalt belegen können. Er ist nicht darauf beschränkt, nur das vorzubringen, von dessen Richtigkeit er voll überzeugt ist. Sonst müsste er alle vom Mandanten aufgestellte Behauptungen, bevor er sie zum Gegenstand von Beweisanträgen macht, eingehend nachprüfen. Könnte er Zweifel an der Richtigkeit der Beweistatsachen nicht ausschließen, würde er gehindert, effektiv die Rechte seines Mandanten wahrzunehmen.[27] Dies gilt insbesondere für die Benennung von Zeugen. Hat er lediglich Zweifel an der Richtigkeit einer potentiell entlastenden Zeugenaussage, ist er zur Stellung eines Beweisantrages in aller Regel verpflichtet. Anderenfalls würde er in Kauf nehmen, ein möglicherweise zuverlässiges entlastendes Beweismittel zu unterdrücken.[28] Besser ist es jedoch, wenn der Verteidiger potentielle Zeugen vorab befragt. So vermeidet er, dass er einen Zeugen benennt, der den Mandant belastende Tatsachen bekunden könnte. Der Verteidigerspruch „frage nie einen Zeugen, wenn du die Antwort nicht kennst“ bewahrheitet sich im Verteidigeralltag immer wieder.
185
Der Verteidiger sollte jedoch bei dem Umgang mit Zeugen die größtmögliche Vorsicht walten lassen. Anderenfalls läuft er Gefahr, bald selbst mit einem Ermittlungsverfahren überzogen zu werden. Der Strafverteidiger ist verpflichtet, seinen Mandanten im Rahmen der Gesetze bestmöglich zu verteidigen.[29] Er ist nicht verpflichtet, an der Verwirklichung des staatlichen Strafanspruches mitzuwirken. Er hat schon gar nicht für die Richtigkeit von Zeugenaussagen einzustehen und ist insbesondere nicht verpflichtet, eine Falschaussage zu verhindern.[30] Er überschreitet jedoch nach der Rspr. die Grenzen zulässiger Verteidigung, wenn er den Sachverhalt aktiv verdunkelt oder verzerrt, insbesondere Beweisquellen verfälscht.[31] Bei einer von ihm sicher als unwahr erkannten Zeugenaussage verdunkelt er dann aktiv den Sachverhalt, wenn er Einfluss auf das Zustandekommen der Aussage nimmt.[32] Dies ist dann der Fall, wenn er den Zeugen zu einer Falschaussage veranlasst[33], wenn er ihn in seinem Entschluss bestärkt[34], wenn er einen zur Falschaussage entschlossenen Zeugen als Beweismittel benennt[35] oder wenn er den Inhalt der Falschaussage mit ihm abstimmt.[36] Hier macht sich der Verteidiger nicht nur wegen Strafvereitelung strafbar, sondern auch wegen Teilnahme an einem Aussagedelikt.
186
Dem Verteidiger ist es erlaubt, Strafantragsberechtigte zu bitten, einen Strafantrag zurückzunehmen oder gar nicht erst zu stellen oder einen sonstigen Zeugen zu veranlassen, keine Strafanzeige zu erstatten. Der Bereich des unzulässigen Verhaltens wird erst bei dem Einsatz von rechtswidriger Drohung oder Täuschung betreten. Geldzahlungen sind dann zulässig, wenn sie zumindest auch als Wiedergutmachung geleistet werden.[37] Der Verteidiger darf unter den gleichen Voraussetzungen Zeugen bitten, von einem Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 52 StPO oder einem Auskunftsverweigerungsrecht gem. § 55 StPO Gebrauch zu machen.
187
Der Verteidiger ist des Weiteren befugt, Zeugen dahin Auskunft zu erteilen, dass sie Ladungen zu Vernehmungen durch die Polizei nicht Folge leisten müssen. Dasselbe muss auch für einen entsprechenden Rat gelten, einer solchen Vernehmung fernzubleiben oder einen übersandten Zeugen-Fragebogen nicht zu beantworten.
c) Unterdrückung, Verfälschung und Vernichtung von Sachbeweisen
188
Es ist allgemeine Meinung, dass der Verteidiger selbst keine Spuren oder Beweisstücke vernichten, verstecken oder sonst den Strafverfolgungsorganen aktiv entziehen darf. Ihm ist es auch unter Strafe verboten, unechte Beweisurkunden herzustellen oder echte zu verfälschen. Er darf auch nicht vorsätzlich von derartigen Urkunden Gebrauch machen. Beteiligt sich der Verteidiger an der Fälschung von Urkunden bzw. an strafbarer Urkundenunterdrückung durch den Mandanten oder einen Dritten, macht er sich wegen Anstiftung oder Beihilfe zum jeweiligen Urkundendelikt strafbar. Der Verteidiger darf und muss dem Gericht allerdings auch solche Urkunden vorlegen, an deren Echtheit er Zweifel hegt.
189
Anders sieht es jedoch aus, wenn der Verteidiger dem Beschuldigten den Rat gibt, Spuren oder Beweisgegenstände, die nicht den Begriff einer Urkunde oder einer technischen Aufzeichnung erfüllen, zu unterdrücken oder zu beseitigen. Mangels strafbarer Haupttat kann sich der Verteidiger hieran nicht in strafbarer Weise beteiligen. Dies schließt auch eine Bestrafung wegen Strafvereitelung aus. Die h.M. ist anderer Rechtsauffassung. Sie zieht sich zur Begründung der Strafbarkeit des Verteidigers auf folgende, aus dessen Organstellung hergeleitete, schwammige Floskeln zurück:
„Der Verteidiger darf grundsätzlich alles tun, was in gesetzlich nicht zu beanstandender Weise seinem Mandanten nützt (BGHSt 38, 345, 347)... Allerdings muss er sich bei seinem Vorgehen auf verfahrensrechtlich erlaubte Mittel beschränken, und er muss sich jeder bewussten Verdunkelung des Sachverhaltes und jeder sachwidrigen Erschwerung der Strafverfolgung enthalten (BGHSt 2, 375, 377). Ihm ist es insbesondere untersagt, durch aktive Verdunkelung und Verzerrung des Sachverhalts die Wahrheitserforschung zu erschweren, insbesondere Beweisquellen zu verfälschen (BGHSt 9, 20, 22; 38, 345, 348; BGH NStZ 1999, 188).“[38]
190
Daher wird der Verteidiger zur Vermeidung eigener Strafverfolgung von derartigen Ratschlägen seinem Mandanten gegenüber Abstand nehmen. Auch hier hat er – bereits zur Sicherung seiner beruflichen Existenz – den sichersten Weg zu gehen und damit die h.M. in Rspr. und Lit. zu berücksichtigen. Im Übrigen sollte er sich immer vor Augen halten, dass es dem Ansehen der Profession des Strafverteidigers abträglich ist und auf lange Sicht zu einer Schwächung der Strafverteidigung führt, wenn er im Hinblick auf seine berufsrechtliche Wahrheitspflicht „zu kühn“ agiert.
Teil 1 Das Mandat des Strafverteidigers › III. Zulässiges und unzulässiges Verteidigerhandeln › 4. Ehrdelikte
4. Ehrdelikte
191
Die wichtigsten Berufswaffen des Strafverteidigers sind das Wort und die Schrift.[39] Im Kampf um das Recht kann dies leicht zu einem Einsatz sprachlicher Mittel führen, welcher zumindest von den betroffenen Verfahrensbeteiligten (Staatsanwälten und Richtern) als verletzend empfunden wird. Äußerungen oder Prozesserklärungen des Verteidigers sind nicht schon von vornherein strafrechtlicher Würdigung entzogen, weil sie im Rahmen der Verteidigung abgegeben werden. Grundsätzlich gelten die Straftatbestände für jedermann, mithin auch für den Verteidiger.
a) Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG
192
Wertende Äußerungen über Verhalten und Person der anderen Prozessbeteiligten stehen auch im Prozess grundsätzlich unter dem Schutz des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG. Zusätzlich können auch der Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG und der grundrechtlich geschützte Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG betroffen sein.
aa) Werturteile
193
Bei Werturteilen handelt es sich stets um von Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG geschützte Meinungsäußerungen, weil sie „immer eine geistige Wirkung erzielen, nämlich andere überzeugen wollen“.[40] Meinungen sind durch die subjektive Beziehung des Einzelnen zum Inhalt seiner Aussage geprägt.[41] Werturteile fallen generell in den Schutzbereich des Grundrechts auf Freiheit der Meinungsäußerung, ohne dass es darauf ankäme, ob die jeweilige Äußerung emotional oder rational,[42] begründet oder grundlos,[43] wertvoll oder wertlos,[44] richtig oder falsch,[45] nützlich oder schädlich,[46] gefährlich oder harmlos[47] ist. Für sie ist das Element der Stellungnahme, des Dafürhaltens[48] und des Meinens im Rahmen einer geistigen Auseinandersetzung kennzeichnend[49] bzw. konstitutiv, so dass sie sich auch nicht als wahr oder unwahr erweisen lassen und es auf den Wert, die Richtigkeit, die Vernünftigkeit der Äußerung nicht ankommt. In den Schutzbereich dieser Verfassungsnorm fallen – namentlich im öffentlichen Meinungskampf – auch scharfe[50], übersteigerte[51], polemische[52] oder verletzende[53] Äußerungen.
194
Nicht mehr geschützt sind jedoch beleidigende Äußerungen, in denen es den sich Äußernden nicht mehr um die Auseinandersetzung in der Sache geht, sondern die sich in einer Schmähung anderer Verfahrensbeteiligter erschöpft.
bb) Tatsachenbehauptungen
195
Tatsachenbehauptungen unterscheiden sich von den Meinungsäußerungen.[54] „Im Unterschied zu den Werturteilen steht bei ihnen die objektive Beziehung zwischen der Äußerung und der Realität im Vordergrund“[55], weshalb sie auch einer Überprüfung auf ihren Wahrheitsgehalt zugänglich sind.[56] Gerade unabhängig von den subjektiven Auffassungen des sich Äußernden soll etwas als objektiv gegeben hingestellt werden. Tatsachenbehauptungen fallen deswegen aber nicht von vornherein aus dem Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG. Da sich Meinungen in der Regel auf tatsächliche Annahmen stützen oder sich auf tatsächliche Verhältnisse beziehen, sind Tatsachenbehauptungen durch das Grundrecht der Meinungsfreiheit geschützt, weil und soweit sie Voraussetzung der Bildung von Meinungen sind. Auch Tatsachenbehauptungen genießen also den Schutz des Grundrechts, wenn (und soweit) sie meinungsbezogen sind.[57] Der Schutz der Tatsachenbehauptungen durch das Grundgesetz endet (erst) dort, wo sie zur Meinungsbildung nichts beitragen können.[58]
cc) Vermischung von Tatsachen und Werturteilen
196
„Die Abgrenzung von Meinungsäußerung und Tatsachenbehauptung kann schwierig sein, weil beide häufig miteinander verbunden werden und erst gemeinsam den Sinn einer Äußerung ausmachen. In diesem Fall ist eine Trennung der tatsächlichen und der wertenden Bestandteile nur zulässig, wenn dadurch der Sinn der Äußerung nicht verfälscht wird. Wo das nicht möglich ist, muss die Äußerung im Interesse eines wirksamen Grundrechtsschutzes insgesamt als Meinungsäußerung angesehen und in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit einbezogen werden, weil anderenfalls eine wesentliche Verkürzung des Grundrechtsschutzes droht.“[59]
197
„Sofern eine Äußerung durch die Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens oder Meinens geprägt ist, fällt sie in den Schutzbereich des Grundrechts. Das muss auch dann gelten, wenn sich diese Elemente, wie häufig, mit Elementen einer Tatsachenmitteilung oder -behauptung verbinden oder vermischen, jedenfalls dann, wenn beide sich nicht trennen lassen und der tatsächliche Gehalt gegenüber der Wertung in den Hintergrund tritt. Würde in einem solchen Fall das tatsächliche Element als aus schlaggebend angesehen, so könnte der grundrechtliche Schutz der Meinungsfreiheit wesentlich verkürzt werden.“[60]
198
Meinungsäußerungen, die (untrennbar) mit Tatsachenbehauptungen verbunden sind, fallen zwar in den Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG, ihre Schutzwürdigkeit kann jedoch vom Wahrheitsgehalt der ihnen zugrunde liegenden tatsächlichen Annahme abhängen.[61] Sind diese erwiesen unwahr, „wiegt ein Eingriff von vornherein weniger schwer als im Fall nicht erwiesen unwahrer Tatsachenangaben[62], bzw. tritt die Meinungsfreiheit regelmäßig hinter den Persönlichkeitsschutz zurück.
b) Schranken der Meinungsfreiheit
199
Das Grundrecht der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG findet seine Schranken in den allgemeinen Gesetzen, zu den auch die ehrschützenden Bestimmungen der §§ 185 ff. StGB gehören. Die Ausstrahlungswirkung des Grundrechts verlangt bei der Anwendung der strafrechtlichen Norm regelmäßig eine Gewichtung der Beeinträchtigung, die der persönlichen Ehre von der umstrittenen Äußerung auf der einen und der Meinungsfreiheit von einer Verurteilung auf der anderen Seite droht.[63] Dabei sind alle wesentlichen Umstände zu berücksichtigen. Zu den wesentlichen Abwägungsgesichtspunkten gehört auch die Funktion, in welcher der sich Äußernde seine ehrkränkende Behauptung aufgestellt hat. Dies gilt auch für Äußerungen eines Rechtsanwalts in einem strafrechtlichen und berufsrechtlichen Zusammenhang.[64] Danach darf ein Rechtsanwalt im Rahmen seiner Berufsausübung auch starke, eindringliche Ausdrücke und sinnfällige Schlagworte benutzen und sogar ad personam argumentieren.[65] Es kommt dabei nicht darauf an, dass der Anwalt seine Kritik auch anders hätte formulieren können.[66]
200
„Ein Rechtsanwalt darf die Interessen seines Mandanten gegenüber Gerichten und Behörden mit Nachdruck und Entschiedenheit vertreten. Im Rahmen dieser Aufgabe kann er mit anderen Verfahrensbeteiligten nicht immer so schonend umgehen, dass diese sich nicht in ihrer Persönlichkeit beeinträchtigt fühlen. Bei dem von ihm geführten,Kampf um das Recht„ ist es ihm vielmehr erlaubt, eindringliche, drastische Ausdrücke und Formulierungen zu verwenden sowie Urteilsschelte zu üben und auch,ad personam„ zu argumentieren, um z.B. eine mögliche Voreingenommenheit eines Richters zu kritisieren.“[67]
201
Dementsprechend hat das Kammergericht in der zitierten Entscheidung einen Rechtsanwalt vom Vorwurf der Beleidigung freigesprochen, der in Schriftsätzen im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Zivilmandaten ein richterliches Urteil mit den Worten angegriffen hatte, dass dieses „Teil einer bedauerlicherweise mehr und mehr um sich greifenden Verwilderung der Justiz und Durchsetzung mit Personenkreisen (sei), welche besser anderweitig eingesetzt würden“ und hatte der Richterin vorgeworfen, durch ihre Entscheidung einen Bürger „jedweder Rechte zu berauben“. Bezüglich eines anderen Richters hatte er geäußert, dass diesem „entweder die Vorschrift des § 812 BGB nicht bekannt (war) oder es liegt ein Fall der Beugung des Rechts vor... Die Justiz kann sich nach Auffassung des Unterzeichners weder Richter leisten, welche zu dumm sind, noch solche, welche absichtlich Fehlurteile produzieren.“
c) Wahrnehmung berechtigter Interessen gem. § 193 StGB
202
Auffällig ist, dass die Fachgerichte im Zusammenhang mit den Ehrdelikten die Grenze zwischen zulässigem und unzulässigem Verteidigerverhalten nicht bereits im objektiven Tatbestand ziehen, sondern vielmehr die Prüfung auf der Rechtfertigungsebene vornehmen.[68] Nach Wohlers ist dies u.a. dem Umstand geschuldet, dass die Fachgerichte der Judikatur des BVerfG zur Bedeutung der Meinungsfreiheit im Rahmen von Verteidigerverhalten Rechnung tragen wollen. Den unter Verwendung eines sehr differenzierten begrifflichen Instrumentariums stark auf den konkreten Einzelfall abstellenden Vorgaben der verfassungsrechtlichen Rspr. lässt sich im Rahmen des § 193 StGB sehr viel einfacher entsprechen als etwa durch die teleologische Reduktion des objektiven Tatbestandes.[69]
203
§ 193 StGB enthält für die Beleidigungstatbestände besondere Rechtfertigungsgründe. So sind u.a. Äußerungen, welche zur Ausführung oder Verteidigung von Rechten oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen gemacht werden, nur insoweit strafbar, als das Vorhandensein einer Beleidigung aus der Form der Äußerung oder aus den Umständen, unter welchen sie geschah, hervorgeht.
204
Ehrverletzende Äußerungen, die in Kenntnis ihrer Unwahrheit oder trotz offenkundiger Unhaltbarkeit gemacht werden oder herabsetzende Äußerungen, zu welchen der Verfahrensbeteiligte oder der Verfahrensablauf keinen Anlass gegeben haben, die in keinem Zusammenhang mit der Rechtsverfolgung stehen, sowie beleidigende Wertungen, die auf grob leichtfertiger Prüfung der Schlüssigkeit von Tatsachenbehauptungen beruhen, sind durch § 193 StGB nicht gedeckt.[70] Der Rechtsanwalt darf nicht leichtfertig für seinen Mandanten ehrkränkende Schlussfolgerungen tatsächlicher Art ziehen oder ohne tatsächliche Anhaltspunkte ins Blaue hinein die Gegenpartei oder Zeugen verdächtigen, Straftaten begangen zu haben.[71]
205
Der Verteidiger sollte niemals andere Verfahrensbeteiligte in Gesprächen mit seinem Mandanten oder Dritten oder in entsprechenden Schreiben schmähen. Solche beleidigenden Äußerungen sind Straftaten, die nicht durch § 193 StGB gedeckt sind, das sie nur bei Gelegenheit der Verteidigung getätigt werden.[72] Der Verteidiger wird zu beachten haben, dass das Mandatsverhältnis zwischen Strafverteidiger und Beschuldigtem keinen generell „beleidigungsfreien Raum“ begründet, da es sich um eine geschäftsmäßige und nicht durch persönliche Bindung geprägte Beziehung handelt.[73] Zudem ist die Vertraulichkeit in diesem Verhältnis nur einseitig abgesichert, da nur der Rechtsanwalt nach § 43a Abs. 2 BRAO, § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.
d) Sachlichkeitsgebot gem. § 43a Abs. 3 BRAO
206
Erfüllt der Rechtsanwalt im Zusammenhang mit seiner Berufsausübung in Wort, Schrift oder Tat die Tatbestände der §§ 185, 186 und 187 StGB, so ist dies zugleich ein als Berufspflichtverletzung zu ahndender Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot. Im Falle einer herabsetzenden Äußerung liegt auf der anderen Seite erst dann eine Berufspflichtverletzung vor, wenn sie nach Inhalt und Form als strafbare Beleidigung zu beurteilen und nicht durch die Wahrnehmung berechtigter Interessen gedeckt ist.
e) Fazit
207
Zwar kann der Verteidiger bei seinen Äußerungen im Rahmen seiner Berufsausübung sehr weit gehen, ohne gleich eine Strafverfolgung wegen eines Ehrdeliktes befürchten zu müssen.[74] Den ihm zustehenden Spielraum sollte er jedoch keineswegs ausschöpfen. Grundsätzlich sollte der Umgang des Verteidigers mit den Justizorganen von Respekt und Verständnis für die „jeweils unterschiedlichen Aufgaben bei der Verwirklichung des Rechts getragen sein und nicht a priori von Aggression.“[75] Dies bedeutet jedoch keine Anbiederei und keinen Kuschelkurs. Selbst wenn der Verteidiger die Einstellung der anderen Verfahrensbeteiligten in der Sache auch nicht ansatzweise teilen, billigen oder auch nur respektieren kann, hat er den Richter und den Staatsanwalt zwar als Prozessgegner, nicht jedoch als persönliche Feinde anzusehen und zu behandeln. Korrektheit in der Form, Härte und Kompetenz in der Sache[76] sowie Sachlichkeit in den Äußerungen sind die Eigenschaften, mit denen sich der Verteidiger den notwendigen Respekt bei den anderen Verfahrensbeteiligten verschafft.
Teil 1 Das Mandat des Strafverteidigers › III. Zulässiges und unzulässiges Verteidigerhandeln › 5. Geldwäsche durch die Annahme von Verteidigerhonorar
5. Geldwäsche durch die Annahme von Verteidigerhonorar
208
Nach dem Wortlaut des § 261 Abs. 2 Nr. 1 StGB erfüllt auch der Verteidiger den Straftatbestand der Geldwäsche, der von seinem Mandanten Geld als Honorar entgegennimmt[77], das aus einer Vortat im Sinne von § 261 Abs. 1 S. 2 StGB herrührt, soweit er vorsätzlich handelt oder die Bemakelung des Geldes leichtfertig nicht kennt, vgl. § 261 Abs. 5 StGB. Das Verteidigerhonorar kann damit zum Ausgangspunkt eines Strafverfahrens gegen den Verteidiger selbst werden, mit der weitreichenden Folge, dass der Verteidiger zum Beschuldigten mutiert. Aufgrund dieser potentiellen, alltäglichen Gefährdung des Verteidigers ist auf den Meinungsstand zur Geldwäsche durch den Verteidiger in Lit. und Rspr. einzugehen.