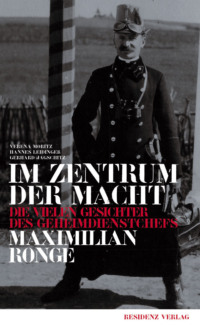Kitabı oku: «Im Zentrum der Macht», sayfa 4
Ansonsten bot das Jahr, in dem das 50-jährige Thronjubiläum des Kaisers gefeiert wurde, jede Menge Abwechslung für den jungen Ronge. Er machte Dutzende Ausflüge in die Umgebung Wiens, besuchte Onkel und Tanten, bestritt Kegelabende mit seinen Kameraden, ging häufig in die Oper und ins Theater, lauschte den Darbietungen des Männergesangsvereins Hietzing, wohnte dem Faschingsumzug in Ober St. Veit bei und schwang bei mehreren Gelegenheiten das Tanzbein. Zum Beispiel beim Hofball, der Opernredoute, dem Concordia-Ball oder dem Margaretener Bürgerball. Den Rot-Kreuz-Ball eröffnete er mit Fräulein Josefine Ratzenhofer. Seine „Kranzeldame“ bei der Hochzeit des Bruders Adolf am 21. Juni 1898 hieß Wilhelmine Nowak. Treffen gab es außerdem immer wieder mit einer Mizzi Richter. Die Familien dieser drei Damen waren offenbar mit den Ronges bekannt, denn die Ratzenhofers, Nowaks und Richters werden oft gemeinsam mit der Schwester Albertine, den Brüdern Adolf und Franz sowie der Schwägerin Rosa angeführt.58 Ob Ronge auf Freiersfüßen wandelte, bleibt der Fantasie eines jeden überlassen.
Wenn er damals liiert gewesen ist, dann verfügten seine Angebetete und er nur über wenig Zeit, ihre Gefühle auch auszuleben. Im Herbst 1898 nämlich verließ Max Ronge Wien. Etwa ein Jahr lang diente der Kaiserjäger als „Proviantoffizier des detachierten 2. Bataillons“ sowie als „Administrator und Rationsoffizier“ in Rovereto.59 Sein Stationierungsort befand sich unweit der Grenze zu Italien, das 1881 dem bereits bestehenden Bündnis zwischen der Habsburgermonarchie und dem Deutschen Reich beigetreten war und es solcherart zum so genannten Dreibund erweitert hatte. Ronge lernte nun eine Gegend kennen, die im Zuge des Ersten Weltkriegs heiß umkämpft werden sollte. Sein Aufenthalt in Südtirol legte wahrscheinlich den Grundstein für das spätere Misstrauen gegenüber Italien. Hier erging es ihm offenbar ähnlich wie Franz Conrad von Hötzendorf. Dieser, ab 1906 Generalstabschef, hatte spätestens seit seinen Dienstjahren im Süden des Reichs Vorbehalte gegenüber den Italienern sowohl diesseits als auch jenseits der Grenzen der Monarchie. Ronges Abneigung gegenüber den Nachbarn und jenen Italienern in der Monarchie, die eine Vereinigung mit dem Königreich Italien anstrebten, hinderte ihn allerdings nicht daran, sein Italienisch aufzubessern und Venedig zu besuchen. Dieses Mal das echte und nicht die künstliche Praterversion. Die Ausgaben für die Visite in der Lagunenstadt hielt er ebenso penibel fest wie die monatlich fällige Miete für sein Quartier in Rovereto. Eine Erhöhung seiner bescheidenen Gage war nicht in Sicht. Die einzige Möglichkeit, das Einkommen zu steigern, bestand darin, Karriere zu machen und außerhalb der üblichen „Rangtour“ befördert zu werden. Genau das schwebte Leutnant Ronge vor.
In der Kaderschmiede
Wer Ambitionen hatte und in weiterer Folge zu den „Flaschengrünen“ – so wurden die Generalstäbler wegen der Farbe ihrer Uniformen genannt – gehören wollte, der meldete sich zur Kriegsschule. Den Entschluss dazu fassten viele noch während ihrer Ausbildungszeit an der Akademie. Andere entschieden sich erst angesichts eines wenig spannenden Alltags bei der Truppe zu diesem Schritt. Max Ronge hat sein Aufnahmegesuch im November 1898 verfasst.
Doch verfügten bei allem mit einer Position im Generalstab verbundenen Prestige die Flaschengrünen in der zivilen Welt nicht immer über den allerbesten Ruf. Selbst Armeeangehörige dachten mitunter schlecht von den Kollegen „ganz oben“. Ihre Machtfülle erzeugte Skepsis, ihre, so meinten Kritiker, „eingebildete gottähnliche Unfehlbarkeit“ rief den Eindruck abgehobener Selbstüberschätzung hervor.60 Ressentiments entwickelten sich nicht zuletzt aufgrund des beschleunigten „Avancements“ der Generalstäbler. Deren Wartezeiten auf Zuerkennung einer höheren Charge waren nämlich um ein Vielfaches kürzer als bei den so genannten „Troupiers“ oder Truppenoffizieren. Diese wiederum hielten die Herren vom Generalstab für praxisfremd. Daher sprachen sie ihnen auch die Fähigkeit ab, abseits des grünen Tisches den Anforderungen eines vor konkrete Aufgaben gestellten Offiziers entsprechen zu können. Die Troupiers nannten die Kappe der Generalstäbler abschätzig „Hirnprothese“61, während andere die Flaschengrünen als die Repräsentanten einer hoch und höchst qualifizierten Militärelite regelrecht verehrten.
Der junge Kaiserjäger Maximilian Ronge gehörte gewiss zu Letzteren. Er erfüllte alle Voraussetzungen, um zur Vorprüfung für die Kriegsschule zugelassen zu werden: Truppendienstleistung sowie eine günstige Beurteilung durch die Vorgesetzten. Außerdem war er noch weit von der mit 30 Jahren angesetzten Altersgrenze entfernt. Die Vorausscheidungen fanden an mehreren Orten der Monarchie statt. Im Jänner 1899 reiste Leutnant Ronge nach Innsbruck, um dort, beim 8. Infanterie-Truppen-Divisions-Kommando die mehrere Tage dauernde Prüfung abzulegen. Mit ihm traten 237 weitere Kandidaten an. Getestet wurde das Allgemeinwissen ebenso wie der Wissensstand in verschiedenen militärischen Bereichen. Fast die Hälfte der jungen Offiziere fiel durch. Die, die es geschafft hatten, bekamen, ihren Leistungen entsprechend, eine Rangnummer zugeteilt. Maximilian Ronge schnitt am besten von allen ab. Besonders überzeugen konnte er seine Prüfer in den Fächern „Waffenlehre“ sowie „Befestigung und Festungskrieg“.62 Wieder zeigte sich der Ehrgeiz eines jungen Mannes, der seine Karrierepläne mit bemerkenswerter Konsequenz vorantrieb.
Gleich nach dem Triumph bei den Vorprüfungen musste Ronge wieder nach Rovereto fahren. Dort legte er erfolgreich eine Italienischprüfung ab. Im Juli kam der eifrige Leutnant dann nach Wien, und im September 1899 trat er zur Hauptprüfung für den Eintritt in die Kriegsschule an. Er ging ins Rennen um einen von zirka 100 verfügbaren Studienplätzen. Der Leutnant schrieb Klausuren, wurde aber auch mündlich geprüft. Zum Beispiel in Geschichte, wo es um Österreich im Revolutionsjahr 1848 ging. Oder in Französisch, wo er über die Schlacht von Narwa, die 1700 von den Schweden im Kampf gegen die Truppen des russischen Zaren gewonnen worden war, zu referieren hatte.63 Nach dem Prüfungsmarathon suchte er Ablenkung in der Musik. Die „Fledermaus“ erschien ihm offenbar am geeignetesten. Diese Strauß-Operette, die mit Texten wie „Glücklich ist, wer vergisst…“ wohl bei jedem an dieser Musikgattung noch so desinteressierten Österreicher auch heute einen Aha-Effekt hervorruft, sah Max Ronge bis an sein Lebensende unzählige Male.
Glück im Vergessen suchen musste Ronge damals aber keineswegs. Er schaffte die Aufnahmeprüfung, ein Platz in einer der beiden Jahrgangsklassen der Kriegsschule war ihm sicher. Klassenkameraden Ronges waren neben dem schon erwähnten Ernst Streer von Streeruwitz auch Rudolf Kundmann, später Adjutant des Generalstabschefs Franz Conrad von Hötzendorf, und sein Neustädter Kommilitone, Moritz Fischer von Ledenice.
Kaum ein ehemaliger„Frequentant“ der Kriegsschule, der in seinen Erinnerungen nicht über diese Ausbildungsphase schreibt. In einem sind sich fast alle einig: es war keine schöne Zeit. Man musste, so August Urbanski stellvertretend für viele andere, auf „Freizeit und Zerstreuung, Vergnügen und ungezügelte Lebensfreuden freiwillig verzichten“. Die Rede ist außerdem von „Entsagungen verschiedenster Art, rücksichtsloser Aufbietung der geistigen und körperliche Kräfte“, von „materiellen Opfern und Verzicht auf die Betätigung eigener Individualität“.64
Zwei Jahre lang drückten also junge Männer zwischen 25 und 30 noch einmal die Schulbank. Folge war ein mitunter typisch schülerhaftes Verhalten, man spielte sich gegenseitig Streiche, als säße man noch in der Realschule.65 Das alles passierte überdies zu einer Zeit, wo, schreibt Stefan Zweig, ein Mann von dreißig Jahren noch als unreifer Charakter angesehen wurde und selbst der Vierzigjährige noch nicht in verantwortungsvollere Positionen gelangte.66 Mit einer Schule im herkömmlichen Sinne hatte die Ausbildung der Kriegsschüler allerdings nichts zu tun. Und das „Lausbubenhormon“, wie es Ernst von Streeruwitz ausdrückt67, wurde nicht zuletzt deswegen ausgeschüttet, um sich über die Absurdität hinwegzuretten, sich als erwachsener Mann wie ein Taferlklassler fühlen zu müssen.
Während die Qualität des Unterrichts nicht immer entsprach und es Lehrer gab, die mehr durch Starre im Denken als durch Kompetenz auffielen, wurde in puncto Strenge und Anforderungen nach Superlativen gestrebt. Dem enormen Druck hielten nicht alle Frequentanten der Kriegsschule stand: August Urbanski beispielsweise musste miterleben, dass einer seiner Jahrgangskameraden Selbstmord beging.68 Über 40 Wochenstunden Unterricht, ständige Leistungskontrollen und im Sommer anstrengende Mappierungsreisen, taktische Übungen im Freien und lange Märsche – so sah zwei Jahre hindurch auch Maximilian Ronges Alltag aus.
Erziehung zum Streber?
Oft blieb den Frequentanten nicht einmal zum Essen Zeit. Dann musste man sich mit einem Kaffee beim so genannten „Kriegsschulsperl“, heute als Café Sperl beliebt und bekannt, begnügen. Die Kriegsschule selbst befand sich ein paar Schritte entfernt in der Dreihufeisengasse, gleich hinter dem Theater an der Wien.69
Es wurde, so der Ronge-Freund Otto Wiesinger, „ein überarbeitetes, vielfach nervöses Korps junger Männer großgezüchtet, das außerordentlich fleißig, arbeitswillig war, keine Zeit, keine Grenze in der Beanspruchung kannte und dann vielfach auch von den Untergebenen Übermäßiges verlangte“.70 Andere gingen mit ihrer Kritik an der Ausbildung noch weiter: Es habe sich bei der Kriegsschule um eine reine „Prüfanstalt“ gehandelt, wo es in erster Linie um das Nachbeten des vorgetragenen Stoffes ging. Auf der Strecke blieben Eigenständigkeit, Selbstverantwortung, Praxisnähe und jegliche Art von Individualität. In der Kriegsschule begann, so stellten es die Kritiker dar, „die Erziehung zum so genannten ,Wolkenschieben‘ oder ,Traumdeuten‘. Man merkte sich nur Prinzipielles und lernte dazu ein paar Schlagworte, mit denen man jonglieren konnte.“71 Besonders vernichtend fiel das Urteil des Offiziers Hans Mailáth-Pokorny aus: „Marionetten wurden gezüchtet, die jeweilig genau wussten, was zu denken vorgeschrieben war. Daß es offiziell immer hieß, man lege auf freie Meinung Gewicht, das war eine Farce und wurde durch die Tatsachen laufend widerlegt. Wie hätte man erwarten können, dass solche Automaten unvermittelt vor eine schwere Entscheidung gestellt, befähigt erscheinen würden, selbständig zu handeln. Das war von diesen Puppenfiguren zu viel verlangt.“72
Kritiker der Kriegsschule bezogen sich aber nicht nur auf die als mangelhaft, ja kontraproduktiv empfundene Ausbildung der Frequentanten. Dass der hohe Konkurrenzdruck unter den Kriegsschülern zu charakterdeformierendem Strebertum führen konnte, wurde spätestens im Jahre 1909 öffentlich diskutiert, als der Fall des Kriegsschulabsolventen Adolf Hofrichter allgemeines Aufsehen erregte. Da nur eine begrenzte Anzahl der Frequentanten nach Ende der Ausbildung auch tatsächlich dem Generalstab zugewiesen wurde, verschickte Hofrichter, der nicht berücksichtig worden war, als Potenzmittel getarnte Zyankalipillen an seine Konkurrenten. Auf diese Weise erhoffte er sich, doch noch Zugang zum erlesenen Kreis der in Friedenszeiten weniger als 700 Generalstäbler der Monarchie zu bekommen. Einer der ahnungslosen Empfänger von Hofrichters Paketen nahm die als Werbesendung getarnten Tabletten ein und starb. Hofrichter wurde nach vielen Ermittlungspannen ausgeforscht und zu zwanzig Jahren schweren Kerkers verurteilt. Seinen Unschuldsbeteuerungen schenkte man keinen Glauben.73
Maximilian Ronge interessierte sich für den Skandal rund um Adolf Hofrichter noch Jahre nach dessen Verurteilung. In seiner im Nachlass verwahrten umfangreichen Sammlung von Zeitungsausschnitten sind auch einige Berichte über das Schicksal des mutmaßlichen Giftmörders vorhanden. Nach dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie war dieser begnadigt worden. In weiterer Folge fand er Anschluss an die österreichischen Nationalsozialisten der Zwischenkriegszeit.74
Dass ein Mann wie Hofrichter von der Kriegsschule mit der Note „sehr gut“ abgehen konnte, warf damals, 1909, ein schiefes Licht auf die Ausbildung der Generalstabsanwärter. Welches Zeugnis sollte man, hieß es, einer Pädagogik ausstellen, die ein Ausleseprinzip anwandte, das Verbrecher hervorbrachte? Einmal mehr geißelte man ein System, das nach Menschen suchte, die der äußeren Form nach entsprachen, ohne auf ihre tatsächlichen Befähigungen und Veranlagungen hin geprüft worden zu sein. Im Sarajewoer Tagblatt vom 28. November 1909 war vor dem Hintergrund der Hofrichter-Affäre zu lesen: „Die Frequentierung der Kriegsschule, dieser höchsten militärischen Fachschule, erfordert Leute mit ganz gesunden Nerven und vollstem moralischen Gleichgewichte. Wo diese Kardinaltugenden den zum Generalstabsoffizier bestimmten Herren fehlen, da erfolgt früher oder später immer der Zusammenbruch.“75
Max Ronge, der am 1. Mai 1900 zum Oberleutnant befördert worden war76, absolvierte die Kriegsschule mit „sehr gutem Erfolge“.77 Im Oktober 1901 hielt er sein Abschlusszeugnis in Händen. Was nun? Würde er den Aufstieg in den Generalstab schaffen? Oder war alles umsonst gewesen, all die Anstrengung vergeblich?
Aufstieg
Investiert in seine Karriere hatte Ronge nicht nur viel Zeit, sondern wahrscheinlich auch eine Menge Geld. Die Lehrbehelfe, die er benötigte, waren alles andere als billig, und seit einiger Zeit schon wohnte er nicht mehr bei seiner Familie, sondern in einer Mietwohnung, die dem Stadtzentrum näher lag als das Elternhaus in Ober St. Veit. Vierzig Kronen monatlich musste er allein hierfür seiner „Hauswirtin“ zahlen.78 Die mit seiner Beförderung zum Oberleutnant verbundene Erhöhung der Gage war gleichzeitig nicht gerade großzügig ausgefallen.79
Auch der ehemalige Kriegsschüler Julius von Lustig-Prean erinnerte sich später an die mit beträchtlichem materiellem Aufwand verbundene Ausbildungszeit. „Ich glaube“, schrieb er, „dass nicht viel mehr als 10% der Absolventen die Kriegsschule ohne Schulden verliessen.“80 In dieses Bild passt auch der ins Jahr 1907 datierende Selbstmord eines hochverschuldeten Kriegsschülers.81 Mehr Glück hatte hingegen der spätere ungarische Ministerpräsident Gyula Gömbös. Seine schon während der Ausbildung an der Kriegsschule angehäuften Schulden beglich „mit Rücksicht auf seine Brauchbarkeit im Generalstabe“ die „Militärkanzlei Seiner Majestät“.82
Es erscheint nachvollziehbar, dass nach den vielen Mühen der Kriegschuljahre, nach all den Belastungen in psychischer, physischer und auch pekuniärer Hinsicht die Enttäuschung jener, die nicht dem Generalstab zugeteilt wurden, groß gewesen sein muss. Ihnen brachte das Zeugnis der Kriegsschule wenig bis gar nichts. Nicht einmal finanzielle Vorteile hatten sie bei ihrer Rückkehr zur Truppe zu erwarten. So dienten sie meist als unwillige Troupiers und mussten zusehen, wie ihre Kollegen vom Generalstab vorzeitig befördert wurden und die Karriereleiter hinaufkletterten.83
Der Oberleutnant Maximilian Ronge entging dem Schicksal eines frustrierten Truppenoffiziers. Er wurde „für die Zuteilung zum Generalstabe sehr geeignet“ befunden. In den diesbezüglichen Unterlagen seiner Lehrer heißt es: „Ein gediegener, sehr verlässlicher Offizier“, „sehr zäh und leistungsfähig“, „klarer Kopf, denkt und handelt zielbewusst“, „gründlich arbeitend“. Außerdem, so die Beurteilung, verfüge er über eine rasche Auffassungsgabe und sei von „ruhigem, gutmütigen Temperament“. Erwähnung fanden außerdem Ronges „feine Umgangsformen“ und der Umstand, dass er offenbar ein „außerordentlich beliebter Kamerad“ gewesen war. Lobend hervorgehoben wurde auch seine Fähigkeit, selbstständig Entschlüsse zu fassen.84 Diese Würdigung widerspricht der Kritik am Ausbildungsziel der Kriegsschule, wonach unbewegliche Charaktere, die lediglich Vorgaben erfüllten, bevorzugt wurden. Sie sagt andererseits freilich nichts darüber aus, wie Selbstständigkeit überhaupt definiert wurde.
Jene Kriegsschulabsolventen, denen mit der von der Kriegsschule ausgesprochenen Eignung eine Zukunft im Generalstab winkte, wurden nun höheren Kommanden zugeteilt, meist bei Brigaden oder Generalstabsabteilungen der Divisionen. Bis zur endgültigen Übernahme in den obersten Generalstab vergingen für gewöhnlich noch ein paar Jahre. Erst mit der erfolgreichen Ablegung der so genannten „Erzengelprüfung“ war man dann ein „echter Flaschengrüner“.
Aber schon jetzt galten Ronge und all die anderen jungen Offiziere, die Kurs auf den Generalstab genommen hatten, als etwas Besonderes. „Sie behielten“, schreibt der Kriegschullehrer General Bartha, „die Uniform ihrer Stammtruppenkörper, trugen aber auf der rechten Schulter eine goldene Spange, die sogenannte ,Achselspange‘. […] Als Dienstabzeichen trugen sie eine sehr auffallende, breite, gelbe Schärpe um die rechte Schulter und linke Hüfte, an deren unterem Ende zwei seidene Quasten hingen.“85
Elsa
Zu Jahreswechsel 1901/02 trat Oberleutnant Ronge dann seinen Dienst in der Steiermark an. Dieser bestand abwechselnd aus Truppenführung und Zuteilung zur Generalstabsabteilung. In Graz, seinem Stationierungsort, war es 1897, vor dem Hintergrund der Konflikte um die Sprachenverordnungen, zu besonders heftigen Protesten der deutschen Bevölkerung und schließlich zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die Armeeeinheiten, die zu Hilfe gerufen worden waren, um die Ruhe wiederherzustellen, wurden von besonders aufgebrachten Gegnern des Badenischen Programms wüst beschimpft und als „Verräter“ bezeichnet. Das passte wenig ins Bild einer ansonsten eher für ihre Beschaulichkeit bekannten Provinzstadt.
Ronge lebte sich schnell ein und setzte – was die Freizeitgestaltung anbelangte – gewissermaßen sein Wiener Leben hier fort. Er besuchte häufig das Stadttheater, wohnte Wohltätigkeits-Kränzchen bei, bestritt „Fecht-Abende“ und soupierte oder dinierte mit Kameraden. Nach etwa einem Jahr in Graz ergab sich jedoch ein weiterer Wechsel seines Dienstortes: er übersiedelte nach Laibach. Allerdings schaffte er es zwischendurch, immer mal nach Wien zu kommen. Seine beruflichen Verpflichtungen beanspruchten ihn offenbar nicht sonderlich. Es war durchaus nicht ungewöhnlich, dass Offiziere bei der Truppe nur halbtags beschäftigt waren.86 Außerdem gewährte die Armee großzügigen Urlaub. Wer es sich leisten konnte, also finanziell abgesichert war, so der Historiker István Deák, verbrachte mehr Zeit fern von seiner Einheit als bei ihr. „Letztlich war die Frage der Erträglichkeit oder Unerträglichkeit“ des Dienstes „eine Frage des Geldes“.87
Nicht nur nach Wien verschlug es den jungen Oberleutnant Ronge in regelmäßigen Abständen. Auch in Graz ließ er sich immer wieder blicken. Er hatte dort offenkundig einen außerordentlich positiven Eindruck hinterlassen. Seine Vorgesetzten schlugen ihn für eine Beförderung „außer der Rangtour“ vor. Wieder war von einem hervorragenden Offizier die Rede, wieder bejubelte man seine Fähigkeiten.88 Es sei an dieser Stelle aber auch erwähnt, dass nach Meinung Deáks positive bis überschwängliche Beurteilungen seitens der Vorgesetzten in der k.u.k. Armee geradezu inflationär verteilt wurden.89
Seinen früheren Stationierungsort besuchte Ronge aber nicht nur wegen der guten Erinnerung an seinen Dienst. In Graz bot nämlich schon zu Jahresanfang der Offiziersball willkommene Abwechslung. Maximilian Ronge verband mit ihm von nun an eine besondere Begebenheit: Auf dem Ball hatte er, am 24. Jänner 1903, zum ersten Mal, wie er in seinem Tagebuch notierte, „Elsa gesprochen“. Aufgefallen war ihm die damals 23 Jahre junge Dame wahrscheinlich schon früher. Jedenfalls verlief das eigentliche Kennenlernen von Ronge und seiner späteren Frau geradezu klischeehaft: Junger Offizier trifft Mädchen aus besseren Kreisen auf einem Ball …
Max Ronge erwies sich nicht als zaudernder Verehrer. Im Gegenteil. Schon am darauffolgenden Tag, am 25. Jänner, wurde er bei Elsas Familie vorstellig. Am 28. schrieb er, auch das ist im Tagebuch verzeichnet, Elsa einen Brief. Ihr Vater war ein hoher Offizier, der bereits über 70 Jahre alte Generalmajor Anton Ritter Rischanek von Kosnadol.90 Er war bereits aus dem aktiven Dienst ausgeschieden und hatte sich – auch ein Klischee – zumindest für bestimmte Zeiten im Jahr in einer Stadt niedergelassen, die bekannt war dafür, dass hier besonders viele Rentner residierten. Graz wurde nicht umsonst „Pensionopolis“ genannt. Die Familie des Generalmajors und späteren Feldmarschallleutnants stammte aus Böhmen, aus Mähren die seiner Frau Hermine, Tochter des Brünner Zuckerfabrikanten Strakosch.91 Elsa oder genauer gesagt Elisabeth Caroline Josefine Maria Antoinette Rischanek von Kosnadol war eine aus gehobenen Verhältnissen stammende junge Frau.
Dieser Umstand war insofern nicht unbedeutend, als die Heiratsvorschriften der k.u.k. Armee vorsahen, dass bei Eheschließung von Offizieren eine Kaution zu hinterlegen war. Diese Regelung war getroffen worden, um beim Ableben des Mannes die Versorgung der Witwe sicherzustellen. Außerdem sollte auf diese Weise eine standesgemäße Lebensführung des Offiziers und seiner Gattin gewährleistet und ein das Ansehen der Armee schädigendes Abrutschen des Paars in ein sozial tieferstehendes Milieu verhindert werden. Die Kaution war für einen Leutnant prohibitiv hoch angesetzt, belief sich auf bis zu zehn Jahresgagen und wurde mit steigender Charge entsprechend niedriger veranschlagt. Erst ab einem bestimmten Rang entfiel sie völlig. Bis 1907 wurde maximal einem Viertel, danach der Hälfte der Offiziere eines Regiments die Heiratserlaubnis gegeben.92
István Deák nähert sich dem Thema Offiziersheiraten recht nüchtern und berichtet von verschuldeten Offizieren, die in Anbetracht ihrer finanziellen Not „cautionsfähige“ Bräute sogar per Zeitungsannonce suchten.93 Junge Offiziere, mit oder ohne Schulden, so Deák, „hielten stets Ausschau nach einer geeigneten Partie, deren Familie reich und nicht abgeneigt war, sich von einer beträchtlichen Summe zu trennen, um ihre Tochter einem Nomaden anzuvertrauen, der oft einer anderen Nationalität angehörte und neben einem bescheidenen Einkommen noch die Aussicht auf einen frühen Tod hatte. Auch bestand die Möglichkeit, dass er seinen Posten verlor, wenn die Monarchie einmal wirklich zusammenbrach, wie dies so oft drohte.“94
Elsas Vater dürfte allerdings kaum so pessimistisch über das Schicksal des Habsburgerreiches gedacht haben. Das galt sicher auch für den Werdegang seines künftigen Schwiegersohns. Mit Ronge hatte er schließlich nicht irgendeinen Oberleutnant vor sich. Der junge Mann, der die Kriegsschule mit so aussichtsreichen Aufstiegschancen abgeschlossen hatte und kurz vor seiner Beförderung zum Hauptmann 2. Klasse stand, hatte – das ließ sich sagen – wenn nicht eine glänzende, dann zumindest eine solide Karriere vor sich. Und bei aller auch in der Öffentlichkeit artikulierten Kritik an der Armee oder an Vertretern des Offiziersstandes verknüpfte man mit dem Status eines Offiziers dennoch ein enormes gesellschaftliches Prestige. Die Tochter an einen Offizier zu verheiraten, war so gesehen nicht so abwegig wie man aufgrund Deáks Aussagen glauben könnte. Schon gar nicht, wenn der Brautvater selbst der Armee angehörte.
Ob Ronge seinerseits womöglich nur aus Karrieregründen eine junge Dame von Stand erwählte, deren Vater praktischerweise ein hochrangiger Offizier mit besten Verbindungen war, deren Familie Vermögen besaß und sicher über hervorragende gesellschaftliche Beziehungen verfügte, muss dahingestellt bleiben. Wenn aber, so Deák, ausgerechnet die Tiroler Kaiserjäger von der Verpflichtung, eine Heiratskaution beizubringen, ausgenommen waren, dann ist der Kaiserjäger Ronge wahrscheinlich kein „Kautionsjäger“ gewesen.95
Fest steht, dass der auf Freiersfüßen wandelnde Ronge auch in den kommenden Monaten nicht locker ließ und die Familie Rischanek des Öfteren in Graz sowie in Brünn aufsuchte. Auch in Wien ergaben sich Gelegenheiten, Elsa zu sehen. In den kommenden Monaten aber schienen sich diesbezüglich weniger Möglichkeiten aufzutun. Gleichzeitig mit seiner Beförderung zum Hauptmann wurde Maximilian Ronge als Kommandant der 1. Feldkompanie des Feldjägerbataillons Nr. 4 mit 1. November 1903 nämlich nach Nisko in Galizien versetzt.
Galizien
Ronge musste sich nach den Dienstjahren in Graz und Laibach nun auf eine ganz andere Umgebung einstellen. In Galizien befanden sich aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zum Zarenreich zahlreiche Truppenkontingente der k.u.k. Armee. Nichtsdestoweniger galt dieser abgelegene Winkel der Monarchie vielen als der Inbegriff der Tristesse, der Rückständigkeit, des Elends und der deprimierenden Langeweile, als „Vacuum der Begriffe“.96 Julius von Lustig-Prean war jedenfalls heilfroh, als er nach Abschluss der Wiener Neustädter Militärakademie nicht zu einem Truppenteil in Galizien ausgemustert worden war. Er hatte nämlich, wie er schreibt, keine Ahnung von den dort üblichen Sprachen, dem Ruthenischen und dem Polnischen, fand, dass ein Stationierungsort 24 Eilzugsstunden von Wien entfernt schier unerträglich weit weg war und versäumte auch nicht auf den offenbar als unangenehm empfundenen hohen Anteil der jüdischen Bevölkerung hinzuweisen.97 „Galizien“, so István Deák, „war eine Gegend, um sich zu betrinken und betrunken zu bleiben, die Nächte in schäbigen Cafés zu verbringen, zu spielen und zu huren, sich nach der Zivilisation zu sehnen und zu den Eisenbahnstationen zu pilgern, um dem vorbeifahrenden Expreß Lemberg-Krakau-Wien wenigstens nachzublicken.“98
Denkt man überdies an Joseph Roths Roman „Radetzkymarsch“, an die tragische Hauptfigur, den in Galizien stationierten jungen Leutnant Trotta und seinen Alltag zwischen „Hochprozentigem“ und ödem Dienst in einer im Morast versinkenden Gegend, will einem der eifrige und pflichtbewusste Maximilian Ronge nicht einfallen.
Langeweile wollte der junge Hauptmann jedenfalls gar nicht erst aufkommen lassen. Schon in den ersten Tagen nach seiner Ankunft erkundete er das Terrain rund um Nisko und fuhr an die russische Grenze. Außerdem begann er Russisch und Polnisch zu lernen, und er nützte die Zeit außerhalb des Diensts für militärwissenschaftliche Studien. Ronge wandte sich damals aber nicht nur Fragen der Manöverführung zu. Es nahm noch etwas Anderes, von nun an regelmäßig, seine Aufmerksamkeit in Anspruch: sein Gewicht. Am 12. Jänner 1904 wog er 55 ½ Kilo. Mit zirka 160 cm Körpergröße kein Hüne, war Ronge außerdem ein Leichtgewicht. Konstitutionsbedingte Schwächen versuchte er mit Disziplin wettzumachen. Ausdauer und Zähigkeit bewies er, wie sich zeigte, beim Büffeln für ein Examen ebenso wie auf dem Rücken eines Pferdes. Er bestritt regelmäßig kraftraubende Distanzritte, um sich fit zu halten. Der junge Offizier war in vielem ein „ Jünger“ des in Militärkreisen über seinen Tod hinaus beinahe kultisch verehrten Generals Franz Conrad von Hötzendorf. Vorbild war dieser offenbar auch in puncto „Krafttraining“ und Abhärtung. Conrads Ansichten vom „Recht des Stärkeren“ fielen nicht zuletzt unter jungen Offizieren, die der schwächelnden Armee wieder zu Ansehen verhelfen wollten, auf fruchtbarem Boden. Den eigenen Körper zu „stählen“, passte zu diesem Denken. Ronge aber gehörte ohnehin nicht zu jenen, denen es an „Drahtigkeit“ mangelte. Eher schon an entsprechendem Appetit. Im Dezember 1905 stellte der Asket fest: „54, 3 kg Max mit Reitstiefel.“ Später begann ihn selbst das Gewicht von Familienmitgliedern und Freunden zu interessieren. Er entwickelte allerdings auch abseits der regelmäßigen Notizen über Kilos ein ausgesprochenes Faible für Zahlen und Statistiken – überhaupt für alles, was in Listen und Tabellen zu erfassen ist. Bisweilen wirkt diese ausgeprägte Vorliebe für Aufzählungen regelrecht obsessiv. Immerhin besteht sein Nachlass zu einem nicht unbeträchtlichen Teil aus einem riesigen Konvolut an für solche Zwecke beschriftetem Papier. Der Offizier Ronge war wohl nicht zuletzt der Bürokrat Ronge.
Das aufgeheizte politische Klima zwischen Polen und Ruthenen – so wurden die österreichischen Ukrainer genannt – verleitete indes eher dazu, die Flucht zu ergreifen. Noch dazu fiel ihm die Trennung von Elsa nicht leicht. Ronge nützte jede Gelegenheit, um nach Brünn, Graz oder Wien zu fahren, wo er die Verlobte treffen konnte. In Nisko selbst warteten demgegenüber oft keine wirklich „fesselnden“ Aufgaben: „Felddienst, Übungsschießen, Distanzeinschätzen, Exerzieren“99 – das war es, was er den Soldaten beibringen sollte. Der junge Hauptmann musste allerdings feststellen, dass er sich aufgrund sprachlicher Barrieren mehr recht als schlecht mit seinen Subalternoffizieren und noch weniger mit seinen Soldaten verständigen konnte, wobei der Kontakt mit Mannschaftsangehörigen ohnehin keine Rolle spielte. Die Kluft zwischen Offizier und einfachem Soldaten war tief. Ein Offizier befehligte die Soldaten, gab sich aber nicht mit ihnen ab. Bezeichnenderweise kommen diese in den Memoiren ehemaliger Offiziere so gut wie nie vor, höchstens vielleicht in Gestalt eines Offiziersburschen oder „Pferdewärters“. Ronge war hier keine Ausnahme.
Im Dienst konnte man freilich den Kontakt nicht völlig vermeiden. Da kaum einer der Untergebenen in Nisko seiner Meinung nach ausreichend Deutsch beherrschte, ließ er sich etwas einfallen. Ronges Notizen, die er über seine Tätigkeit in Galizien anfertigte, ist zu entnehmen, dass er Deutschkurse einrichtete, um die Kommunikation innerhalb seiner Einheit zu verbessern.100 Was Verständigungsprobleme anbelangte, war der Kommandeur Ronge kein Einzelfall. Den meisten Offizieren der vielsprachigen k.u.k. Armee erging es ähnlich. Deutsch war die Kommandosprache, doch wurden nur etwa 80 grundlegende Befehle wie „Rechts“, „Links“, „Halt“, „Rührt Euch“ oder „Feuer“ in dieser Sprache erteilt, alle übrigen in den jeweiligen „Regimentssprachen“.101 Das konnte dazu führen, dass der ausgegebene Befehl in gleich mehrere Sprachen übersetzt werden musste. Diese Regelungen waren Angelpunkt, um gegen den „deutschen Charakter“ der Armee zu protestieren und die Diskriminierung von Soldaten mit nicht-deutscher Muttersprache zu thematisieren.102 Der Ende 1899 vom Zaun gebrochene so genannte „Zde-Streit“, bei dem tschechische Rekruten aus nationalen Gründen anstatt „hier!“ das tschechische „zde!“ schrieen, war symptomatisch für die Verhärtung der Standpunkte.